Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. MГӨrz 2021 вҖ“ Paul, Baldwin, Wenzel
FГјr die freitГӨgliche Date Night griff ich endlich mal zu Stevan Pauls japanischem Kochbuch, das schon viel zu lange hier nur durchgeblГӨttert, aber nicht nachgekocht wird. Lustigerweise kochte Juliane von вҖһSchГ¶ner Tag nochвҖң genau dasselbe Rezept nach, das ich auch zubereitete, aber sie konnte das auch fotografisch belegen. Das hГӨtte ich auch gekonnt, wollte ich aber nicht, weil ich totaler Honk die Nudeln als letztes in die SchГјssel mit Ramen gab anstatt den ganzen hГјbschen Kleinkram wie ein halbiertes Ei, MГ¶hrenstreifen, Mais, TofuwГјrfel und FrГјhlingszwiebeln, weswegen der Teller fГјrchterlich aussah. Diese geistigen Aussetzer passieren quasi immer, wenn F. am Tisch sitzt; ich bin so daran gewГ¶hnt, nur fГјr mich und Insta zu kochen, das dauernd was schiefgeht, wenn noch jemand anders einen Teller haben will.
Daher muss das Interweb jetzt auf ein Foto bei gelblichem KГјchenlicht verzichten, aber ich hatte immerhin einen schГ¶nen Freitag. Zeitgleich mit dem bereits verbloggten Himbeer-Marmorkuchen (da fГјge ich gleich noch kleine Edits ein, weil ich den Kuchen gestern gleich nochmal buk, aufgepasst!) kochte ich zunГӨchst eine GemГјsesuppe, die dann ewig abkГјhlen musste. Gleichzeitig setzte ich ein Dashi an, wobei das nur ein halbes Dashi war: auf die Kombu-Alge hatte ich verzichtet (SchilddrГјse, Jod, blablabla), daher war das eigentlich nur heiГҹes Wasser mit Bonitoflocken, in das irgendwann noch ein Haufen Ingwer, Sake und Miso-Paste durften. Beides zusammen ergab mit den oben erwГӨhnten Toppings ein ganz herrliches Essen, das ich mit frischem Koriander etwas ruinierte; ich dachte, Koriander passt zu allem, aber nein.
Gemeinsam eingeschlafen, beide erschöpft von der Woche, der Pandemie, Sie wissen schon, Sie kennen das.
—
Samstag konnte ich mich nicht zum Putzen aufraffen, egal, Pandemie, das ist jetzt meine Go-to-Ausrede. Stattdessen gab’s Himbeerkuchen, ich schwitzte wie noch nie auf der Yogamatte, fand es aber masochistischerweise total super, las ein weiteres Buch quer, das die Staatsbibliothek diese Woche zurГјckhaben mГ¶chte und schaute abends endlich вҖһI am not your negroвҖң, was null gute Laune machte. Soll der Film vermutlich auch nicht.
Die Bibliotheken, auch mein geliebtes ZI, haben seit letzter Woche in MГјnchen wieder geГ¶ffnet, und ich kГ¶nnte mir auch endlich ein Ticket fГјrs Lenbachhaus gГ¶nnen, um mal wieder in der Neuen Sachlichkeit rumzuhГӨngen, oder fГјr die Pinakothek der Moderne, um bei Herrn Protzen vorbeizuschauen und ihm zu erzГӨhlen, dass er als mittelbegabter Maler und NS-Profiteur jetzt ne fertige Diss hat, aber das verkneife ich mir alles, auch wenn’s weh tut. Die Inzidenzzahlen sind jetzt wieder da, wo sie Oktober waren; wo MГјnchen im Februar mal kurz unter 30 war, sind wir jetzt wieder knapp unter 70, und ich ahne, dass das launig weiter nach oben gehen wird, bis ich mich nicht mehr in ZГјge traue, um im April das MГјtterchen zu unterstГјtzen. Danke, Г–ffnungspolitik, du bist so toll. Ich weiГҹ, dass ich aus einer sehr privilegierten Perspektive argumentiere, ich muss hier nicht drei Kleinkinder bespaГҹen oder mich mit anderen Leuten um Ruhe in der Wohnung streiten, aber so ganz langsam fГјhle ich mich von diesem Land, in das ich trotz allem Gemeckere immer ein absolutes Grundvertrauen hatte, im Stich gelassen. An die BevГ¶lkerung zu appellieren, doch bitte diszipliniert zu bleiben, aber gleichzeitig schulpflichtige Kinder in den PrГӨsenzunterricht zu zerren und alle Gartencenter (und Bibliotheken) wieder zu Г¶ffnen, in der bescheuerten Hoffnung, niemand wГјrde diese Angebote wahrnehmen, wenn man nur lange genug вҖһbitteвҖң sagt, ist einfach irrsinnig und es macht mich sehr wГјtend und gleichzeitig kraft- und mutlos.
—
Deswegen war Sonntag auch Sofatag angesagt. Ich buk nebenbei den Himbeerkuchen noch einmal, um ein paar Dinge anzutesten, und las Olivia Wenzels вҖһ1000 serpentinen angstвҖң, von dem ich auf 54 books das erste Mal etwas gehГ¶rt hatte. Die Site besprach das Buch anhand einer weiteren Besprechung im Literaturclub, was mich schlicht neugierig machte. Dort wurde das Buch der Schwarzen Autorin anscheinend aus eher ignoranter Perspektive rezensiert, was zu solchen AbsurditГӨten wie den folgenden endete:
вҖһIm Literaturclub versucht die Gastgeberin Nicola Steiner, Philipp Tingler dann doch noch von der LegitimitГӨt Wenzels ErzГӨhlweise zu Гјberzeugen. Es sei auf eine Art sperrig, auf eine andere aber auch sehr verspielt und spreche junge Frauen zwischen 20 und 30 sicher an. вҖһIst das jetzt meine Schuld, dass ich keine junge Frau zwischen 20 und 30 binвҖң, fragt Tingler. Nicht jedes Buch spreche Leser gleichermaГҹen an, entgegnet Steiner und Heidenreich bekundet am Bildschirm ihre Zustimmung. Steiner sagt:
вҖһIch kann mir vorstellen, dass junge Frauen das jetzt entdecken kГ¶nnen und mit dieser Art der Literatur auch etwas Universales entdecken kГ¶nnen, nГӨmlich diese Ausgrenzung und Schablonen-Denken. Wir haben das ja auch вҖ“ man wird festgelegt auf etwas, da ist man die Blondine oder der Bodybuilder und man versucht zwischendurch, diese Etiketten von sich zu werfen und zu sagen: ich bin ganz viele und ganz viele kaleidoskopmГӨГҹig.вҖң
Im Folgenden greift Tingler seinen seltsamen Universalismusanspruch an die Literatur noch einmal auf. вҖһUniversalismus in der Literatur ist ein Aspekt, eine Kohorte von Frauen zwischen 20 und 30 ist ein anderer AspektвҖң, so Tingler. вҖһWarum bin ich nicht mitgemeint in diesem Buch?вҖң Reina Gehrig versucht dagegen zu halten, meint, dass das Buch nicht nur fГјr Frauen zwischen 20 und 30 interessant sei. Ihr Einwand wird von Heidenreich auf dem Monitor abgeschnitten, die das bunte Cover des Buches vor die Kamera hГӨlt und in die Runde fragt, ob das Buch nicht вҖһabsurd hГӨsslichвҖң sei. Ohne Umschlag sei es noch viel hГӨsslicher, ergГӨnzt Tingler.вҖң
Ich finde das gelbe Schutzcover okay und das grell pinkfarbene Buch darunter sogar ziemlich super, das ist natГјrlich im Bezug auf den Inhalt total egal, aber ich kombinierte es trotzdem mit gelber Teetasse und gelbem Lesezeichen.
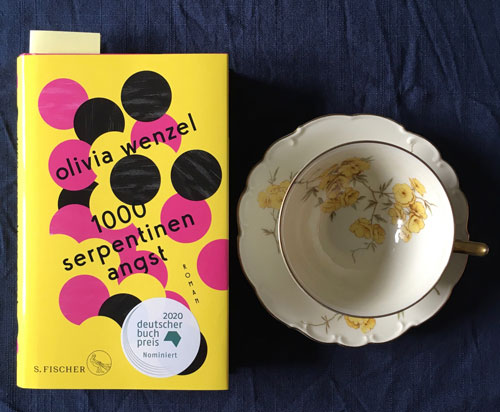
Ich muss gestehen, dass ich auch etwas mit dem Buch fremdelte, was aber nicht am Inhalt, sondern der ErzГӨhlweise lag. ZunГӨchst liest es sich wie ein Dialog, bei dem wir erst herausfinden mГјssen, wer Гјberhaupt spricht. Kaum hat man sich das irgendwie zurechtgelegt, wechselt das Buch in lГӨngere Beschreibungen von Fotos, die Heidenreich laut Eigenaussage quГӨlend gelangweilt hГӨtten; ich empfand sie als willkommene sprachliche Ruheinseln inmitten der vielen gesprochenen SГӨtze (und sie erinnerten mich natГјrlich an gewohnte kunsthistorische Bildbeschreibungen). Dann kommen wieder Dialoge, aber die Sprechenden scheinen ihre PlГӨtze gewechselt zu haben; wo zunГӨchst die Ich-ErzГӨhlerin gefragt wird, wo sie denn jetzt sei, fragt sie plГ¶tzlich selbst: вҖһWo bin ich jetzt?вҖң Dieses Dialogische, was eher an Skripte oder TheaterstГјcke erinnert, lieГҹ mich zunГӨchst etwas angestrengt zurГјck, weil ich mich auf einen klassischen Roman eingestellt hatte, aber es liest sich alles sehr schnell und unwiderstehlich weg, dass es mir nach wenigen Seiten kaum noch auffiel, eben keinen klassischen Roman zu lesen.
Ich mochte, dass man sich die Geschichte oft selbst zusammenstГјckeln muss, die mir aus HalbsГӨtzen und Fotobeschreibungen angeboten wird, ich mochte die Perspektivwechsel und das Hin- und Herspringen in der Zeit, man wird als Leserin selten fГјr dumm gehalten. Nur manchmal schleichen sich AbsГӨtze in die unterschiedlichen Textformen, die ein bisschen wie ein Wikipedia-Artikel klingen, mit denen der Leserin Rassismus beigebracht werden soll. Die haben genervt und ich weiГҹ auch nicht, warum Wenzel sie einfГјgte, denn ihre Dialoge und Schilderungen von erfahrenem Wissen sind weitaus eindringlicher als angelesenes. Das Buch geht clever auf innere Kritik ein, indem es die bis zum Schluss nicht aufgelГ¶sten Dialogpartner SГӨtze sagen lГӨsst wie вҖһImmer wieder diese Geschichten, in denen dir fast etwas passiert, aber letztlich doch nichtвҖң, was vГ¶llig verkennt, dass ein Leben in konstanter Erwartung von Gefahr ein stГӨndiges Passieren ist. Auch ein launiges вҖһDu sitzt am Ufer, die Sonne scheint, keine Nazis in Sicht. Was genau ist dein Problem?вҖң fassen gut zusammen, wie wenig ich als weiГҹer Mensch die Situation von Schwarzen Menschen nachvollziehen kann. Insofern sind SГӨtze wie oben вҖ“ вҖһWarum bin ich nicht mitgemeint?вҖң вҖ“ von so dusseliger Egozentrik, das man sich fragt, wie oft marginalisierte Menschen ihre Geschichte eigentlich noch erzГӨhlen mГјssen: Du bist nicht mitgemeint, weil es dir nie so ergehen wird wie der ErzГӨhlerin. Aus dem simplen Grund, dass du weiГҹ bist. Setz dich hin und hГ¶r zu. Oder lies das Buch nochmal. Auch wenn du dich nicht fГјr Hautfarben interessierst; vielleicht magst du ja ein cleveres Buch Гјber AngststГ¶rungen, Selbsterkenntnis ohne Esoterik, DDR-Geschichte, Liebe und Freundschaft lesen. Das ist es nГӨmlich auch.