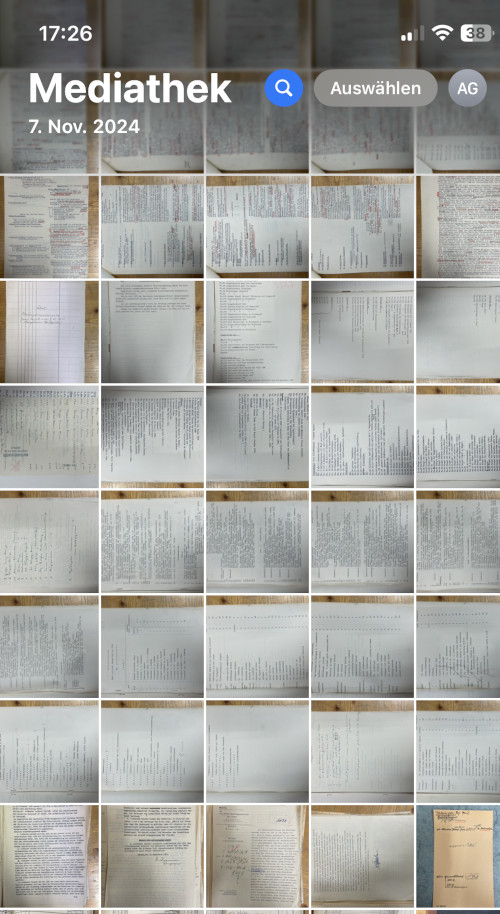Der Grund, warum es hier sehr ruhig ist und auch noch ein bisschen so bleiben wird: Ich mag nicht über meinen Job schreiben. Ich würde zwar total gerne über meinen Job schreiben, denn er ist irre spannend und befriedigend und toll, aber ich mache das hier ja alles nicht für mich, sondern für einen Auftraggeber, und ehe ich Blogeinträge abnicken lasse, schreibe ich lieber gar nichts.
Neben meinem Job reicht die Kraft in Passau ehrlich gesagt auch kaum noch für andere Dinge, die ich verbloggen könnte, und es ist im Prinzip ganz nett, nach über 20 Jahren nicht mehr jeden Tag darüber nachdenken zu müssen, ob das, was ich gerade erlebe, einen schicken Eintrag produziert. Andererseits frage ich mich des Öfteren, was ich in einem bestimmten Monat im letzten Jahr gemacht habe oder was ich aß oder hörte oder was mich beschäftigte – und derzeit fehlt leider mein schönes Tagebuch, das diese Informationen immer brav für mich bereithielt.

(Ich knipse sehr gerne vom Berg runter, auf dem die Burg steht, in der das Museum ist, in dem ich arbeite.)
Ich beschäftige mich seit einem Jahr mit den Zugängen des Oberhausmuseums in Passau zwischen 1933 und 1945. Und das mache ich noch ein weiteres Jahr, weswegen es hier ab morgen vermutlich wieder ruhiger wird. Aber ab August 2026 plaudere ich wahrscheinlich wieder wild in der Gegend rum, denn, jauchzet, frohlocket, mein Forschungsantrag, über dem ich monatelang gebrütet und den ich schließlich im Mai 2024 eingereicht habe, wurde im Mai 2025 abgenickt und durchgewunken, ohne Änderungen oder Abzüge. In einem Jahr bin ich also wieder nur noch in München, wo genau, verrate ich, sobald mein herrliches, dreijähriges, vollfinanziertes Forschungsprojekt auf der Website der betreffenden Institution steht. Nächstes Vorstellungsgespräch frühestens Ende 2029, wo-hoo! Dann bin ich 60, das wird bestimmt ein Klacks, wieder was Neues zu finden.
Ich müsste mich eigentlich total freuen, wieder ausschließlich in München zu arbeiten, aber ein winziges bisschen Wehmut ist komischerweise auch dabei, denn: Das ist echt nett hier! Ich habe jeden Tag das Gefühl, einen sinnvollen Job zu machen, was ich sehr lange nicht hatte. Zusätzlich ist mir auch etwas gelungen, was man als Provenienzforschende immer erreichen möchte (und dann gleichzeitig überhaupt gar nicht), nämlich Raubkunst wiederzufinden und sogar die Erbberechtigten dazu. Über den Fall schreibe ich demnächst an anderer Stelle (hoffentlich verlinkbar), aber bis dahin gibt’s den kurzen Bericht aus der Passauer Neuen Presse, den ich auf Bluesky ohne Paywall lesbar gemacht habe. Der Artikel hat einige Fehlerchen, aber der Name der jüdischen Sammlerin und die zwei Werke stimmen.

Ich bin inzwischen nach Feierabend nicht mehr ganz so durch wie in den ersten Monaten, wo ich nicht nur einen neuen Job, eine andere Stadt, einen zweiten Kühlschrank und tägliches Autofahren verarbeiten musste, aber ich gebe zu: Sobald der Arbeitsrechner aus ist, ich das Auto im Parkhaus abgestellt und den Fußweg nach Hause erledigt habe, meist mit Umweg über ein, zwei Supermärkte, Woolworth (Kleinscheiß, der fehlt) oder Thalia (Bücher, die fehlen), reicht die Kraft nur noch zur Zubereitung des Abendessens, das meist zur Hälfte zum Mittagessen am nächsten Tag auf der Burg wird, ein, zwei Serienfolgen, ein bisschen Lesen, die Rätsel der New York Times, die Französisch-Dosis auf Duolingo (Hebräisch habe ich schon lange aufgegeben, dafür ist die App wirklich nicht gemacht), und dann falle ich zwischen 21 und 22 Uhr ins Bett und schlafe wie ein Stein. Ich habe seit einem Jahr kein Ende eines Fußballspiels mehr mitbekommen, ich bin bei der EM-Verlängerung Deutschland-Spanien weggedöst, mein Gehirn und ich sind irgendwann einfach durch und wollen nicht mehr.
Dafür stehe ich jeden Tag um 6 Uhr auf (und mache Fotos wie das oben stehende) und bin meist spätestens gegen 7.30 Uhr auf der Burg, was mich immer noch erstaunt. Ich hatte in meinem Erwachsenenleben eigentlich nie Jobs, die vor 9 Uhr begannen, und ich stand nie vor 7 auf. Im letzten Sommer war ich aber immer so früh wach, erstens weil die Passauer Wohnung nicht so dunkel ist wie die in München und zweitens, weil sie ein Hitzeloch ist. So schön es ist, direkt über einer Konditorei zu wohnen, so beknackt ist es, wenn diese die Backstube ernsthaft im Haus hat und so gefühlt alle Wände mitheizt. Ich musste im Winter kein einziges Mal meine Heizung anmachen, nicht mal bei minus acht Grad draußen, nicht mal im Bad. Aber jetzt im Sommer halte ich es in einem Zimmer nur mit zwei Ventilatoren aus bzw. ziehe, wenn es geht, fluchtartig ins Münchner Home Office, sobald es mehr als 25 Grad werden, weil es in der Wohnung, laut Thermometer, immer knappe zehn Grad wärmer ist als draußen. Konstant. Das hieß vor einem Jahr, als ich erst einen Ventilator besaß, dass ich es nur mit weit geöffneten Fenstern nachts aushielt, weswegen es noch früher hell war als mit geschlossenen Gardinen, weswegen ich früher wach war, weswegen ich ergeben dachte, dann stehste halt auf und bis früh am Schreibtisch. Und das ist irgendwie nicht weggegangen, denn: Es ist schon schön, um 16 Uhr Feierabend zu haben und nicht um 18 Uhr irgendwas, wie ich es aus der Werbung gewohnt war.

(Die Veste auf Oberhaus bei Sonnenaufgang. Ich sitze links vom Kapellentürmchen und gucke vom Büro aus nach Österreich. Hoch die Republik!)
Das ewige Hin und Her zwischen München und Passau wird auch allmählich weniger nervig, weil es ab heute auf die Schlussgerade geht und ich inzwischen gelernt habe, dass zwei Stunden Autobahnfahrt doch besser sind als (wenn ich Glück habe) dreieinhalb in Zug und U-Bahn und ich sonntags nicht immer schon mittags zum Bahnhof in München muss, sondern noch den ganzen Tag mit F. genießen kann und dann halt abends mit der Sonne im Rücken gen Donau schaukele (und dann sogar gratis in der Nähe meiner Wohnung parken kann und ich mir einmal den Fußweg ins Parkhaus erspare). Neuerdings mit Podcasts statt mit Musik, da geht die Zeit noch schneller rum. Und wie ich des Öfteren schon festgestellt habe: Ich fahre anscheinend antizyklisch. Auf der Gegenfahrbahn ist Freitagabend Richtung Passau mehr los als Richtung München, und Sonntagabend ist es genau anders herum.

(Wenn ich nicht die Burg fotografiere oder von ihr runter, halte ich mich gerne unter der brutalistischen Schanzlbrücke auf, die im Winter echt moody drauf ist. #nofilter)
Meine Packstation ist direkt bei Aldi und Lidl und der Waschstraße. Mehr kenne ich quasi nicht von Passau. Okay, den Weihnachtsmarkt mit dem guten Glühwein kenne ich auch. Und das Stadtarchiv!
Oh, und der kleine Feinkostladen nebenan kennt dafür mich. „Ich habe da gerade einen schönen Winzersekt aus der Wachau für mich geöffnet, ich sag Ihnen, ob der was taugt!“

Ich kann meine geliebten Frühlingszwiebelfladen auch mit der Thermosflasche ausrollen, wie ich inzwischen gelernt habe, denn mein Nudelholz ist in München und ich will nicht NOCH WAS doppelt kaufen und hey, wer braucht schon ein Kuchengitter. Okay, die Kuchenform habe ich doppelt gekauft.

Ich weiß bis heute nie, was im jeweils anderen Kühlschrank ist, aber inzwischen hat es sich eingebürgert, dass F. den Münchner Kühlschrank am Donnerstag oder Freitag mit allem auffüllt, was ich für ein Käsebrot mit Gemüsebeilage brauche, und ich am Montag einfach zum Lieblingsbäcker gehe, um ein Pfefferstangerl mit was drauf zu erwerben, wenn im Passauer Kühlschrank nichts mehr liegt, was ich für die Mittagspause vorkochen könnte.
Ich sage „Pfefferstange“ statt „stangerl“, ich kann immer noch kein bairisch, ich werde es nie können, und nebenbei ist Passauer Niederbairisch noch mal eine Extraschippe WTF im Vergleich zu München. Bayerische Kollegin: „Anke, man sieht dir immer an, wenn du uns nicht verstehst, wir sprechen dann extra langsam.“

Ich liebe mein Büro im Rapunzelturm, wo ich quasi fast immer alleine bin und vor mich hindenken kann, aber die Mittagspausen mit den Kolleginnen sind auch immer schön. (Kein Gendern nötig, es ist so herrlich!) Sie führen allerdings dazu, dass ich jetzt einen Airfryer besitze, weil wir so oft darüber geredet haben, und bei 35 Grad in der Wohnung ist das ganz nett, nicht den Backofen nützen zu müssen für ein Portiönchen Abendessen. Mehr als ein Portiönchen passt auch nicht rein, war ein 20-Euro-Schnäppchen beim Aldi. Sie wissen schon, der bei der Packstation.
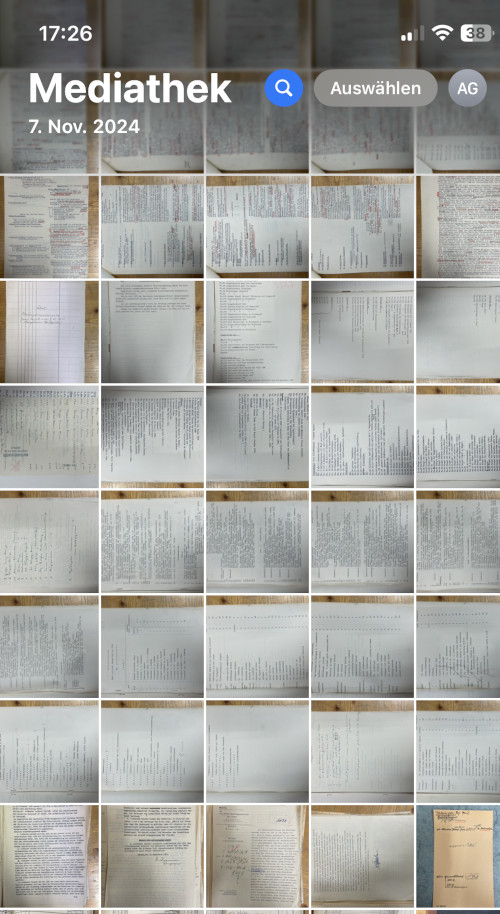
(Besuch im Stadtarchiv Passau. Meine halbe Fotomediathek auf dem Handy sieht inzwischen so aus. Die andere Hälfte sind die Stockwerkschilder aus dem Parkhaus, wo ich abends fotografiere, wo ich stehe, weil ich das morgens garantiert nicht mehr weiß.)
Was mir allerdings wirklich fehlt: die schönen klassischen Konzerte, die ich mit F. gemeinsam in München besuche. In den letzten Jahren saßen wir des Öfteren mitten in der Woche in der Isarphilharmonie, und das geht jetzt leider gar nicht. Wir haben es auch erst gar nicht am Wochenende versucht, denn meistens möchte ich da lieber mit ihm Redezeit haben und nicht stumm drei Stunden nach vorne starren.
Wir können auch nicht mehr ganz so regelmäßig fine dinen wie früher, aber ein paar Mal dann doch: Wir waren immerhin einmal im Sparkling Bistro, dann im Mokum, neu und toll, im fiesesten Geschäft ever, nämlich Champagne Characters, im guten, alten Broeding, deutlich öfter im Waltz, ein paarmal in der Bar Tantris, und, jaha, bei Marcel von Winckelmann, den einzigen Stern Passaus. Das war richtig nett. Alleine nutzte ich eine Dienstreise nach Regensburg, um im Roten Hahn zu speisen (leider nicht von der Stadt bezahlt), und ich freue mich jetzt schon auf die Weinbar Garbo von den Waltz-Jungs, die ich im August endlich mal ansteuern werde, denn dann habe ich Urlaub.
Den habe ich seit Langem mal wirklich nötig. Zu Ende Juli musste ich den Zwischenbericht über mein Projekt abgeben, der dann auf der oben verlinkten Website Proveana veröffentlicht wird. Er war zum Schluss 152 Seiten lang, und irgendwann ahnte ich, warum F. immer mit den Augen rollte, wenn ich sagte, ABER ICH WEISS DOCH NOCH GAR NICHTS.
Urlaub bedeutet derzeit wie auch schon die zwei Wochen zum Jahresende: möglichst nur rumliegen. Nirgendwo hinfahren (außer zum Mütterchen). Einfach mal nur an einem Ort sein und nur über diesen einen Ort nachdenken bzw. ihn putzen müssen. Alle Städtereisen müssen bis nächstes Jahr warten, denn derzeit möchte ich, wenn der Job erledigt ist, einfach nur irgendwo sitzen. Zum Beispiel auf meinem schönen Münchner Balkon, der dieses Jahr aus Pendelgründen keine Blümchen oder Kräuter hatte. Aber nächstes Jahr wieder!

Ich fotografiere total gerne vom Berg runter, auf den ich jeden Morgen rauffahre, und freue mich jetzt schon auf den Herbst, wenn wieder alles im Nebel liegt. Folgen Sie meinen Insta-Storys, da kommen immer schöne Passau-Bildchen.

Ich habe bestimmt noch mehr erlebt im letzten Jahr, aber das wäre die Zusammenfassung: Es war ein lehrreiches, spannendes, sinnvolles und gutes Jahr, was die Arbeit angeht, und ein herausforderndes, aber – auch durch gute Kommunikation, gemeinsame Mühe und Vertrauen – ein wunderschönes, was das Private angeht. Ich nehme bitte von beidem noch mal ein Jahr Nachschlag.