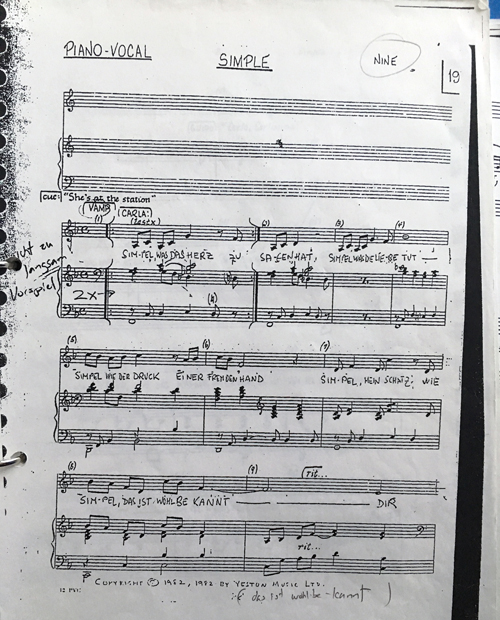ICH SCHREIE NICHT, DIE TITEL SIND IN VERSALIEN! Dabei haben die beiden schönen Ausstellungen das gar nicht nötig, sich so aufzuplustern. Wir hatten viel zu besprechen und wagten uns nebenbei erstmals an Orange Wines. Das war ein sehr lehrreicher Abend.
Normalerweise schreibe ich nicht extra auf, was ihr auch hören könnt, aber ich habe schon bei den letzten Aufnahmen gemerkt, dass mir das ein bisschen fehlt, im eigenen Blog nachlesen zu können, was mir gefallen hat. Wir sprechen noch über weitaus mehr Kunstwerke als ich hier erwähne, aber diese wollte ich persönlich mir merken. Auf unserer offiziellen Seite könnt ihr diesen Eintrag hier auch in deutlich kürzer lesen.

Podcast herunterladen (MP3-Direktlink, 86 MB, 108 min), abonnieren (RSS-Feed für den Podcatcher eurer Wahl), via iTunes anhören.
00.00:00. Begrüßung und Vorstellung.
00.01:30. Blindverkostung des ersten Weins.
00.03:55 : Die erste Ausstellung: LAND_SCOPE im Stadtmuseum München, läuft noch bis zum 31. März. Ich fand die Ausstellung überraschend groß, ich wusste gar nicht, wie viel Platz im kleinen Stadtmuseum ist. Ich zitiere von der Website: Die Schau besteht aus „über 130 Kunstwerken, die zwischen 1972 und 2018 entstanden sind“. Und dann zitiere ich gleich noch weiter, weil das das einzige zu rupfende Hühnchen ist: Angeblich „zeichnet die Ausstellung den Facettenreichtum der fotografischen Naturdarstellungen bis in die Gegenwart nach, setzt die Weiterentwicklung und nicht selten die Überwindung der Gattung Landschaft mit Hilfe des Lichtbildes ins Relief.“ Bitte was? Wer setzt was ins Relief? Wie setzt man überhaupt irgendwas „ins Relief“? Schwafelalarm galore, der so ziemlich für alle Ausstellungstexte galt, weswegen ich auch den eigentlich günstigen Katalog nicht gekauft habe, so bockig war ich.
Ansonsten ist die Ausstellung aber sehr sehenswert: einfach die Texte überfliegen und dann ignorieren. Ich persönlich mochte das großformatige Foto „Himmelstillleben“ (1998) von Anton Henning am liebsten. Das findet ihr praktischerweise in einem älteren Ausstellungsflyer der DZ Bank, die auch für diese Ausstellung der Leihgeber war; auf Seite 29 in diesem pdf ist das Bild zu sehen. Leider recht hell, aber man kann es mit etwas gutem Willen erkennen: Es zeigt einen Innenraum, an dessen Wand lauter kleine Gemälde lehnen. Auf diesen sind Wolken oder Himmel abgebildet, teilweise in buntfarbiger Abend- oder Morgenstimmung. Ich fand es schlicht großartig, wie ein so wichtiges, übergroßes Bildmotiv wie der Himmel einfach so unbeachtet in der Gegend rumsteht. Der Himmel wurde nicht nur gemalt, sondern auch besungen und bedichtet, er ist ein Sehnsuchtsort, eine Metapher für das Jenseits, größer geht es ja kaum noch – und hier ist er in kleinen Rechtecken gefangen, die anscheinend gerade niemand braucht oder die vielleicht später für wenig Geld auf dem Flohmarkt verscherbelt werden. Fand ich toll.
Ebenfalls ganz oben auf meiner Liste: zwei Bilder aus der Serie „Die bleichen Berge“ von Walter Niedermayr. Die ausgestellten, fast schwarzweißen und unwirklich scheinenden Bilder sind meiner Meinung nach nicht online, aber der Überblick „Alpine Landschaften“ auf Niedermayrs Website zeigt sehr gut die Richtung.
Mich faszinierten außerdem die italienischen Landschaften von Luigi Ghirri, die mich an die französischen Impressionisten, vor allem Cézanne (der gar keiner sein wollte), erinnerten. Die Fotos zeigten klar erkennbar neuzeitliche agrarische Szenen, meist menschenleer, nur Gelände und Gerätschaften, aber ich fühlte mich rein durch die Bildkomposition, aber nicht durch die Farben, um 100 Jahre zurückversetzt.
Das Bild, das uns alle lange beschäftigte, auch weil es so groß war, war „Yayladagi, Turkey“ von Richard Mosse. Es ist hier zu sehen, aber so richtig wirkt es erst, wenn man davor steht. Vermutlich ist auch seine Größe ein Grund dafür, dass ich ewig der Meinung war, dass das ein Komposit ist, nicht nur ein Bild, sondern diverse, die zusammengefügt wurden. Ist es aber angeblich nicht. Was wir auch in der Ausstellung so nebenbei gemerkt haben: Wir trauen Fotos nicht mehr.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass die ersten 20 Minuten des Podcasts arg beschreibungslastig sind, weil wir über so viele Werke sprechen. Wir bessern uns aber und kriegen uns auch, wie immer, irgendwann in die Haare.
00.33:50. Der zweite Wein.
00.57:30. Fazit der ersten Ausstellung: drei Daumen nach oben.
00.59:20. Der dritte Wein. Ich prophezeie, am Ende der Aufnahme Fan von Orange Wines geworden zu sein, meckere aber vorsichtshalber erstmal weiter rum.
01.04:30. Die zweite Ausstellung, BODYSCAN, läuft noch bis zum 2. März in der Eres-Stiftung. Das ist ein winziges Untergeschoss in der Nähe des Kurfürstenplatzes, wo man erstaunlich viel Kram unterbringen konnte. Der Untertitel der Ausstellung lautet „Anatomie in Kunst und Wissenschaft“ und genau das ist es dann auch. Wir sehen künstlerische Werke, aber auch Material aus der medizinischen Arbeit, Forschung und Historie. Klingt ein bisschen wie Gruselkabinett auf Knopfdruck, aber ich glaube nicht, dass das der Anspruch war. Was genau der Anspruch war, habe ich allerdings bis zum Schluss nicht verstanden.
Ich wurde während des Rundgangs sehr mit meiner eigenen Körperlichkeit und deren Endlichkeit konfrontiert, und zwar in einem Ausmaß, den ich nicht vorhergesehen hatte. Ich war ebenfalls überrascht davon, welche Ausstellungsstücke mir nahe kommen konnten. So steht man gleich im ersten Raum vor dem abgebildeten Text und dem Video von Allen Ginsbergs „Ballad of the Skeletons“ (1996), lauscht dem Video per Kopfhörer – und direkt neben einem, man kann ihm nicht ausweichen, steht ein echtes männliches Skelett von circa 1900, das als Lehrmodell diente. Ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass mir Skelette nichts ausmachen, aber das fand ich nach nicht mal einer Minute so enervierend, neben einem ehemaligen Menschen zu stehen, dass ich das Video nicht zuende schauen konnte und wollte.
Das ist jetzt keine bahnbrechende Entdeckung, wie fragil unser Knochengerüst ist und wie leicht es zerstört werden kann, aber so direkt vor Augen geführt bekommen hatte ich es selten. Die Rippen des Skeletts waren durchtrennt und mit Messingklammern wieder zusammengeflickt worden, und mir kamen sie papierdünn und viel zu fein vor, um einen Mann tragen zu können. Weiter hinten in der Ausstellung hingen zwei überlebensgroße Drucke von 1752, die ein recht gut gelauntes Skelett (ich glaube, teilweise noch mit Muskeln und Organen) zeigten; ein Raum weiter grinste einem ein Skelett von einem Kupferstich von 1747/48 entgegen, und alle waren groß gewachsen, standen gerade und selbstbewusst in der Gegend herum, hatten einen großen Kopf und perfekte Zähne – und dann steht man vor diesem eher jämmerlichen echten Knochenhaufen und weiß, dass das Quatsch ist und dass von uns nur Knöchelchen übrig bleiben, die krumm und schief und voller Fehler sind. (Was irgendwo auch nett zu wissen ist, wenn man sich die ganzen gephotoshoppten perfekten Körper anschaut, die uns in den Medien begegnen, aber das hilft auch nur für fünf Sekunden.)
Ein weiterer Aha-Moment war die Betrachtung von zwei Fotos, einmal von Jeff Wall und einmal von Thomas Struth (hier als Artikelbebilderung zu sehen), auf denen Wunden als Modell nachgebildet wurden bzw. wo ein Mann einen mumifizierten Arm zeichnet. Das sage ich auch sinngemäß im Podcast: Mir ist zum ersten Mal klargeworden, dass ich, solange es Kunst ist, also „Fake“ (vorsichtig formuliert), ein Abbild, ein Foto, ein Gemälde, so ziemlich alles anschauen kann. Sobald ich aber weiß, etwas ist echt, kann oder will ich es nicht mehr sehen. Die innere Schublade „Kunst“ lässt mich vieles ertragen, was die Schublade „Da hat jemand wirklich Schmerzen, da ist jemand gestorben, da geschieht etwas Fürchterliches“ nicht aushaltbar macht.
Das passt dann auch zur nächsten Erkenntnis: meine eigene Schwelle zum Nichtwissenwollen. Man wird gleich am Eingang darauf hingewiesen, dass im allerletzten Raum ein Film läuft, der eine Sektion zeigt. Und ich noch so innerlich, haha, ich gucke seit 15 Staffeln Grey’s Anatomy, ich kann Blut und Innereien total ab, da bin ich ja gespannt, das möchte ich gerne mal sehen. Um die Pointe vorwegzunehmen: Ich habe es keine Minute ausgehalten. Da war auf einmal der Wunsch sehr groß, nicht darüber nachdenken zu müssen, dass wir eben nicht nur aus lächerlich fragilen Knochen bestehen, sondern auch aus Sehnen und Muskeln und Fleisch und Fett, das einem Skalpell so gar nichts entgegenzusetzen hat.
Ich mochte sehr viele Stücke in der Ausstellung gern, viele haben mich zum Nachdenken gebracht, aber mit dieser inneren philosophischen Diskussion über meine Körperlichkeit und wie viel – oder wie wenig? – sie zu meiner Persönlichkeit beiträgt, hätte ich nicht gerechnet.
01.38:50. Fazit der zweiten Ausstellung: Auch den anderen hat es sehr gefallen, auch wenn die Herren nicht ganz so deprimiert aus ihr herauskamen.

01.40:40. Wir lösen die Weine auf. Uns haben alle geschmeckt, auch wenn gerade ich, ähem, am Anfang arg gemeckert habe. Ganz klar vorne war der dritte Wein, dann der zweite, und selbst der letzte Platz ist keiner, weil auch der uns sehr gut gefallen hat.
Wein 1: Johannes Zillinger, Revolution – White Solera, ohne Jahrgang, Cuvée aus Chardonnay, Riesling und Scheurebe, 12,5%, für 12,90 Euro gekauft bei der charmanten Neuentdeckung 225 Liter, Nähe Rosenheimer Platz.
Wein 2: Eschenhof Holzer, Invader (2017), Müller-Thurgau, 12,5%, für 12,90 gekauft bei 8 Green Bottles.
Wein 3: Dario Princic, bianco trebez (2009), Cuvée aus Chardonnay, Sauvignon blanc und Pinot Grigio, 14%, für 29,90 gekauft bei orange-wines.com.