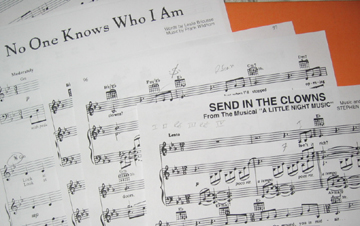Der Untergang
Der Untergang (D 2004)
Darsteller: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Thomas Kretschmann, Matthias Habich, Heino Ferch, Christian Berkl, Ulrich Noethen, Michael Mendel, Christian Redl, André Hennicke
Musik: Stephan Zacharias
Kamera: Rainer Klausmann
Drehbuch: Bernd Eichinger
Regie: Oliver Hirschbiegel
Ja, der Film ist historisch korrekt, ja, die gesamte erste Liga der deutschen Schauspielkunst ist hier versammelt und macht ihre Sache sehr gut, ja, der Film ist handwerklich makellos und optisch eindrucksvoll, ja, mag alles sein, klingt alles toll, aber was ich mich zweieinhalb lange Stunden im Kino gefragt habe, ist: Was soll mir dieser Film eigentlich sagen?
Der Untergang beschreibt die letzten Tage im Führerbunker und in den Straßen Berlins, April/Mai 1945. Wir erleben die Geschichte aus der Perspektive von Traudl Junge, der Sekretärin Hitlers, die auch als einzige reale Person die ersten und die letzten Worte im Film spricht. Sie ist beschämt darüber, dass sie damals so gar keinen Abstand zur Person Hitler gehabt habe, und sie wirft sich vor, nicht mehr gewusst zu haben. Und mit diesen wenigen Sätzen erzählt sie uns, was wir danach in bunten Bildern nochmal erzählt bekommen.
Der Film hat sich auf die Fahnen geschrieben, keine historischen Spekulationen anstellen zu wollen. Deshalb wird zum Beispiel nicht gezeigt, wie Hitler sich und seine Frau umbrachte, denn niemand weiß genau, wie es passiert ist. Worauf der Film stolz ist, ist aber gleichzeitig sein Manko, denn so bleiben alle Charaktere die seltsamen Schablonen, die wir aus den Geschichtsbüchern und den unzähligen Dokumentationen kennen, und denen wir in ihrer hysterischen Anbetung des „Führers“ völlig verständnislos gegenüber stehen. Ich persönlich kann jedenfalls nicht nachvollziehen, wie eine Mutter wie Magda Goebbels ihre eigenen Kinder umbringt, weil sie ihnen eine Zukunft ohne Nationalsozialismus ersparen will. Ich kann es einfach nicht verstehen, und Corinna Harfouch als Magda hat mir diese Frage auch nicht beantworten können. Immerhin hat sie es geschafft, die Figur, denn mehr ist Frau Goebbels in diesem Film nicht, glaubhaft darzustellen. Sie erscheint nicht als Monster, sondern als Frau, die in ihren wahnsinnigen Taten schlicht konsequent ist. Und trotzdem hat mich ihre Geschichte kalt gelassen, weil ich keine zusätzliche, erklärende Facette zu ihrer Person bekommen habe. Und das wäre meiner Meinung nach die Chance des Films gewesen: vielleicht eine Deutung zu versuchen, Szenen zu zeigen, die historisch nicht verbürgt sind, die uns aber das Handeln der Personen ansatzweise erklären könnten. Vielleicht ein bisschen mehr Spielfilm zu sein als Pseudodoku.
Ab und zu versucht der Film, zusätzliche Facetten zu etablieren. Das klappt manchmal, wenn zum Beispiel Traudl mit Eva Braun spricht und sich wundert, dass Hitler mal so menschlich und dann wieder so unmenschlich sein kann. Worauf Eva verständig meint: „Sie meinen, wenn er der Führer ist?“ Ich fand es interessant, die Person Hitler in zwei Persönlichkeiten geteilt zu sehen, wie Eva Braun das vielleicht auch für sich getan hat, um eben den „Führer“ von ihrem Geliebten zu trennen.
Manchmal klappt das Einbringen von Details leider überhaupt nicht. So zum Beispiel, wenn Himmler mit dem Schwager von Eva Braun redet, wobei dieser über Hitler meint: „Was soll man auch von jemandem erwarten, der nicht raucht, nicht trinkt und Vegetarier ist?“ Wow. Diese Information ist nicht nur dermaßen unelegant eingebracht, sie ist dazu auch noch für den Film völlig egal. Hitler hätte auch heimlich Esperanto lernen oder Briefmarken sammeln können – dieser „Fakt“ hätte nichts an der Geschichte geändert. Also was soll dieser alberne Versuch, einen Diktator menschlicher machen zu wollen, indem man ein paar Hintergrundinfos bringt, die über die übliche Wagner-und-Schäferhunde-Schiene hinausgehen?
Ein Freund, mit dem ich zusammen im Kino war, meinte, genau das wäre die Absicht des Films. Er meinte, es sei gut, den Dämon Hitler, dieses unfassbare Gespenst, von seinem Sockel zu holen und ihn menschlich zu machen, denn nur so kann man auf ihm rumtrampeln. Diese Theorie klingt für mich hübsch, nur weiß ich nicht, was es bringen soll. Wozu muss ich das Monster menschlich machen? Damit die Botschaft klar wird: Jeder ist zu solchen Taten fähig? Das habe ich schon vorher geahnt. Und wenn es darum geht, die Faszination Hitlers zu erklären, also zu ergründen, warum so viele Menschen ihm willig in den Krieg und schließlich in den Tod gefolgt sind, dann hat der Film gnadenlos versagt. Der Hitler, der mir in Der Untergang begegnet, ist ein Wurm. Ein sabbernder, von Parkinson gezeichneter, hysterisch keifender Idiot, der schon lange den Bezug zur Realität verloren hat und in einer Minute noch von Germania und dem Großdeutschen Reich träumt, um in der nächsten Minute nur noch „Es ist aus, alles ist aus“ zu stammeln.
Was mir an dem Film dagegen gefallen hat, waren die kleinen Momente, die das Unfassbare meiner Meinung nach besser eingefangen haben als die Schlachten in den Straßen, die Kindersoldaten des Volkssturm und das Hängen von angeblichen Deserteuren. Es waren Szenen wie die, in der Hitler Eva Braun beim Essen nebenbei erklärt, wie man sich am besten erschießt, damit es funktioniert. Oder die Szene, in der Goebbels Traudl bittet, sein Testament zu tippen und sie erwidert: „Aber ich tippe doch gerade das Testament vom Führer.“ Oder die Szene, in der Eva Braun sorgfältig ihre Zigarettenkippe vor dem Eingang zum Führerbunker zertritt, während hinter ihr Berlin bereits in Flammen steht.
Wenn der Film diese kleinen Geschichten oder Bilder nutzt, um den Kontrast zwischen dem Irrsinn über der Erde und dem trotzigen Festhalten am Gestern darunter zu beschreiben, funktioniert er. Leider tut er das nicht oft genug, sondern ergeht sich lieber in minutenlangen Dialogen Hitlers mit seinen Generälen, die immer in Hitlers Gebrüll enden und rehäugigen, verängstigten Blicken von Traudl. Ich habe größten Respekt vor der schauspielerischen Leistung von Bruno Ganz, der das seltsam-lächerliche Gegrolle von Hitler in Alltagssprache übersetzten konnte, ohne albern zu wirken. Meistens jedenfalls. Wenn Hitler der Köchin ein Lob ausspricht, klingt das trotzdem so, als erkläre er ihr gerade den Krieg. Ich weiß nicht, warum alle anderen ganz normal reden dürfen, Ganz aber die affige Intonation Hitlers beibehalten musste. Gerade wenn er mit Albert Speer (Heino Ferch, hochdeutsch) redet, wird der Kontrast sehr deutlich, und da habe ich dann doch ein wenig gekichert anstatt jetzt mit dem „Führer“ zu leiden, der ein Tränchen darüber verdrückt, dass sein Lieblingsarchitekt ihm auch noch untreu wird in den letzten Stunden.
Überhaupt musste ich mich bei einigen Szenen arg zusammenreißen. Zum Beispiel diskutieren in einer Szene einige SS-Offiziere, ob sie sich bei Kriegsende erschießen sollten oder nicht. In diesem Moment überbringt ein Bote die Nachricht der bedingungslosen Kapitulation, und noch bevor er seinen Satz zuende gebracht hat, knallen schon die ersten Schüsse, die von lethalen Schädelverletzungen künden. Oder die Szene, in der Soldaten die Leichen des Ehepaars Hitler mit Benzin übergießen und anzünden und dann neben den Flammen hitlergrüßend stramm stehen; ich musste an die gleiche Szene in Schtonk! denken, in der keine Flammen auflodern und ein Soldat ebenso stramm stehend seinem Vorgesetzten meldet: „Der Führer brennt nicht.“
Dass meine Gedanken nicht ganz beim dramatischen Geschehen auf der Leinwand waren, liegt eben daran, dass mich diese Dramatik nicht erwischt hat. Der Untergang fühlt sich an wie ein verfilmtes Geschichtsbuch: brav und ordentlich und ein bisschen langweilig. Ich persönlich habe jedenfalls nichts erfahren, was ich nicht auch schon vorher wusste. Gut, vielleicht wusste ich vorher nicht, dass das letzte Essen von Hitler anscheinend Nudeln waren, aber bis jetzt konnte ich auch ohne diese Information ganz gut leben. Ich weiß einfach nicht, warum dieser Film gemacht wurde. Ich fand ihn sehr lang, teilweise sehr bemüht, bloß nichts Falsches zu sagen, und im Endeffekt habe ich nichts aus dem Film mitgenommen. Höchstens den Wunsch, nochmal Schtonk! zu gucken.