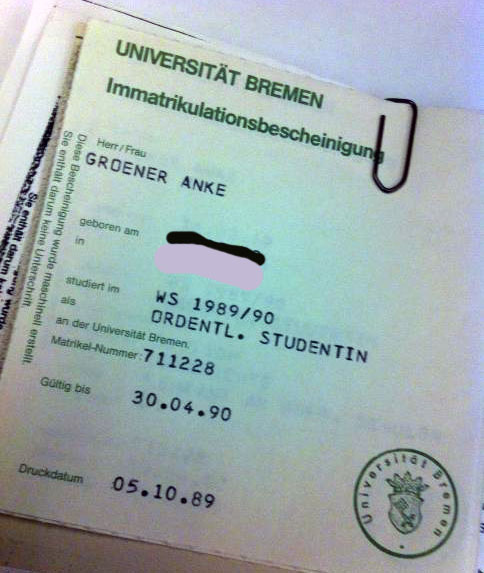Bücher im September 2012

Jürgen Trimborn – Ein Tag ist ein Jahr ist ein Leben
Biografie über Rainer Werner Fassbinder. Praktisch für mich, die noch nicht so viele Filme von Fassbinder gesehen hat: Jeder einzelne wird kompakt nacherzählt. Damit ist auch schon ein Großteil des Buchs rum, denn der gute Mann hat in 13 Jahren satte 40 Filme gedreht. Die Biografie liest sich so, als wäre dazwischen nicht so irre viel Zeit gewesen, weswegen die persönlichen Verhältnisse fast ein bisschen zu knapp wegkommen. Aber nur fast; die Grundhaltung Fassbinders zu seinem Leben und dem anderer wird deutlich genug. Seine ungezügelte Kreativität, seine Besessenheit, möglichst alles im ersten Take hinzukriegen, seine Themenauswahl, die so deutsch ist wie keine andere. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, auch wenn ich die Sprache manchmal ein bisschen zu spröde fand für eine derartig schillernde Figur. Und es hat große Lust darauf gemacht, jetzt mal endlich die Fassbinder-Bibliothek durchzugucken.
Rona Jaffe (Susanne Höbel, Übers.) – Das Beste von allem
Das Buch wird mit einem Sticker auf dem Titelbild beworben: „Bekannt aus ‘Mad Men’. Don Drapers Bettlektüre“, worüber ich natürlich erstmal innerlich ablästerte. Anfangs fand ich es dann auch schräg, mich mit jungen Frauen in den 50er Jahren in New York und ihren ersten Schritten im Berufsleben zu befassen, aber unmerklich wuchsen mir die Damen ans Herz. Dazu trug sicher auch die schöne (neue) Übersetzung bei, die das 60 Jahre alte Buch sehr modern wirken lässt, ohne den Zeitkolorit völlig zu verleugnen. Natürlich stolperte ich über einige Dinge wie die brav ertragenen sexuellen Belästigungen von älteren Kollegen oder die Fixierung auf „Ich muss nicht lange arbeiten, nur bis ich einen Ehemann gefunden habe“, aber mit ein paar Folgen „Mad Men“ im Hinterkopf passt das schon alles. Ich bin wirklich selbst erstaunt darüber, dass mir das Buch gefallen hat, aber ja. Hat es. Sehr sogar.
(Leseprobe bei amazon.de.)
Martin Suter – Die dunkle Seite des Mondes
Herr Suter wurde mir von mehreren Kolleg_innen unabhängig voneinander empfohlen, und wer wäre ich, nicht auf meine schlauen Umgebungsmenschen zu hören. In Mondes geht es um einen Anwalt (schnarch), der sich eine junge Geliebte zulegt (schnarch) und mir ihr einen Pilztrip macht (äh … okay … weniger schnarch). Danach ist wenig wie zuvor, jedenfalls in seinem Kopf, und er tut Dinge, die er früher wahrscheinlich nicht getan hätte. Ab da wurde es für mich wieder schnarch; es treten nur Kerle auf bis auf die Exfreundin, die Geliebte und die Sekretärin (!), ansonsten gibt’s Testosteron und Kram, das man klischeeig mit Testosteron verbindet, im Überfluss (Jagden, große Anwaltskanzleien, harte Drinks, Rachegelüste, schnelle Autosssszzzz), und deswegen fand ich das Buch auch eher belanglos. Es war allerdings wirklich spannend geschrieben, und daher kriegt Herr Suter noch eine Chance.
(Leseprobe bei amazon.de.)
Arne Karsten – Bernini: Der Schöpfer des barocken Rom
Karsten ist studierter Kunstgeschichtler und Historiker und das merkt man dem Buch auch an. Als Biografie halte ich Bernini für grandios gescheitert, als Werk über das Papsttum, den Nepotismus, die Stadt Rom und ihre Bürger_innen im 17. Jahrhundert und als gute Unterhaltung für hervorragend gelungen. Über Bernini weiß ich kaum mehr als vorher, außer dass er vielleicht nicht gerade ein netter Mensch war. Dafür weiß ich jetzt, dass jeder neue Papst Rom und den Vatikan erst einmal in brachiale Unkosten stürzte, weil die Neuen sich künstlerisch verewigen lassen wollten und, ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe, sich um ihre Verwandten kümmerten, indem sie ihnen Posten und Pöstchen zuschoben, ganz gleich ob diejenigen dafür geeignet waren. Außerdem weiß ich jetzt mehr über die Verwaltung von Rom und Italien und die politische Grundhaltung sowie die Macht (oder den Mangel derselben) des Vatikans und dass Mussolini mit seinen Umbauten vor den Kolonnaden des Petersdom dessen Wirkung ziemlich ruinierte.
Zusätzlich hat mir Karsten einige ausgewählte Bauwerke oder Skulpturen Berninis mit klugen Beschreibungen und Interpretationen nähergebracht, und an viele von ihnen kann ich mich von meinem bisher einzigen Rombesuch erinnern, was aber nicht nötig ist, um sich von ihnen begeistern zu lassen. Der Haupteindruck, der mir geblieben ist: dass Bernini das Gesicht Roms entscheidend mitgestaltet hat und dass man dieses Gesicht noch heute sehen kann. Ich habe das Buch verschlungen, auch weil es sehr nahbar und komplett unwissenschaftlich geschrieben wurde, ohne mich aber für doof zu verkaufen. Wie gesagt: Eine gute Biografie ist es nicht. Aber ein wundervolles Buch.
(Leseprobe bei C.H. Beck.)
Markus Kavka – Rottenegg
Hm. Ich mag den Kavka ja. Ich mochte seinen Musikgeschmack zwar eher selten, aber ich hab trotzdem Viva Zwei geguckt, weil ich ihn halt mochte, ihn und seine lakonische Sprache, immer dieses halbe Grinsen im Gesicht, bei dem man nie wusste, ob er jetzt meinte, was er sagte oder nicht. Guter Mann. So ähnlich klingt Rottenegg, aber leider nicht ganz. Die Geschichte des Berliner VJs, der gefeuert wird und seine Freundin mit jemand anderem im Bett erwischt und sich daraufhin zum Wundenlecken ins oberbayerische Elternhaus zurückzieht, ist charmant und freundlich und der Kontrast zwischen dem Dauergekokse und der putzigen Ingolstädter Gesellschaft funktioniert. Aber dann passiert etwas, das mir persönlich einen Tick zu dick aufgetragen war. Auf einmal war klar, der Mann meint das doch ernst, und in dem Moment hätte ich gerne wieder das halbe Grinsen gehabt. Deswegen kriegt Rottenegg ein paar Sympathiepunkte, aber so richtig glücklich hat mich das Buch nicht zurückgelassen. (Ich würde aber trotzdem gerne ein weiteres Buch vom Kavka lesen wollen.)
(Leseprobe bei rowohlt.de.)
Martin Suter – Der Koch
Das war die zweite Chance für Herrn Suter, und so richtig genutzt hat er sie nicht. Im Koch geht es um einen Tamilen in der Schweiz, der als Spülhilfe arbeitet, aber hervorragend kochen kann. Eines Abends zaubert er seiner charmanten Restaurantkollegin ein erotisches Menü, woraufhin sie das Ganze sofort als Supergeschäft für Sextherapeut_innen anbietet. Schöne Idee, ein paar Restaurantgäste kommen auch noch vor, die tamilischen Freiheitskämpfer und ein paar weitere Menschen; ich hab alles brav gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, aber eigentlich war es mir genauso egal wie der pilzefressende Anwalt. Die Figuren hatten für mich alle eine halbgare Backstory und ein paar Adjektive, die sie grob skizzierten, aber keine Seele. Ich werde mit dem Suter nicht so recht warm, das ist mir alles zu knapp und huschhusch und schnell auf Pointe. Aber als Film sind seine Geschichten bestimmt toll.
(Leseprobe bei amazon.de.)
Hans Fallada – Jeder stirbt für sich allein
Ein großartiges Buch – und eins, das überhaupt keinen Spaß macht. Wäre auch etwas viel verlangt bei der Story: Ein älteres Ehepaar in Berlin erfährt, dass ihr Sohn gefallen ist. Aus Schmerz, Protest und dem Willen, menschlich zu bleiben, schreiben sie von 1940 bis 1942 Postkarten mit Botschaften gegen das Hitlerregime, die sie auslegen. Damit hoffen sie, eine Welle von Nachahmern zu schaffen, die sich ebenfalls gegen den Staat und seine Führung wenden. Im Buch treffen wir auch das verzweigte Umfeld des Paares, ihre Schwiegertochter, die nun keine mehr ist, ihre Nachbarn, Menschen, die die Karten finden, die Gestapo und die Menschen im Gefängnis und am Volksgerichtshof. Was jetzt kein Spoiler ist, denn der Tonfall macht recht schnell klar, dass dieses Buch kein gutes Ende haben wird. Ich kann nicht behaupten, dass es mir gefallen hat, denn dazu war es zu schmerzhaft; Fallada schrieb es bereits 1947, die Erinnerungen an die Nazizeit waren noch sehr frisch, und so liest es sich auch: sehr beklemmend, sehr klaustrophobisch, über allem und jedem schwebt die Angst, die in jeder Zeile fast körperlich spürbar ist. Gleichzeitig setzt das Buch den „kleinen Leuten“ Berlins ein Denkmal; die Sprache ist sehr oft wunderbarer Dialekt, den ich ein bisschen entziffern musste. Und ich habe festgestellt, dass ich in der Zeit, in der ich in Berlin gebucht war, in der Straße gewohnt habe, in der das literarische Paar lebte: die Jablonskistraße im Prenzlauer Berg. Ts.
Die Geschichte beruht auf dem wahren Fall des Ehepaars Hampel, die beide hingerichtet wurden.
(Leseprobe bei amazon.de.)
Stephan Thome – Fliehkräfte
Seit ich Thomes Grenzgang gelesen hatte, wartete ich auf sein neues Buch. Zu recht, denn Fliehkräfte hat mir noch besser gefallen als sein Erstling. Dieses Mal geht es um einen Universitätsprofessor, der nach 20 Jahren Ehe und mit einer erwachsenen Tochter über einen beruflichen Neuanfang nachdenkt. Das könnte auch daran liegen, dass er inzwischen alleine im Familienhaus sitzt, seine Frau wochenweise in Berlin arbeitet und Theater macht, seine Tochter in Portugal studiert und er selbst nicht so recht weiß, ob er die Familie überhaupt noch zusammenhalten kann oder will oder sich gerade alles auflöst. Auch hier hat mich die Sprache Thomes wieder begeistert; sie seziert, sie ist intim und gleichzeitig entwirft sie große Gedanken, die Dialoge – gerade zwischen den Eheleuten, die müde streiten und gar nicht streiten wollen – waren perfekt formuliert, voller Schmerz und Hoffnung und nie gleichgültig. Das Ende zieht sich für mich ein bisschen sehr, da hatte ich auf einmal das Gefühl, hier sollten noch ein paar Gedankensplitter aus dem Exposé untergebracht werden, aber die verlangsamten die Geschichte eher als dass sie ihr eine neue Tiefe gaben. Das verzeihe ich dem Buch aber gerne, auch weil es trotz einer klaren Hauptfigur niemals Partei für sie ergreift. Jede Stimme ist wichtig und wird gehört, und ich habe jede Stimme gerne gehört.
(Leseprobe bei amazon.de.)
Brigitte Hamann – Kronprinz Rudolf: Ein Leben
Sehr ausführliche Biografie über Sissis Sohnemann, der sich 1889 das Leben nahm. Traut man dem schmalen Buch gar nicht zu, was alles in ihm steckt, aber wir lesen über Rudolfs politische Einstellungen, Hoffnungen und Ideen sehr viel im O-Ton, denn Hamann zitiert gerne seitenlang aus Briefen und Tagebüchern. Zusätzlich bekommt auch seine intellektuelle Seite genug Raum, seine naturwissenschaftliche Neugier, seine Faszination mit der Ornithologie. Weswegen ich das Buch überhaupt gelesen habe: Mir ist erst mit der Wilhelm-II-Biografie aufgefallen, dass die beiden Herren, die die Geschicke von Deutschland prägten und die von Österreich prägen sollten, fast gleichaltrig waren (Rudolf wurde im August 1858, Wilhelm im Januar 1859 geboren). Die beiden waren sich zu Lebzeiten spinnefeind, weil Wilhelm mit Rudolf und dessen liberalen Ideen genauso wenig etwas anfangen konnte wie Rudolf mit Wilhelms Nationalismus, Antisemitismus und Tschingderassabumm. Im Nachhinein ist es sehr bedrückend, wenn man sich ausmalt, was passiert wäre, wenn Rudolf eine Chance gehabt hätte, Österreich zu führen und Wilhelms Vater, der nur wenige Monate regierte, bevor er an Krebs starb, das Deutsche Reich mit seinen liberalen Ideen hätte bewegen können.
(Alle Links, die zu amazon.de führen, sind Affiliate Links.)