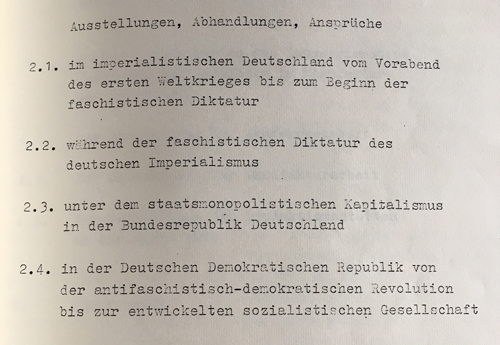Links von Dienstag, 12. Dezember 2017
Ich kann nicht mehr für mich garantieren
Die FAZ weist auf die neu erschienene Gesamtausgabe von Irmgard Keun hin, die mit 39 Euro sehr erschwinglich ist. Ich kenne von Keun nur Gilgi und Das kunstseidene Mädchen (1931 bzw. 1932), die auch im Artikel erwähnt werden, aber dass sie 1937 im Exil noch einen Roman herausbrachte, wusste ich zum Beispiel nicht. Ich mochte an den beiden Büchern, dass sie meine Vorstellung des Frauenbildes in der Weimarer Republik sehr erweitern konnten. Ja, Romane sind keine Geschichtsbücher, das weiß ich auch, aber ich fand sie doch sehr aufschlussreich und lesenswert.
„Im Sommer 1932 gehörte „Das kunstseidene Mädchen“ neben Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ zu den Bestsellern des deutschen Buchhandels, Anfang Oktober kam „Eine von uns“ mit dem Ufa-Star Brigitte Helm als Gilgi in die Kinos. Danach wurde es dunkel über dem Land. Junge Frauen in scharf taillierten Trenchcoats mit schiefsitzender kleiner Baskenmütze, womöglich rauchend, waren jetzt nicht mehr gern gesehen. Irmgard Keun, weder jüdisch noch politisch engagiert – an dem bisschen Sozialkritik in ihren Romanen konnte nun wirklich niemand Anstoß nehmen –, hatte nach Meinung der neuen Machthaber einfach nur das falsche Frauenbild. Undeutsch wurde das genannt, fiel unter die sogenannte „Asphaltliteratur“ und landete im Mai 1933 auf den Scheiterhaufen, auf denen die Bücher brannten.“
—
Eine Kurzgeschichte im New Yorker. Ich wurde Freitag am späten Abend durch einen Tweet von Emily Nussbaum, der Filmkritikerin des New Yorker, deren Tweets ich sehr schätze, auf sie aufmerksam gemacht. Ich las sie gerne und schnell durch, fand sie sehr gut, retweete sie aber nicht, weil ich dachte, ach, Freitagnacht liest das eh keiner mehr, mach ich morgen. Das vergaß ich natürlich und hole es hiermit auch. Auch weil ich anscheinend nicht die einzige war, die die Geschichte mochte. Oder auch nicht, wie dieses kurze Interview mit der Autorin Kristen Roupenian zeigt, aus dem ich einen Ausschnitt zitiere. Aus der Story möchte ich keinen Ausschnitt zitieren, die solltet ihr ganz lesen.
„When a short story makes a splash these days, you can see the ripples in real time.
The writer Kristen Roupenian had fewer than 200 followers on Twitter before her work of fiction, “Cat Person,” was published in The New Yorker last week. The piece dominated attention on social media in a way that fiction rarely does. On Sunday, Ms. Roupenian’s follower count climbed rapidly as her more eager readers finished the story and set out to find its creator.
“Cat Person” focuses on two characters, Margot and Robert, who begin to construct a relationship through texting and eventually go on something resembling a date. The verisimilitude of their encounter started conversations about dating, power and consent. (There has also been a backlash and a backlash to the backlash.)“
In diesem Zusammenhang noch ein Essay von Ella Dawson, auf den Roupenian selbst per Tweet verlinkte:
„I want to talk about bad sex for a minute.
I don’t mean “bad sex” as in sex that wasn’t pleasurable, or sex that was awkward, or sex that hurt. I don’t mean when you’re having sex with a new partner and you don’t know yet what the other person likes or craves or is viscerally annoyed by. I don’t mean when you lose your hard-on or aren’t wet enough or the cat is watching you and it’s super distracting. I don’t even mean sex that disappoints you so much that you don’t see the person again.
By “bad sex,” I mean the sex we have that we don’t want to have but consent to anyway.
Let me be clear: bad sex isn’t rape. It’s not being forced to do something against your will. I don’t want to feed into that whole “false rape accusation, saying you were raped when you really just regret the night before” bullshit narrative that conservatives and Men’s Rights Activists and Betsy Devos like to pretend happens all the time. Bad sex isn’t even necessarily coercive. I’m talking about having a sexual encounter you don’t want to have because in the moment it seems easier to get it over with than it would be to extricate yourself.“
—
So viele Umwege auf dem Weg eines Herzens
Nochmal die FAZ, dieses Mal mit einer Filmkritik von Andreas Kilb, die dafür gesorgt hat, dass ich den Film Die Lebenden reparieren von Katell Quillévéré sehen will (well done, möchte ich sagen). Nebenbei habe ich in dieser Kritik ein wunderbares Zitat der Kritikerin Frieda Grafe gefunden, die als Gesetz des Genres Melodrama festgelegt hatte: Entweder man heult oder man kotzt.
„Wenn man in einer einzigen Szene zeigen müsste, was es heißt, jung zu sein, könnte sie nicht schöner sein als die Einstellung, mit der Katell Quillévérés Film „Die Lebenden reparieren“ beginnt: Ein Junge, Simon, steigt aus dem Bett, fotografiert seine schlafende Freundin, springt lautlos aus dem Fenster auf die Straße, steigt auf sein Rennrad und rast durch die schlafende Stadt zum Hafen, wo ihn zwei Freunde mit einem Lieferwagen aufsammeln. Im Morgengrauen, am Strand, paddeln die drei mit ihren Surfbrettern in die Brandung, warten auf die passende Welle, schwingen sich auf ihr Brett und rasen durch den Tunnel aus stürzendem Wasser ins Licht, atemlos, immer wieder. So beginnt Simons Tag. Es ist sein letzter.“