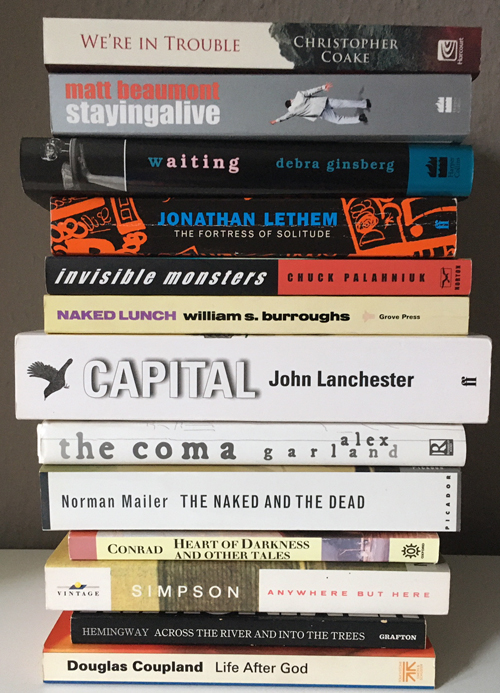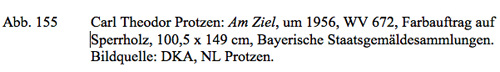Was schön war, Freitag/Samstag, 29./30. Mai 2020 – Duft und Klang
Den Freitag nur halbherzig an der Diss gearbeitet, irgendwie mehr Lust auf Kochen gehabt und das dann umgesetzt. Ich probierte das Rezept für Dan-Dan-Nudeln aus und schon der erste Zubereitungsschritt hat mich deutlich glücklicher gemacht, als Unterpunkte im Inhaltsverzeichnis zu korrigieren. Für das Gericht braucht man erstmal ein Chili-Öl, dazu wirft man eine Zimtstange, ein paar Sternanis, zwei Lorbeerblätter und ein paar Szechuanpfefferkörner in Öl und kocht alles auf, bis es duftet. Und so hing ich zehn Minuten über dem Herd und schnupperte, was mir ganz simpel Freude bereitete. Danach gießt man das aromatisierte Öl über Chilipulver und -flocken und das duftet dann auch, auch wenn ich bei Chili immer noch den Atem anhalte weil scharf und ich Memme.
Dann duftete auch noch die Sesamsauce, die ich herstellte, und als ich das ganze einen Tag später für F. und mich zum späten Frühstück erneut zubereitete, weil ich zuviel Nudelteig gemacht hatte, briet ich Schweinehack an und verfeinerte es mit Soja- und Hoisinsauce und auch das roch einfach gut.
Gestern duftete dann mein Darjeeling, der Wochenendtee statt des Ostfriesentees an Werktagen, und mein Kühlschrank riecht gerade nach Erdbeeren, und weil mein Basilikum und mein Thymian auf dem Balkon blühen, musste ich da auch meine Nase reinhalten und überhaupt duftet gerade alles und es ist herrlich.
—
Gestern verbrachte ich den halben Tag damit, Igor Levit bei seinem Mammutprojekt zuzuschauen und zuzuhören: 840 Mal hintereinander Eric Saties Vexation zu spielen. 20 Stunden waren dafür vorgesehen, der Mann erledigte das in fünfzehneinhalb. Er begann um 14 Uhr damit, sich an den Flügel zu setzen, vor ihm ein Riesenstapel Notenblätter, von denen er sich einen kleineren Packen auf den Notenständer legte, um dann Blatt für Blatt abzuspielen und diese danach auf den Fußboden zu werfen, zu legen, fallenzulassen. Die Blätter werden versteigert, der Erlös geht Kulturschaffenden zu. Dafür war die ganze Aktion überhaupt: um auf die derzeitige Situation von Künstler*innen hinzuweisen und sie zu unterstützen.
Ich habe nicht die ganzen 15 Stunden gesehen, zwischendurch musste ich mich über Augsburg aufregen, dann erwischte mich ein Nickerchen, schlimm, und ein, zwei Serienfolgen mussten auch geschaut werden. Aber ansonsten lief der Stream, bis ich nach Mitternacht ins Bett ging. Ich las nebenbei, kochte, wusch ab, aber meistens schaute ich Levit einfach zu und fand es unerwartet auf- und anregend.
Der Kopf konnte sich nicht ganz verselbständigen, obwohl die hypnotische Musik sich irgendwann so ins Gehirn gefräst hatte, dass ich sie immer noch höre, aber die Kameraführung ließ einen selten wirklich in Ruhe. Und ich fand das nicht schlimm, im Gegenteil, ich war fasziniert davon, wieviele Blicke auf einen Mann in einem Raum, in dem ein Flügel steht, möglich waren, ohne dass es langweilig wurde. Es fiel mir wirklich schwer, den Stream schließlich zu beenden und schlafen zu gehen und Levit gefühlt alleine zu lassen. Um 2 Uhr wurde ich davon wach, dass irgendein Witzbold an meiner Tür klingelte, woraufhin ich nochmal bis 3 Uhr Levit zuschaute, dieses Mal auf dem Handy im Bett.
Holger Schulze hörte fast komplett zu, bis auf die letzten Stunden, und twitterte. Diese Sätze fand ich besonders schön: „Die Musik erfüllte tatsächlich unser Haus als Möbelmusik, als die berühmte “musique d’ameublement”, von der ihr Komponist stets geträumt hatte. / Das offene, driftende tonale Zentrum dieses Stückes – das alles andere als atonal ist, wie es dennoch manchmal heisst – trug dazu bei. Es prädeterminierte nicht die Raum- oder Situationswahrnehmung durch fixe Akkordschritte und Motivarbeit. / Es legte sich tatsächlich als zarter Nebel, als sanfter Filter, als begleitender Duft über diesen Spätnachmittag, durch die Zimmer unseres bescheidenen Hauses.“
Auch Ines Häufler hörte länger zu: „Am Anfang dachte ich übrigens „Come on, was hat die arbeitslose freie Orchestermusikerin davon, dass du dich 20 Stunden quälst?“, denn es geht ja darum, auf die verzweifelte Situation der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Aber jetzt kommt mir vor: Das Stück ist perfekt. / Also auf der künstlerischen Ebene, finde ich. Die endlose Wiederholung, die aus sich heraus zu nichts zu führen scheint. Die Töne, die zwischen Hoffnung/Harmonie und Verzweiflung/Dissonanzen wechseln. Die Mühe, die Töne immer wieder aufs Neue aus dem Instrument herauszuholen.“
Das fiel mir auch auf: dass das immer gleiche Stück eben nicht immer gleich klingt. Die Unterschiede in der Lautstärke waren wahrzunehmen, ich ahne auch, dass das Tempo nicht immer dasselbe war. Die letzten Minuten schaute ich mir nochmal im Stream an, und da wurde Levit sehr leise und sehr langsam anstatt das Ding einfach runterzubrettern, um endlich, endlich fertigzuwerden.
Dafür, dass wir im Moment nicht in Konzerte kommen, kriege ich doch ganz schön viel Kultur mit und damit die Gelegenheit, mich mit mir selbst und meiner Wahrnehmung von irgendetwas auseinanderzusetzen. Danke dafür.