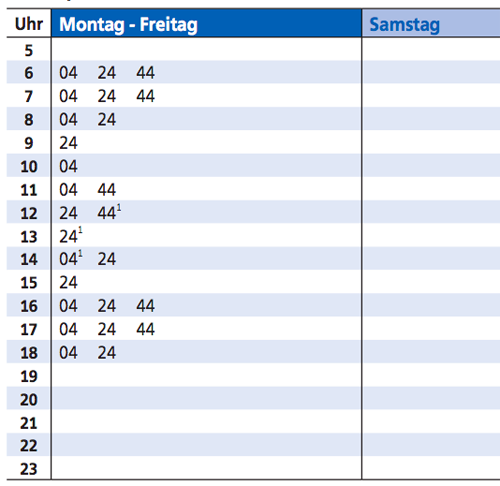Nach den ein, zwei langen Wien-Einträgen hatte ich keine Lust mehr auf den dritten, der ebenfalls so lang geworden wäre, weswegen euch leider die schöne, zweistündige Diskussion im Burgtheater entgangen ist, falls ihr vorletzte Woche nicht schon meinem Link auf Twitter gefolgt seid. Die Veranstaltung „Aufbruch in die Zukunft. 1918 und heute – Matinee zum Ende des Ersten Weltkriegs und zur Ausrufung der Republik“ wurde nämlich live auf Ö1 übertragen und ließ sich auch eine Woche lang nachhören. Jetzt ist der Link leider tot.
Ich fand es sehr spannend, das Ende des Weltkriegs aus österreichischer Perspektive besprochen zu hören. Zum einen musste ich danach erstmal Daten googeln, weil ständig vom 26. Oktober als Feiertag gesprochen wurde und ich schlicht nicht wusste, was da passiert war. (Jetzt weiß ich’s.) Peinlicherweise wusste ich nicht, dass auch Österreich von den Alliierten besetzt war, genau wie Deutschland. Überhaupt weiß ich viel zu wenig über unser Nachbarland, weswegen ich das Buch von Philipp Blom ja so spannend fand. Ich weiß, ich verlinke neuerdings dauernd zu meinem Blogeintrag zum Buch, aber das lohnt sich wirklich; hier halt der Absatz über Österreich bzw. das letzte eingerückte Zitat, in dem beschrieben wird, wie aus dem Riesenreich Österreich-Ungarn das kleine Ding wird, was es heute noch ist und was es vorher nie war. Während der Veranstaltung fiel die Bemerkung, dass für die 1918 ausgerufene Republik 22 Dynastien auf ihre Kronen verzichteten. Das ist doch mal schöner Partysmalltalk.
Zum anderen habe ich von dieser Veranstaltung außer dem gesprochenen Ohrwurm „Hoch die Republik“ noch die Würdigung der unglücklicherweise so bezeichneten Zwischenkriegszeit mitgenommen. So geht es mir selbst auch, vor allem im Hinblick auf meine Diss: Für mich sind die 20er Jahre nur ein Zwischenspiel oder eine böse Ouvertüre zum noch böseren Stück. Ich vergesse selbst gerne, wie unglaublich revolutionär (im wahrsten Sinne des Wortes) diese Zeit gewesen ist und welche Umwälzungen in sehr kurzer Zeit passierten. Errungenschaften wie die erste Republik (Volksgewalt statt Monarchie, kein Gott mehr in der Verfassung), die erste Demokratie auf deutschem Boden, das Frauenwahlrecht etc. werden auch in meinen inneren Zeitläuften verdrängt von Inflation, Wirtschaftskrise und drohendem Nationalsozialismus. Gleichzeitig ist mir bewusst, warum die 20er auch die Goldenen Zwanziger genannt werden: neue Musik, Film als Massenmedium, Bauhaus-Architektur, mehr Freizügigkeit, der Bubikopf (um mal ein Beispiel der neuen Mode zu nennen). Ich fand es spannend, diese Zeit gewürdigt zu sehen und versuche mich seitdem selbst immer wieder daran zu erinnern.
Die Diskussion drehte sich dann auch um die heutige Zeit; es wurde gefragt, warum nicht wieder der 12. November gefeiert werde, an dem 1918 die erste Republik Österreich ausgerufen wurde. Es wurde mehr Verfassungspatriotismus gefordert, mehr Stolz auf demokratische Errungenschaften und mehr Ächtung von Antidemokraten, von denen Österreich leider auch genug hat (der Seitenhieb auf die AfD blieb nicht aus). Es wurde auch betont, dass manche Dinge schlicht nicht verhandelbar seien (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Individualrechte, die Versorgung Schwächerer), weswegen es auch nichts bringe, mit Rechten zu reden, die genau diese Dinge verhandeln wollten. Großer Applaus, auch von mir.
Neben der Diskussion gab es Ausschnitte aus Texten, die von Schauspieler*innen des Burgtheaters gelesen wurden. Einen der Herren sahen wir abends übrigens in der spannenden Inszenierung von Glaube Liebe Hoffnung von Ödön von Horváth wieder, und seitdem wir Karten für dieses Stück hatten, erzählte mir F. von einem dreiminütigen Ausschnitt aus einem alten Programm von Josef Hader, der in Paris den Ast trifft, der 1938 Horváth erschlagen hatte.
—
Einige der Texte las ich gestern in der Stabi nach. Besonders beeindruckt hatte mich K. u. K. Geflüster von Andrzej Stasiuk, eine Rede, die der Verfasser am Burgtheater 2008 (?) gehalten hatte und die in Lettre abgedruckt ist (leider online nicht vollständig). Das Magazin gibt es seltsamerweise auch in Unibibliotheken nicht online, weswegen ich gestern mit dem dicken Jahresband im Lesesaal saß. Der Erzähler besucht an Allerheiligen einen Friedhof, auf dem Gefallene des Ersten Weltkriegs liegen, die miteinander sprechen. Ich hatte mir von der Lesung den Begriff der „mineralischen Knochen“ gemerkt, die der Regen zerfrisst, genau wie „die Reste von Metall, die Schnallen, die Knöpfe mit den Regimentsnummern, die Plomben in den Zähnen, die Nägel in den Stiefeln. Wenn sie in Stiefeln bestattet wurden. Da bin ich nicht sicher.“
„„Wer spricht?“
„Der Gemeine Jussuf Kusturic, 4. Bosnisch-Herzegowinisches Infanterieregiment, Friedhof in Przyslup. Sammelgrab, das erste links vom Eingang.“
„Wann bist du gefallen?“
„Am 2. Mai in der Früh’. Am ersten Tag der Schlacht von Gorlice. Ich stieg aus dem Graben und war tot. Ich war aus der Gegend von Mostar. Ich bin hierhergekommen, um zu sterben.“
„Aber du hast vier Monate länger gelebt.“
„Ja. Aber im Mai zu sterben, das tut weh. Ich weiß nicht einmal, was es war. Ich war einfach plötzlich tot. Die Buchen trieben kleine grüne Blätter. Ich lag auf dem Rücken, bis schließlich alles still wurde und erlosch. Im Winter hört man hier keine Geräusche. Dann rufe ich mir in Erinnerung, wie Mostar im Dezember duftete, wie Travnik duftete und Sarajevo. Sie dufteten nach Eichenrauch.“
„Mein Dorf roch nach Kiefern- und Birkenrauch. Der Frost kam im Oktober, tausend Werst östlich von Moskau. Doch der Zar hat’s befohlen, deshalb kam ich hierher, um von einem Mannlicher Kaliber 8 zu sterben.“
„Und unser Kaiser ließ uns rote Feze tragen, darin gingen wir zum Angriff. Wir trugen rote Feze und waren durch die Bäume meilenweit zu erkennen, denn der Kaiser wollte in seinem Reich kaiserliche Türken haben, deshalb liefen wir mit diesem Rot auf den Köpfen herum wie die Hähne, wir brachen aus Mostar, Tuzla und Sarajevo auf, um auf den Hängen von Magura zu fallen. Wir trugen hellblaue Uniformen, und man sah sofort, wer sich in die Hosen geschissen hatte.“
„Süß und ehrenvoll ist es, sich für den Kaiser in die Hosen zu scheißen.“
„Wer spricht denn da?
„Schütze Mendel Brod. 4. Feldschützenbataillon. Friedhof in Magura. Grab 51. Auch am 2. Mai, so wie der muslimische Kollege. Vermutlich ein Schrapnell.“
„Woher?“
„Bircza bei Przemysl.“
„Garnison?“
„Braunau am Inn.“
„Mach keine Witze.“
(Andrzej Stasiuk (Olaf Kühl, Übers.): „K. u. K. Geflüster“, in: Lettre International 88 (2010), S. 94–97, hier S. 94.)
—
Ich hatte mir außerdem das Buch Menschen im Krieg (1918) von Andreas Latzko herauslegen lassen, das in der Stabi nur in alter deutscher Schrift zu finden war; ein Exemplar stammt von der Ordensburg Sonthofen, was mich etwas erstaunte, denn der kurze Ausschnitt, den wir hörten, beschrieb die Heimkehr eines kriegsversehrten Soldaten. Ich las die Geschichte gestern zuende und möchte nun das ganze Buch lesen, worauf ich gestern im Lesesaal aber keine Lust hatte.
Ausgeliehen habe ich mir den Sammelband Hungern – Hamstern – Heimkehren: Erinnerungen an die Jahre 1918 bis 1921 (Inhaltsverzeichnis), aus dem wir einen kleinen Ausschnitt von Lotte Pirker gehört hatten.
—
Mein Nachhauseweg führte mich am Bayerischen Hauptstaatsarchiv vorbei, wo ich ein Plakat für die Ausstellung Getroffen. Gerettet. Gezeichnet – Sanitätswesen im Ersten Weltkrieg sah, die thematisch natürlich hervorragend passte, weswegen ich gleich hineinging. Das könnt ihr auch noch bis zum 30. November tun, und ich empfehle das sehr. Ist nur ein Raum plus ein Vorraum. In dem steht als zentrales Ausstellungsstück ein durchschossener Stahlhelm, was äußerst plakativ klarmacht, worum es geht.
Ich fand es bemerkenswert, wieviele originale Stücke aus der Zeit ausgestellt waren: Verbandsmaterial, medizinisches Werkzeug, wobei mich ein dreistöckiger Koffer mit Operationsbesteck sehr beeindruckte; ein Morphium-Spritzbesteck, dessen Leihgeber „Privatbesitz“ mich auch kurz stutzen ließ – die meisten Stücke kamen aus militärhistorischen oder medizinischen Sammlungen. Wie im verlinkten Flyer zu sehen ist, ging es auch um die Nachkriegszeit und wie mit Versehrten umgegangen wurde. Ich lernte, dass die Deutschen als erste Giftgas einsetzten, dass es Gasmasken für Pferde gab und Hunde zur Rettung von Verwundeten genutzt wurden. Es gab Prothesen zu sehen und zerschossene Knochen, was alles nicht wirklich Spaß macht, aber ich fand es sehr eindringlich, ohne sensationsheischend zu sein.
Und seit den Fotos weiß ich auch, dass die Soldaten in ihren Stiefeln bestattet wurden.