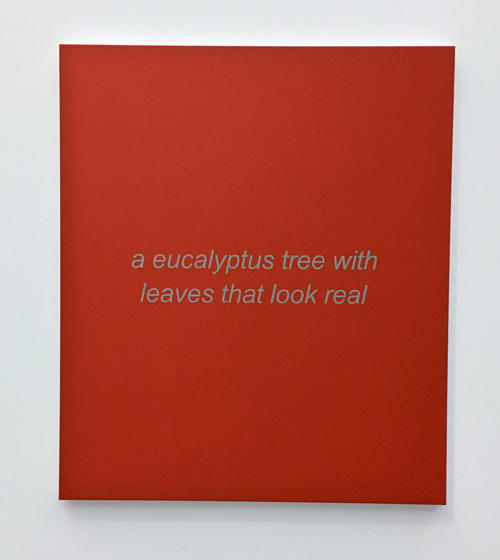Tagebuch Mittwoch, 14. November 2018 – Sachertorte
Nach den langen Nachträgen der letzten beiden Tage, die mich jeweils um die vier Stunden Zeit gekostet haben, gibt’s heute wieder was Kürzeres. Ein dicker Beitrag liegt noch in der Pipeline, die zwei Veranstaltungen am Burgheater müssen natürlich auch schriftlich festgehalten werden. Aber dafür hatte ich gestern keine Zeit, denn ich war den halben Tag lang damit beschäftigt, Sachertorte zu backen. Damn you, Wien-Urlaub!
Die ist noch nicht perfekt, deswegen gibt’s noch kein anständig von mir ausformuliertes Rezept und auch nur das Beweisfoto, das ich gestern abend aus dem Handgelenk für F. gemacht habe. Ich werde die nächste Torte fünf Minuten kürzer im Ofen lassen (ich verhandele immer noch mit meinem neuen Ofen, wann er denn wohl fertig ist im Unterschied zu der Zeitvorgabe in den Rezepten), mehr Aprikosenkonfitüre Marillenmarmelade (danke, @KerstinFest) benutzen und vor allem deutlich dunklere Schokolade für den Überzeug. Das war gestern Zartbitterkuvertüre, aber dadurch, dass man diese noch in einem fiesen Zuckersirup auflöst, wurde sie wieder eher vollmilchig-hell und süß, und ich hätte es gerne etwas herber, weswegen ich über die 85-prozentige Schokolade von Lindt nachdenke. Und natürlich ist der Überzug noch nicht so glatt wie er sein sollte; meine Kuvertüre war beim Drüberkippen vermutlich die gewissen ein bis zwei Grad zu kalt und damit schon ein winziges bisschen zu fest.
Aber der Geschmack war schon verdammt gut! Ich habe, glaube ich, noch nie so dermaßen fluffigen Biskuitteig in die Form gefüllt. Am liebsten hätte ich ihn einfach so gegessen. War fast wie Mousse au Chocolat.

Im Hintergrund steht mein Adventskalender voller Trüffel von Xocolat, auf den ich mich sehr freue. Die Verkäuferin so: „Der ist ohne Alkohol, den kann man also auch an Kinder verschenken.“ Ich so: „Ist für mich.“ Verkäuferin: „Ja, aber wenn Sie ihn verschenken wollten …“ Ich so: „IST FÜR MICH!“ (MEINS! ALLES MEINS!)
Ansonsten war ich gestern bei der Post, um ein Paket abzuholen, das in die Packstation hätte kommen sollen, von wo ich aber nicht mal eine Nachricht bekam, dass es dort nicht ist. Danke, Sendungsverlauf online. Ein weiteres – mit dem Wein für die nächste Fehlfarben-Ausgabe – liegt weiß der Geier wo, wir suchen gerade alle nach ihm. Notfalls bringe ich Samstag eine Flasche Schnaps mit.
—
Lars Fischer schreibt bei Spektrum, warum die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs noch heute die Landschaft so aussehen lässt wie sie eben aussieht. Und vor allem, warum das vermutlich so bleiben wird.
„Die US-Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die großflächigen Bodenveränderungen durch schweren Beschuss ein eigenständiges und in modernen Zeiten sehr verbreitetes Phänomen sei, das erhebliche Auswirkungen auf die Evolution von Böden hat. Sie nennen es Bombturbation.
Eine quasi jungfräuliche Bombturbation-Oberfläche ist sehr uneben und von einer Mischung aus Bodenschutt, zertrümmertem Grundgestein und zerfetzter Vegetation bedeckt, die von den Explosionen aus den Kratern herausgeschleudert wurde. Diese Art von Untergrund unterscheidet sich drastisch vom Zustand vor der Schlacht. Die verschiedenen Sedimentschichten sind gut durchmischt und enthalten oft einen beträchtlichen Anteil an Gesteinstrümmern. Das veränderte Relief sorgt dafür, dass Wasser schwerer abfließt und sich außerdem organische Materie in den Kratersenken ansammelt. Gleichzeitig kann Wasser durch neue Risse tief in das Grundgestein eindringen und beginnen, es zu verwittern. All diese Vorgänge führen dazu, dass auf alten Schlachtfeldern völlig andere Bodentypen entstehen, als es ohne die Schlacht der Fall gewesen wäre.“
(via @odenwaelderin)
Ich vertwitterte den Link gestern zusammen mit einem aus dem Atlantic, auf den Frau Nessy in ihrem Blog aufmerksam gemacht hatte: The Fading Battlefields of World War I. Die Bildunterschrift zu Bild 19 ließ mich kurz innehalten:
„An unexploded World War I shell sits in a field near Auchonvilliers, France, in November of 2013. The iron harvest is the annual “harvest” of unexploded ordnance, barbed wire, shrapnel, bullets, and shells collected by Belgian and French farmers after plowing their fields along the Western Front battlefield sites. It is estimated that, for every square meter of territory on the front from the coast to the Swiss border, a ton of explosives fell. One shell in every four did not detonate and buried itself on impact in the mud. Most of the iron harvest found by farmers in Belgium during the spring-planting and autumn-plowing seasons is collected and carefully placed around field edges, where it is regularly gathered by the Belgian army for disposal by controlled detonation.“
„A ton of explosives“ pro Quadratmeter. Herrgottnochmal. Mich erinnerte das an eine Schilderung von Philipp Blom, die mich in seinem Buch Die zerrissenen Jahre: 1918–1938 so beeindruckt hatte, ich zitiere meinen eigenen Blogeintrag zum Buch. Kann man ja ruhig nochmal wiederholen, jetzt wo viele Europäer*innen anscheinend nicht mehr zu schätzen wissen, wie toll Europa ist.
„Der technologische Fortschritt brachte es mit sich, dass Artilleriegeschütze ihre Geschosse, von denen einige mehr als hundert Kilo wogen, über viele Kilometer zielgenau feuern konnten und so Tod und Verstümmelung in Form von Bomben, Schrapnellen und Gas anonym und gesichtslos in die Schützengräben trugen. Für die Soldaten wurde jede Minute ein zermürbend monotones Warten auf den ferngesteuerten Tod. Auf deutscher Seite, in Schützengräben, die immer wieder den Neid der Soldaten auf der anderen Seite hervorriefen, starben zwei Drittel aller Soldaten durch Bombardierung und nicht bei Angriffen. Bei den britischen und französischen Einheiten waren es sogar drei Viertel.
Im Gegensatz dazu starben nur ein Prozent der Soldaten im Nahkampf mit Handfeuerwaffen und Bajonetten […] Die meisten Soldaten starben, ohne je einen Feind auch nur gesehen zu haben. […]
Die Soldaten auf beiden Seiten erfuhren diese mechanische Apokalypse als einen tiefen Verrat an ihrem Mut und ihrem Opferwillen. Ihr Einsatz, ihr Mut, war nichts im Vergleich zu dem industrialisierten Schlachten im Schlamm, in dem ihre Körper zum Rohstoff des Todes wurden, fast nicht zu unterscheiden von dem allgegenwärtigen graubraunen Dreck, der von Granaten und Bomben so oft aufgerührt und beschossen worden war, dass er sich in Schleim verwandelt hatte, der nach Verwesung und Exkrementen roch und Stiefel und sogar ganze Körper wie ein gärender Sumpf einfach verschluckte.“
(Philipp Blom: Die zerrissenen Jahre: 1918–1938, München 2016, S. 42/43.)
—
Der Artikel von Daniel Schulz aus der taz ist schon von Anfang Oktober und ging auch schon durch diverse Twitter-Timelines, aber ich las ihn erst gestern. Falls ihr ihn bis jetzt auch vor euch hergeschoben habt: lasst das mal und lest. Es geht um das Jungsein in den 1990ern in der ehemaligen DDR und es fällt mir schwer, irgendeinen Textteil zu zitieren, weil alle gut sind und in allen ein anderer Aspekt steht. Der Text wurde für den Reporterpreis 2018 in der Kategorie Essay nominiert.
„Woher wir unser [Juden-]Witze hatten, weiß ich nicht mehr. Es hätte sie gar nicht geben dürfen. In der Verfassung der DDR stand, der Faschismus sei besiegt. Und weil er nun einmal besiegt war, durfte er nicht existieren. Die Staatssicherheit, das lässt sich in dem Buch der Stiftung ebenso nachlesen wie in den Berichten des Geheimdienstes selbst, nannte Hakenkreuze auf jüdischen Friedhöfen und Neonazis, die andere Menschen zusammenschlugen, „Rowdytum“ und tat so, als gäbe es keinen politischen Hintergrund. Punks und alle, die anders aussahen als sich die sozialistische Elite ihre Bürger vorstellte, verfolgten Geheimdienst und Polizei dagegen hart als Auswüchse einer Dekadenz, die nur aus dem Westen kommen konnte.
Daran knüpft die AfD heute an. Die Partei setzt wie keine andere darauf, eine ostdeutsche Identität zu feiern und zu fördern. In Wahlkämpfen und Reden umwerben ihre Politiker die Menschen damit, wie fein deutsch und wenig verfremdet es in Ostdeutschland so zugehe. Und die Erzählung vom unpolitischen Rowdytum scheint bei vielen Polizisten ebenfalls heute noch zu funktionieren.
War das in der Bundesrepublik denn besser? Klassische Frage, die immer kommt, wenn man etwas über die DDR schreibt. Vielleicht ließe sich sagen, es gab in Westdeutschland wenigstens die Chance auf ein öffentliches Gespräch. In der DDR lief so eine Serie wie „Holocaust“ nicht im Fernsehen, die Leute konnten danach nicht darüber reden, sich aufregen oder weinen – zu Hause, in der Kneipe, im Bus. Und bei allem Verständnis für den Willen, sich von Westdeutschen nicht mehr das eigene Leben ausdeuten zu lassen: Ist es wichtiger, das Andenken an die DDR zu retten oder sich Gedanken darüber zu machen, warum die eigenen Kinder von Nazis gejagt werden oder selbst andere jagen?
Nach dem Überfall von Neonazis auf ein Punk-Konzert in der Ostberliner Zionskirche 1987 wollte das Zentralkomitee der SED dann doch einmal die neonazistischen Umtriebe untersuchen. Die Forscher registrierten 1988 bis zu 500 Taten aus dem rechtsextremen Milieu pro Monat. Die Ergebnisse verschreckten die Machthaber so sehr, dass sie sie gleich wieder wegschlossen. Der Oberstleutnant der Kriminalpolizei, der das Team geleitet hatte, wurde ab da von der Stasi beobachtet.“
—
Florine Stettheimer, eine großartige feministische Künstlerin des 20. Jahrhunderts
Annekathrin Kohout würdigt Florine Stettheimer, über die wir 2014 auch mal in einem Fehlfarben-Podcast sprachen. Ich mochte die Dame ausgesprochen gern.
„Der Reichtum erlaubte Florine Stettheimer eine Kunstausbildung, die in ihrem Umfang der Ausbildung ihrer männlichen Zeitgenossen entsprach. In den 1890er Jahren besuchte sie die „Art Students League of New York“, eine damals neue Verbindung von Studierenden, denen das akademische Arbeiten an klassischen Kunsthochschulen zuwider war. Viele Wegbereiter der Moderne und (später) Vertreter der Pop Art lehrten und studierten dort, etwa Man Ray, Jackson Pollock, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Georgia O’Keeffe oder Louise Bourgeois; wegen ihrer liberalen Frauenpolitik galt diese Institution als radikal.
Das sehr frühe 20. Jahrhundert verbrachte Stettheimer in Europa, sie lebte in Deutschland (überwiegend in München) und reiste häufig nach Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien, wo sie Kunstmuseen, Galerien, Ateliers und Salons besuchte (in New York hat sie schließlich selbst einen Salon gegründet). Das erfährt man in den nicht mehr vollständigen Tagebüchern, in denen sie unter anderem Cézanne, Manet und Matisse kommentiert. Aber nur Wenig es dieser Künstler kann man im Werk Stettheimers wiederfinden. Wenn auch manche Farben und der pastose Auftrag an den Impressionismus oder die geschwungenen Körper an Chagall erinnern mögen: ihre Malerei ist völlig selbstständig, sowohl was die Malweise als auch was ihre Motive betrifft.
Besonders stark sind ihre Bilder, weil sie ein ungebrochenes Verhältnis zu ihren Sujets – der Welt der High Society – hat. Theater, Shopping, Ausflüge aufs Land, Picknick am Strand oder Cocktailpartys waren (wie sollte es für eine Vertreterin der Upper Class auch anders sein) für Stettheimer ganz und gar nicht verwerflich und nur manchmal, dann aber mit Augenzwinkern, kritikwürdig. Ihre Bildwelt zeigt oft auf eine feierliche Art die Vorzüge und die Schönheit von Wohlstand und Konsum, seltener aber auch die Tristesse. Oft tauchen dieselben Protagonisten immer wieder auf, was an Serien über Superreiche erinnert, zum Beispiel Gossip Girl. Hier wie dort macht sich bemerkbar: Reichtum bedeutet Schönheit und Macht.“
—
Nebenbei … nee, gar nicht nebenbei, Moment, ich komm noch mal rein:
Vielen Dank für eure ganzen Spenden! Echt jetzt. Dankeschön.