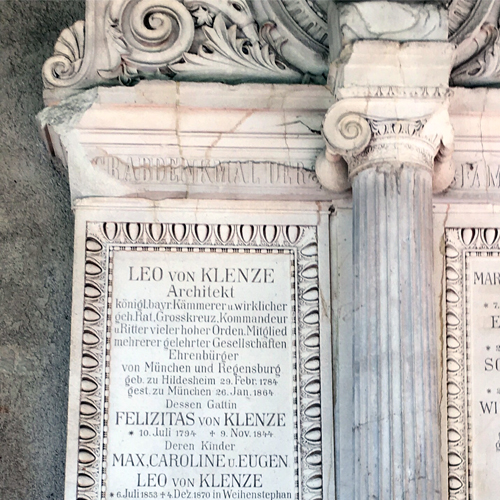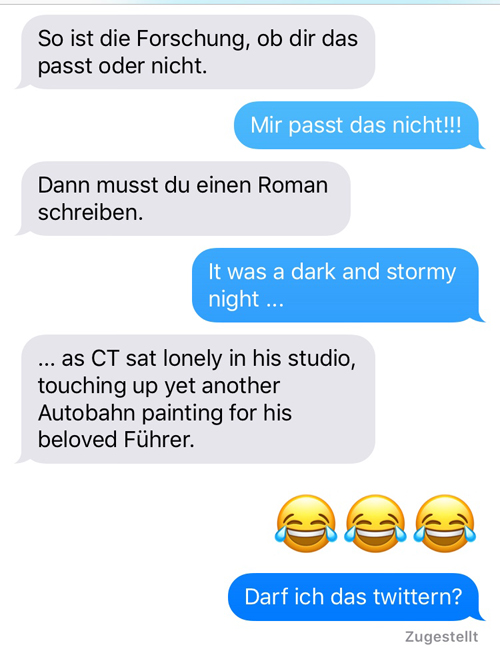Der Balkon – Geschichte und Nutzung
Meine zwei Hamburger Nervensägen ärgern mich seit Tagen auf Instagram oder Twitter, wo ich total unschuldig von meinem neuen Leben auf dem Balkon berichte. Ich bin natürlich noch ängstlich und vorsichtig mit diesem „da draußen“. Aber ich werde nicht ernstgenommen!
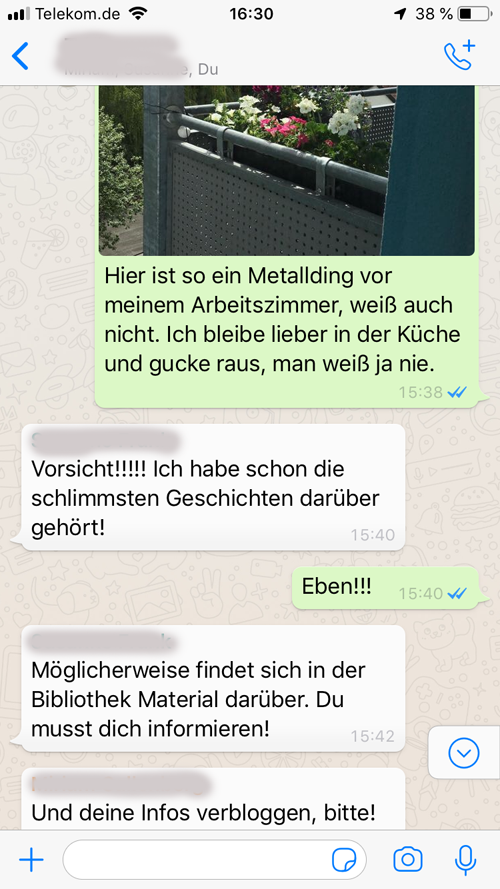
Schätzekens – you woke the beast. Ich war gestern stundenlang im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, wo sich erstaunlich wenig Literatur zu Balkonen finden ließ, aber ich habe doch viel gelernt. Das könnt ihr jetzt auch! Bussi, bitches!
—
Was ist das denn überhaupt, dieser Balkon?
Wir beginnen mit einer braven Lexikondefinition: „Mit Balkon wird bezeichnet jede in einen begrenzten oder unbegrenzten Raum vor eine Wand vorgekragte Plattform, die von einem hinter dieser Wand liegenden Raum aus zugänglich ist und ringsum durch eine Brüstung abgeschlossen wird. Der Balkon ist gewöhnlich offen, kann aber auch geschlossen sein.“
Und wir unterscheiden ihn von anderen lustigen Gebäudeteilen: „Der geschlossene Balkon unterscheidet sich von einem Erker dadurch, dass er von dem hinter ihm liegenden Innenraum abgesondert ist und nicht ein gemeinsames Ganzes mit ihm bildet, von einer Loggia dadurch, dass er nicht in den Baukörper einspringt.“ (Beide Zitate Isermeyer 1937, Literatur siehe ganz unten am Ende. Irgendwann werde ich Fußnoten in diesem Blog haben. Aber nicht heute.)
In eben diesem Lexikonartikel wird der Beginn der Balkongeschichte ins 1. Jahrhundert n. Chr. gelegt. Thomas Lauer schreibt hingegen im Ausstellungskatalog Balkone. Eine Ausstellung der Handwerkspflege in Bayern von 1991, dass Prätor Caius Menius am Forum Romanum 318 v. Chr. „einige aufgehängte Loggien als Theatertribünen errichten ließ, die die Vorgänger der Balkone gewesen sein sollen. Aber auch die Haus-Urnen der Etrusker zeigten schon kleine Loggien, die durchaus die Priorität für sich beanspruchen könnten, wenn Aristoteles nicht schon an ein Athener Gesetz aus dem Jahr 403 v. Chr. erinnert hätte, das vorschreiben wollte, daß ‚kein Balkon errichtet werden soll, der auf die Straße hinausragt‘.“ (S. 57) Isermeyer betont in seinem Lexikonartikel allerdings, dass es schwierig sei, die Geschichte der Balkone zu schreiben, weil es im Laufe der Jahrhunderte diverse, sich ähnelnde Bauformen mit unterschiedlichen Bezeichnungen gegeben habe, die schwer voneinander zu trennen seien.
Sowohl Isermeyer als auch Lauer erwähnen die Balkone im mittelalterlichen Festungsbau, wo sie als Pechnasen, Wehrgänge und Abtritte genutzt wurden.
Lauer beschreibt zudem Balkone in Mesopotamien und der antiken Stadt Tello, wo vermutlich eher geschlossene Balkone am Palast des Sumerers Gudea angebracht waren. Ich erinnere mich an meine einzige Vorlesung zu islamischer Baukunst, wo ich die ebenfalls geschlossenen Balkone im Osmanischen Reich bzw. der heutigen Türkei kennengelernt habe, die mit verzierten Holzgittern vor den Blicken der Vorbeiflanierenden schützen. Diese geschlossenen Balkone finden sich auch in Indien.
Das 19. Jahrhundert, der alte Game Changer mal wieder
Balkone an bürgerlichen Häusern anstatt an militärischen Anlagen oder Adelspalästen sind im westlichen Europa noch eine relativ junge Erscheinungsform: Erst seit dem Klassizismus wurden sie regelmäßiger als Gestaltungselement genutzt und „kamen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur vollen Entfaltung.“ (Nickl 1991, S. 71). Sie befanden sich meist im ersten Stock, der sogenannten Belle Etage, dem Stockwerk, „das seit dem Barock traditionsgemäß das Nobelstockwerk war und nunmehr meist dem Hausbesitzer zu Wohnzwecken diente.“ (Klein 1991, S. 33) Klein beschreibt den Zwittercharakter dieses Gebäudeteils: Er liegt sowohl innen als auch außen, man hält sich nicht allzulange auf ihm auf, teils um nicht als neugierig zu gelten, teils auch, um sich selbst nicht „von den Nachbarn auf die Teller sehen zu lassen“; der Balkon dient einerseits der Erholung an der frischen Luft, aber andererseits auch als vernachlässigte Abstellfläche. (Klein 1991, S. 33)
Über den Charakter von Balkonen schreibt auch Tom Avermaete in Rem Koolhaas’ Monsterbrocken Elements of Architecture, ein Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung auf der Biennale in Venedig 2014 aka ein gut 2.300 Seiten dickes Coffee Table Book.
„Unlike its cousins, the terrace and the logggia (dubbed by modernists as the ‚street in the sky‘), the balcony projects […] from the facade. This is the essence of the balcony’s strange state of exception: it is both inside and outside, private and public, an architectural crescendo and totally superfluous. […]
In Europe, the rise of the middle classes diffuses the balcony’s monarchical association, tilting it towards leisure and urban display – seeing and being seen. Balconies proliferate along Haussmann‘s wide Parisian boulevards – to the intense displeasure of critic Quatremère de Quincy, who thinks they are a crass fashion violating centuries of architectural order.“ (Avermaete 2018, S. 1075)
Diese angesprochene „architektonische Ordnung“ spiegelte die veränderte gesellschaftliche Ordnung wider, wie Lothar Binger und Susann Hellemann in einem Ausstellungskatalog zu Berliner Balkonen schreiben: „Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts hatte der Berliner Balkon – zentral über dem Eingang angebracht – eine Repräsentationsfunktion zu erfüllen und blieb ein ins Auge springender, ‚hervorragender‘, wenn auch kahler, unbegrünter Schmuck des herrschaftlichen Hauses. Dieser Zentralbalkon war vor allem an Adelspalästen und an vornehmen Bürgerhäusern zu finden. Aber kein Bürger hätte es sich im 18. Jahrhundert in der Zeit noch ungebrochener Adelsherrschaft angemaßt, auf diesem Zentralbalkon Platz zu nehmen, sich zu zeigen und von oben herab andere, auch ‚Personen von Stand‘ zu beobachten.
Die zögernde bürgerliche Nutzung der Berliner Balkone begann im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, und ihr gingen tiefgreifende wirtschaftliche und politische Veränderungen voraus. Die Französische Revolution von 1789 hatte die alten absolutistischen Monarchien Europas erschüttert. Ihre Auswirkungen auf die preußische Residenzstadt Berlin nahmen jedoch erst 1806 dramatische Gestalt an, nachdem der preußische Staat unter dem Ansturm der napoleonischen Armeen zusammengebrochen war. Der königliche Hof verließ fluchtartig Berlin, und die Berliner hatten über zwei Jahre lang eine überaus harte französische Besatzungszeit zu ertragen. Nach dem vollständigen Zusammenbruch des Staates waren die alten Verwaltungsstrukturen und Machtverhältnisse nicht länger aufrechtzuerhalten. Als ersten wurde 1807 die Erbuntertänigkeit der Landbevölkerung aufgehoben. Viele Landleute drängten in die Städte – vor allem nach Berlin.“ (Binger/Hellemann 1988, S. 21)
Der Text beschreibt dann die wirtschaftliche Rückständigkeit der Stadt, vor allem in der Textilbranche im Vergleich zu England, sowie das entstehende städtische Elend durch den Zuzug der Menschen vom Land.
„Anderseits bildete sich nach den Befreiungskriegen eine Schicht wohlhabender Bürger, die das kulturelle Erscheinungsbild Berlins zu prägen begannen. […] Die Häuslichkeit wurde zum Angelpunkt des Lebens, kultivierte Innerlichkeit und harmonisierende Idylle drückten sich in wissenschaftlicher Betätigung, in geselligen Zirkeln, in unverbindlicher politischer Debatte, in Gefühlsseligkeit, Naturverbundenheit und dilettierenden Künsten der Salons aus.“(Binger/Hellemann 1988, S. 22)
Exkurs: Dilettantismus (bin ich bei meiner privaten Lektüre gerade drübergestolpert, gleich mal zitieren)
Ein kleiner Schlenker zum Begriff des Dilettantismus, der anscheinend gerade auf Facebook und YouTube wieder en vogue wird:
„Die Begriffe ‚Dilettant‘ und ‚Dilettantismus‘ [haben] seit dem 18. Jahrhundert, als sie aus England importiert wurden, mehrere Bedeutungsschwankungen durchgemacht […]. In der Weimarer Klassik – bei Karl Philipp Moritz, Goethe und Schiller – hatte der Begriff Dilettant einen überwiegend abwertenden, kritischen Sinn. Der Dilettant war der exemplarische Nicht-Künstler: halb Liebhaber, halb Stümper. […] Nach der Goethe-Zeit jedoch erfuhr der Begriff hier und da eine energische Aufwertung, etwa bei Arthur Schopenhauer, der den Dilettanten auf dem Feld der Wissenschaft und Philosophie höher stellte als den Gelehrten vom Fach. Diese Sicht der Dinge machte sich niemand entschiedener zu eigen als Houston Stewart Chamberlain […] Obwohl von Hause aus Naturwissenschaftler, verstand er es, sich das Ansehen eines über den Einzelwissenschaften stehenden, alle Aspekte der Kultur, Religion und Politik souverän überblickenden Universalgenies zu geben.“
Genie war im 18. Jahrhundert das Gegenstück zum Dilettant – der Geniebegriff verfolgt gerade die Kunstdiskussionen bis heute, die Nervensäge. Hier noch Chamberlains super Erklärung, womit wir wieder bei den Impfgegnern und Sandy-Hook-Verschwörern wären: „Den Vorteil des Dilettantismus beschreibt Chamberlain dahingehend, dass eine umfassende Ungelehrtheit einem großen Komplex von Erscheinungen eher gerecht werden, dass sie bei der künstlerischen Gestaltung sich freier bewegen als eine Gelehrsamkeit, welche durch intensiv und lebenslänglich betriebenes Fachstudium dem Denken bestimmte Furchen eingegraben hat.‘“ (Beide Zitate Vaget 2017, S. 92)
Jetzt kommen endlich die Blümchen dran! Und drauf.
Schlenker Ende. Zurück ins Berlin des 19. Jahrhunderts: Kaffeehäuser und Konditoreien wurden zu Treffpunkten von politisch Interessierten, blieben aber auch unpolitischer Rückzugsort. „Das Gros der Berliner Kleinbürger begnügte sich mit dem Meckern über die Obrigkeit, mit Stoßseufzern über die bedrückenden Verhältnisse und beobachtete distanziert das öffentliche Geschehen, statt sich aktiv zu beteiligen. […] Diese beobachtende Haltung wurde schließlich Voraussetzung dafür, dass man Balkone zu nutzen begann, von denen das städtische Geschehen zurückgezogen beobachtet werden konnte.
Mit dieser Balkonnutzung eignete sich der Bürger verstohlen eine Öffentlichkeit an, die bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts noch aussschließlich den Interessen des Adels vorbehalten war. Die Balkonnutzung und Begrünung begann auch nicht auf den Repräsentationsbalkonen, sondern weniger auffällig auf rückwärtig gelegenen Balkonen.“ (Binger/Hellemann 1988, S. 22) E.T.A. Hoffmanns Des Vetters Eckfenster stellte diese Neigung des Bürgertums, die Welt aus einer geschützten Nische zu beobachten, dar.
So, hier, aufgepasst, jetzt kommt meine Lieblingsstelle:
„Nach den Befreiungskriegen wurden um 1820 mit dem Beginn des Biedermeiers zum ersten Mal Balkone mit Pflanzen geschmückt. Das um 1800 entstandene romantische Naturgefühl und eine starke Verbundenheit des Menschen mit der Landschaft drückten sich in einer Zuneigung zur niederdeutschen Ebene, zum Havelland und zum Spreestrom aus. Schinkel machte als der die folgenden Jahrzehnte bestimmende klassizistische Baumeister mit seinen Bauwerken das Verhältnis Landschaft und Stadt zum Thema. Lenné gestaltete als Landschaftsarchitekt die bestehenden weitläufigen Parkanlagen wie den Tiergarten, schuf die Grundlagen für später angelegte Stadtparks und begrünte verschiedene Stadtplätze: 1824 Leipziger Platz, 1842 Belle-Alliance-Platz, 1845/46 Opernplatz etc.“ (Ebd., S. 29) Einschub: Der Englische Garten in München war mit 1789 einen Hauch früher dran.
„In jenem Zeitraum breiteten sich auch liebevoll bepflanzte Gärten aus. Die Stadt wurde zaghaft grün, von den Plätzen zu den Gärten bis hinab zu den Blumenfenstern und schließlich zu den Balkonen. Vorläufer des blumenliebenden Balkonnutzers war der ‚Blumist‘, der aber seiner Neigung – wenn überhaupt – nur auf einem Fensterbrett nachkommen durfte. Er lebte dabei in ständiger Unsicherheit; denn in den Mietverträgen jener Zeit war ausdrücklich untersagt, das Mauerwerk durch herabfließendes Wasser zu beschädigen. Zuwiderhandlungen wurden mit sofortiger Exmittierung bestraft.“ (Binger/Hellemann 1988, S. 29)
BLUMIST! Mein Wort des Tages.
„Die schöne Aussicht als Naturerlebnis und der sehnsuchtsvolle Blick in die Ferne wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum bestimmenden Motiv, Balkone zu bauen und zu nutzen.“ Aber es war „zu jener Zeit [bis in die 1850er Jahre hinein] noch unüblich, sich auf dem Balkon niederzulassen und sich häuslich einzurichten. Der Aufenthalt beschränkte sich wohl nur auf einen kurzen Augenblick und Ausblick.“ (Ebd., S. 30)
Ende des Jahrhunderts ließen viele Stadtbewohner ihre Balkone geradezu überwuchern: „Die Laube über dem Balkon verschloss den Blick vor der steinernen Umgebung.“ (Ebd., S. 39) Um 1900 gab es die ersten Tipps, was genau man anpflanzen könnte – und die ersten Wettbewerbe wie in Steglitz, das 1900 vermutlich als erste Stadt des Deutschen Reichs einen jährlichen Balkonwettbewerb ausrief, weil attraktiver und üppiger Balkonschmuck durchaus auch dem Fremdenverkehr nützlich war. (Ebd., S. 40) 1912 entstand der Begriff des „Nützlichkeitsbalkons“, der spätestens im Ersten Weltkrieg wieder wichtig wurde: „In den Tageszeitungen [wurden] gelegentlich Empfehlungen für den ‚Kriegsgemüseanbau‘ auf dem ‚Berliner Kriegsbalkon‘ zu lesen, die aber von Gartenbaufachleuten als unseriös zurückgewiesen wurden. “(Ebd., S. 41)
Hier könnte jetzt noch eine riesige Abhandlung zu Balkonen in Gemälden stehen, aber das machen wir wann anders. Vielleicht den Manet als Beispiel, der geht ja immer. Dieser Blogeintrag ist schon wieder länger als meine Hausarbeiten im Bachelor.
Gesundheit, Politik, Werbung und Individualismus
„At the turn of the 20th century, medical theories associated the balcony with improved health and hygiene. In his novel The Magic Mountain, Thomas Mann employs the balcony of an Alpine sanatorium as metaphor for the moth-eaten world of European intellectual culture: lofty and detached, inhabited by those too fragile for the pungent reality below. As Mann wrote his massive book, the First World War shattered the contemplative universe of the balcony.“ (Avermaete 2018, S. 1075)
In den 1920er-Jahren begann der Balkon allmählich, zu einer Erweiterung des Innenraums zu werden. In den 1928 erlassenen „Richtlinien für die Arbeiten der Architekten an Wohnungsbauten der Stadt Berlin“ stand zu lesen: „Ihre architektonische Verteilung soll eine Folge der guten Bewohnbarkeit sein, d. h. die Balkone und Loggien dürfen nicht willkürlich wegen der Fassadenwirkung verteilt sein, sondern sollen sich aus dem Grundriss organisch ergeben.“ (Binger/Hellemann 1988, S. 43.) Balkone von Bürogebäuden oder Kaufhäusern wurden als Pausenplatz erobert – man hielt sich inzwischen länger auf ihnen auf. Und: Der Balkon wurde wieder politisch.
„Between the First World War and fascism, [the balcony] becomes a stage from which to orchestrate mass spectacle. The balcony positions the leader in direct, visible connection with the masses, but elevated above them. In the 1930s, Mussolini reanimates a medieval balcony type, the arengario, having them constructed wherever he might go.
The balcony-as-platform persists in the postwar world, but loses its centrality: after lending itself so willingly to demagoguery, the balcony as it was – singular, domineering – is thoroughly descredited (“Enough with the balcony!” became a slogan of Italian anti-fascist politics). TV and other media supersede the balcony appearance as a means of image-making, and the micro-managed nature of modern politics doesn’t make for compelling balcony scenes (though Latin-American populism, c. f. Evita, still makes a strong case for the political balcony).“ (Avermaete 2018, S. 1075)
Im Balkon-Kapitel von Avermaete folgen dann diverse Fotoseiten mit Balkonen, darunter auch demokratische Führer*innen, die huldvoll von Balkonen runterwinken. Erwähnt wird auch das Attentat bei den Olympischen Spielen in München, bei denen eins der inzwischen ikonischen Fotos einen der maskierten Terroristen auf einem Balkon des olympischen Dorfs zeigt. Auch ein Bild von Assange auf einem der Winzbalkone der Botschaft von Ecuador in London ist zu sehen, sowie POTUS und FLOTUS, die vom Weißen Haus runterwinken, Michael Jackson mit Baby in Berlin und natürlich die Egoíste-Werbung von Chanel.
Ebenfalls spannend: wie sehr Balkone in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bewusst als architektonisches und soziales Bauelement gesehen wurden. Zitiert wird der Soziologe Daniel Bell, der 1956 meinte, dasss Balkone die Möglichkeit eines „sense of individual self in our mechanized society“ brächten. (Avermaete 2018, S. 1187) Und weil das hier ein Blogeintrag und keine Masterarbeit ist, gibt’s keine hundert Beispiele, sondern nur zwei Links, nämlich auf die Torres Blancas in Madrid (1969) und Les Choux (1972). Das Kapitel zu post-colonial balconies ist auch super, aber dafür müsst ihr bitte selbst in die Bibliothek gehen.
In „The Return of the political balcony“ beschreibt Avermaete den Wechsel vom bewohnten Abstell- oder Pausenbalkon zum bewusst begrünten Balkon, der aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen (Selbstversorgerbalkon) nun eine andere politische Komponente hat. Es geht nicht mehr um die großen Reden, die von ihm geschwungen werden, sondern um die individuelle Weltverbesserung.
Auch die Nicht-Sichtbarkeit, das verborgene Beobachten, das Ende des 18. Jahrhunderts so wichtig war, hat sich geändert: Gerade bei Luxuswohnungen werden Balkone heute bewusst transparent gestaltet, um herzeigen zu können, was man hat. In Mumbais Aquaria Grande wurde das 2012 auf die Spitze getrieben – durch Balkonpools, die es allerdings schon 1977 im Condomínio Edifício Penthouse in Sao Paulo gegeben hatte, was damals als deutlicher Riss zwischen Arm und Reich gedeutet wurde. Würde ich, gerade auf Mumbai bezogen, auch heute so stehenlassen.
Über die politischen und historischen Implikationen dieses kleinen (oder auch riesigen) Gebäudeteils hatte ich noch nie nachgedacht. Well played, Hamburgnasen. Die Blumistin geht jetzt wieder an die frische Luft.
Wir schließen mit Musik:
(Manic Street Preachers – A Billion Balconies Facing the Sun)
—
Literatur:
Tom Avermaete: „Balcony“, in: Rem Koolhaas: Elements of Architecture, Köln 2018, S. 1072–1251.
Lothar Binger/Susann Hellemann: Von Balkon zu Balkon. Berliner Balkongeschichten, Buch zur Ausstellung in der Galerie im Körnerpark vom 2. Oktober bis 6. November 1988, Berlin 1988.
Christian-Adolf Isermeyer: „Balkon“, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. I (1937), Sp. 1418–1423; abrufbar unter www.rdklabor.de/w/?oldid=89071 [11.6.2019].
Dieter Klein: „Der Balkon in der Wohnhauskultur des 19. Jahrhunderts“, in: Kat. Ausst. Balkone. Eine Ausstellung der Handwerkspflege in Bayern, Galerie Handwerk München, München 1991, S. 31–54.
Thomas Lauer: „Planung und Gestaltung von Balkonen“, in: Kat. Ausst. Balkone. Eine Ausstellung der Handwerkspflege in Bayern, Galerie Handwerk München, München 1991, S. 55–63.
Peter Nickl: „Eine Reise durch Balkonien“, in: Kat. Ausst. Balkone. Eine Ausstellung der Handwerkspflege in Bayern, Galerie Handwerk München, München 1991, S. 67–87.
Hans Rudolf Vaget: „Wehvolles Erbe.“ Richard Wagner in Deutschland – Hitler, Knappertsbusch, Mann, Frankfurt am Main 2017.
+++
+++
Dir gefällt, was du hier liest oder du möchtest mir die nächste Geranie finanzieren? Dann bedanke ich mich für deine kleine Spende.