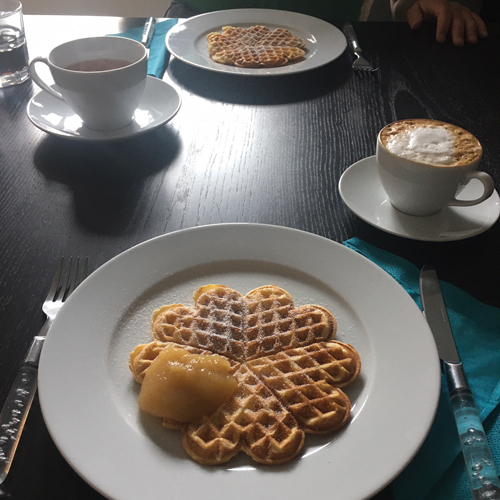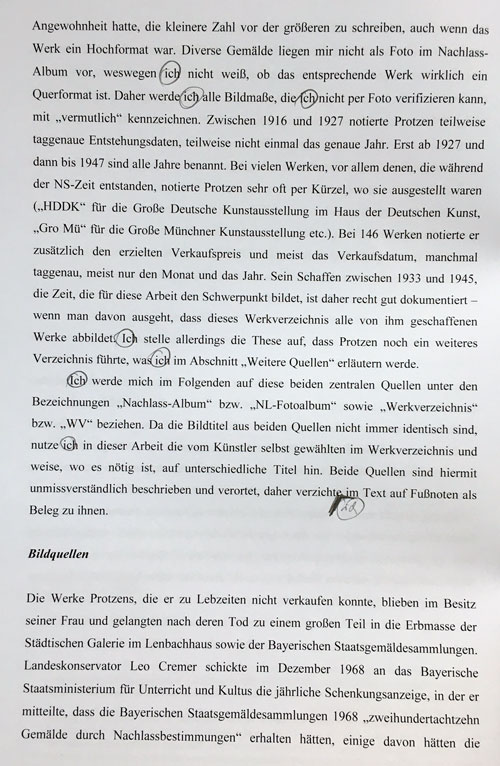Tagebuch Donnerstag, 31. Dezember 2020 – Sterneküche to go
Ewig ausgeschlafen, im Kopf die Diss umformuliert, weitergeschlafen. Mal sehen, was davon im Wachzustand übrig bleiben wird.
Die Wohnung im Sportoutfit geputzt, das kann durchgeschwitzt werden. Danach gleich Sport gemacht, total clever. Als ich gerade beim Cooldown war, klingelte das Handy, ich meldete mich außer Atem: „Hab ich dich von der Matte geholt?“ Mit Hamburg Neujahrswünsche ausgetauscht und, wie immer derzeit, über das Virus gejammert. Reicht jetzt allen, denke ich.
Dann die Küche auf den großen Abend vorbereitet: Tischdecke, Servietten, Platzsets gebügelt, das Silber geputzt (aka Alufolie und Salz und kochendes Wasser das Putzen erledigen lassen), endlich mal wieder das Fischbesteck eingedeckt. F. hatte die Zutaten zur Soirée Rouge schon am Mittwoch vorbeigebracht; ich las die Kochanweisungen durch und stellte die entsprechenden Gerätschaften bereit. Und weil das Ding „rouge“ im Namen hatte, dekorierte ich etwas nölig in Rot, was ich eigentlich nicht mehr sehen kann und auch nicht mehr in der Wohnung habe (außer einem kleinen Gemälde von Leo von Welden).

Im Bild links die Hot Sauce, mit der wir den Enteneintopf würzten, im Salat vergaß ich es. Rechts im weißen Töpfchen das Schnittlauchöl, mit dem man F. so glücklich machen kann.


Wir starteten mit Rosé-Champagner vom Dallmayr und knabberten und dippten vor uns hin. Es gab frisch aufgebackenes Brot mit japanischer Kräuterbutter, Curry-Kroepoekchips, Pane Carasau, zu dem ein Tofudipp mitgeschickt wurde, Ponzu Mixed Pickles; vor allem die Butter und die Mixed Pickles überraschten mich mit ihrer Frische.

Für den ersten Gang schob ich ein Stück Saiblingsfilet in den Ofen und streute nach dem Temperieren noch knusprigen Crunch darüber. Es hört sich vermutlich albern an, aber ich war ein bisschen davon beeindruckt, dass in meinem ollen Ofen ein Stück Fisch glasig wurde, das ein Sterneteam vorbereitet hatte.

Die Gerichte kamen in einem gewissen zeitlichen Abstand auf den Tisch; wir hatten bereits um 18 Uhr mit allem begonnen und als wir den Nachtisch verzehrten, war es nach 23 Uhr. Das wäre auch schneller gegangen, aber wir fanden es schön, uns Zeit zu lassen. Die meisten Einztelteile sollten erst Zimmertemperatur annehmen, bevor sie weiterverarbeitet wurden, was gut funktionierte. Der Wagyu-Beef-Salad wurde mit einer Soja-Limettenvinaigrette beträufelt und war großartig. Ich staunte über schmackhafte Salatherzen und freute mich sehr über das Fleisch, logisch.

Der Kabeljau wurde en papillote aufs Blech geschoben. Im Päckchen waren noch Rosenkohlblüten (nie gehört, nie gegessen, sehr gut) und Topinamburstampf. Dazu kochte ich die mitgelieferte Sake Beurre blanc auf und tropfte ein bisschen Kräuteröl in die Butter. Dafür hatte ich extra meine Spritzflasche aus dem Schrank geholt. Ich ahne, dass man das Öl auch einfach aus dem eingeschweißten Päckchen in die Sauce hätte gießen können, aber so konnte ich niedliche Punkte machen.

Zum ersten Mal Gamberoni in der Hand gehabt. Die kamen mit Butter gefüllt direkt aus dem Kühlschrank unter den irre heißen Grill und waren in drei Minuten fertig. F. pulte die Reste aus den Schalen, die ich Krustentieranfängerin übersehen hatte.

Der herzhafte Abschluss war ein Miso-Enteneintopf, wohlig-warm. Ich fand alles sehr ausbalanciert und harmonisch – fast so, als hätten wir bei Nakamurah im Laden gesessen.

Als Überraschung hatte F. noch einen Rotwein vom Salon Rouge mitgebracht, mit dem wir sehr viel Freude hatten. Fast buttrig-vanillig, aber nicht so unangenehm barriquig, was einem den Mund zukleistert. Wie alles am Abend: tolles Zeug.


Zum Rotwein knabberten wir Schokolade, bevor ich mich endlich traute, das kleine Matchatörtchen anzuschneiden, das ich zwei Tage lang bewundert hatte. Jedesmal, wenn ich für irgendwas an den Kühlschrank musste, hatte ich die kleine Pappschachtel geöffnet, das Backwerk bestaunt und ehrfürchtig wieder zurückgestellt. Und wenn ich nicht so auf Süßes stehen würde, hätte ich es in Kunstharz gegossen und als Briefbeschwerer behalten, aber mei, jetzt ist es in meinem Magen. Es hatte ein gutes Leben und wurde sehr gewürdigt.
Die Fotos sind wieder von F., ich war mit Kochen beschäftigt, versuchte zwar zwischendurch auch mal, nicht mit dem iPhone, sondern mit der Kamera etwas zu produzieren, aber das wurde leider alles Murks. Dafür knipste ich heute morgen noch die Reste unserer Mitternachtsbeschäftigung:

Wir gingen um 12 auf den Balkon, wie immer, und zündeten Wunderkerzen an. Einige Nachbarbalkone sahen genauso aus, man wünschte sich ein Gutes neues Jahr, und irgendwer hatte die Balkontür weit geöffnet, so dass „An der schönen blauen Donau“ zu hören war.
Der Champagner war ausgetrunken, wir stiegen – passend zum Brexit Day – auf einen englischen Sekt um, den mir Frau Kaltmamsell und Gatte 2019 zum Geburtstag geschenkt hatten. Guter Stoff. Damit ist mein Weinregal fast leer; ich habe im letzten Jahr nur für den Podcast neue Weine gekauft und auch dann nicht die übliche Kiste irgendwas, sondern nur genau die Flasche, die ich brauchte. Ich habe keinen Rotwein und kein Bubbly mehr, weswegen ich jetzt doch eine Kiste orderte und zwar beim Broeding, wo ich noch keinen schlechten Wein getrunken habe. Ich betrachte das als aktive Nachbarschaftshilfe.
—
F. hat meiner Meinung nach einen sehr guten Neujahrsgruß verfasst, und ich persönlich freute mich sehr über die Nachricht seines alten Studienkollegen aus den USA, den ich kennengelernt hatte, als er F. besuchte und wir zusammen in Augsburg Fußball geschaut hatten.

Okay, 2021. Mach es bitte besser als 2020, year of the gutterball. Wobei F. doch noch etwas Positives zu sagen hatte: „The Mandalorian“ hätte ihn quasi gerettet; das wurde auf Disney+ im März ausgestrahlt, und die zweite Staffel auch noch in diesem Jahr. „Baby Yoda carried many of us through all of this. Not bad for such a little guy.“ (Ja, F. und ich sprechen manchmal Englisch miteinander.)
—
Wer sich doch noch über 2020 aufregen will, dem sei dieser lange, lange, lange Artikel ans Herz gelegt, den ich eigentlich gar nicht lesen wollte, weil ich dachte, es ginge eh nur um Trump. Es geht aber um viel mehr, und ich habe viel gelernt.
„For three weeks, the U.S. had been trying unsuccessfully to send medical experts to China. The public-health contingent didn’t want to make decisions about quarantines or travel bans without definitive intelligence, but the Chinese wouldn’t supply it. When Pottinger presented a proposal to curtail travel from China, the economic advisers derided it as overkill. Travel bans upended trade—a serious consideration with China, which, in addition to P.P.E., manufactured much of the vital medicine that the U.S. relied on. Predictably, the public-health representatives were resistant, too: travel bans slowed down emergency assistance, and viruses found ways to propagate no matter what. Moreover, at least fourteen thousand passengers from China were arriving in the U.S. every day: there was no way to quarantine them all. These arguments would join other public-health verities that were eventually overturned by the pandemic. Countries that imposed travel bans with strict quarantines, such as Vietnam and New Zealand, kept the contagion at a manageable level.
The State Department’s evacuation of Americans, particularly diplomatic staff in Wuhan, outraged the Chinese; Tedros Adhanom Ghebreyesus, the director-general of the W.H.O., said that the U.S. was overreacting. In part to placate the Chinese, the 747s that were sent to collect Americans were filled with eighteen tons of P.P.E., including masks, gowns, and gauze. It was a decision that many came to regret—especially when inferior substitutes were later sold back to the U.S., at colossal markups. […]
By January 20th, ten days after the Chinese posted the genetic sequence of sars-CoV-2, the C.D.C. had created a diagnostic test for it. Secretary Azar reportedly boasted to Trump that it was “the fastest we’ve ever created a test” and promised to have more than a million tests ready within weeks. (Azar denies this.) But the F.D.A. couldn’t authorize it until February 4th. And then everything really went to pieces.
The testing fiasco marked the second failed opportunity America had to control the contagion. The C.D.C. decided to manufacture test kits and distribute them to public-health labs, under the Food and Drug Administration’s Emergency Use Authorization provision. According to Redfield, the C.D.C. published the blueprint for its test, and encouraged the labs to ask the F.D.A. for permission to create their own tests. But Scott Becker, the C.E.O. of the Association of Public Health Laboratories, told me that the labs weren’t made aware of any change in protocol. They kept waiting for the C.D.C. to supply tests, as it had done previously.
At a Coronavirus Task Force meeting, Redfield announced that the C.D.C. would send a limited number of test kits to five “sentinel cities.” Pottinger was stunned: why not send them everywhere? He learned that the C.D.C. makes tests, but not at scale. For that, you have to go to a company like Roche or Abbott—molecular-testing powerhouses that have the experience and the capacity to manufacture millions of tests a month. The C.D.C., Pottinger realized, was “like a microbrewery—they’re not Anheuser-Busch.” […]
Without the test kits, contact tracing was stymied; without contact tracing, there was no obstacle in the contagion’s path. America never once had enough reliable tests distributed across the nation, with results available within two days. By contrast, South Korea, thanks to universal public insurance and lessons learned from a 2015 outbreak of mers, provided free, rapid testing and invested heavily in contact tracing, which was instrumental in shutting down chains of infection. The country has recorded some fifty thousand cases of covid. The U.S. now reports more than four times that number per day.“