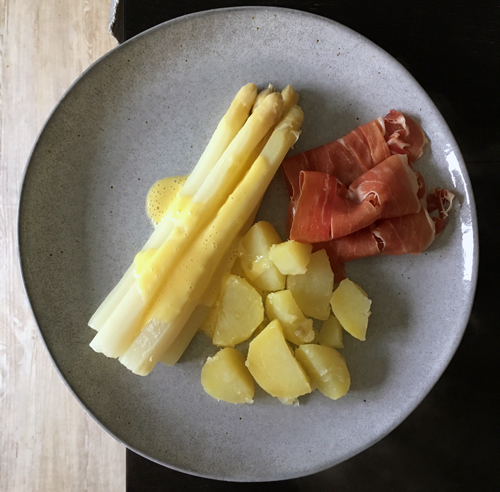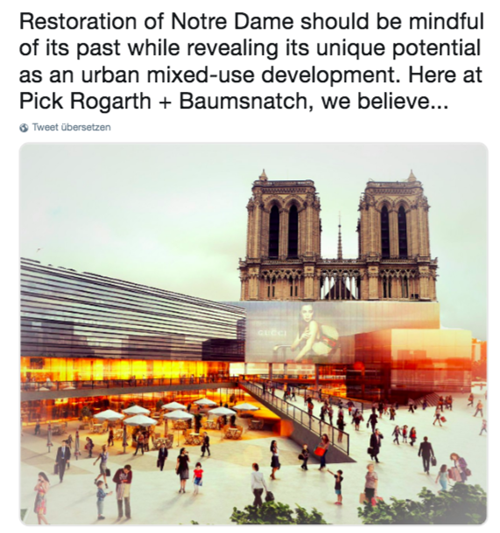Fehlfarben 20 – Am I What You’re Looking For? // Little Boy’s Luminous Legacies
Letztes Mal zwei Ausstellungen in Versalien, dieses Mal zwei mit englischen Titeln. Wir geben uns echt Mühe für sowas. (Nein, tun wir nicht.)

Podcast herunterladen (MP3-Direktlink, 88 MB, 110 min), abonnieren (RSS-Feed für den Podcatcher eurer Wahl), via iTunes anhören.
00.00:00. Begrüßung und Vorstellung.
00.01:10. Blindverkostung des ersten Weins. Wir trinken heute Rotweine aus Israel.
00.02:50. Die erste Ausstellung sind Fotografien, die im Amerikahaus München zu sehen sind. Endia Beal, Fotografin und Dozentin, inszeniert junge schwarze Frauen in ihrem Zuhause, aber vor einer Fototapete eines Büros (angeblich eine Aufnahme eines Büros, in dem sie selbst gearbeitet hat). Sie befragt die Frauen, die sich in selbstgewählten Outfits präsentieren, die sie als bürotauglich ansehen, zu ihrer Stellung im corporate America – was sie sich vorstellen oder wie sie es bereits erlebt haben. Am I What You’re Looking For?
Ich mochte an der Ausstellung, dass schwarze Frauen eine Stimme bekommen. Ich mochte auch die Grundidee, aber die einzelnen Aussagen haben mich teilweise fertiggemacht. Bei vielen Frauen ist zu lesen, dass sie sich der Hindernisse bewusst sind, die auf sie warten, aber damit muss man eben fertigwerden. Ich ahne, dass weiße Männer nicht unbedingt so in ihren ersten Job nach der Uni reingehen.
Neben den Fotos standen nur die Namen der Frauen, ihr Alter und eben ihr Statement. Eine Frau meinte, sie müsse sich halt den Normen anpassen, die von ihr erwartet werden. Klar, jede*r von uns passt sich im beruflichen Umfeld an (leider, will ich mir selbst auch des Öfteren zubrüllen). Aber die porträtierten Frauen sehen sich deutlich mehr angeblichen Normen – also Standards, die nicht von ihnen gesetzt wurden – gegenüber: Sie müssen zunächst den Normen entsprechen, die an sie als Frau gestellt werden, die von vornherein bescheuert sind. Ich musste an die ganzen Karriereratgeber denken, die Frauen eintrichtern: Um in einer Männerwelt voranzukommen, musst du dich wie ein Mann verhalten (Stichworte keine betont weibliche Kleidung, aber auch nicht wie ein Kerl, fester Händedruck, aber bloß nicht zu fest, in Meetings das Wort ergreifen, aber dann bitte nicht so bossy. Ihr wisst, was ich meine). Die zweite Norm ist generell die der Berufswelt, wozu eine Dame schlau meinte: “Dressing like a Republican isn’t going to make me something I’m not.” Aber gerade im Büro lauern die fiesen Kleiderfallen, über die jede Zeitung im Sommer atemlos berichten kann: Wieviel Bein ist noch bürotauglich? Wie tief darf der Ausschnitt sein? Darf man überhaupt etwas tragen, was einen Ausschnitt hat? Die Jungs werfen sich in einen Anzug und sind fein raus. Als Frau ist man im Zweireiher allerdings ein Mannweib oder, noch schlimmer, eine Karrierefrau, was auch immer das sein soll. Und die dritte Norm, die die Damen berücksichtigen, ist eine Untergruppe der Kategorie Frau, denn als nicht-weiße Frau gelten nochmal andere Spielregeln für dich, siehe natural hair. Ich persönlich wurde immer wahnsinniger vor den Bildern, weil ich bei fast allen dachte, wie haltet ihr das bloß aus. Ich bin schon gestresst von dem ganzen Anpassungsfirlefanz, aber wegen meiner Hautfarbe oder meiner Haartracht hat mich noch niemand angemault.
Einige Frauen sagten, ihnen seien die Hürden zu hoch, sie hätten sich bewusst gegen eine Karriere im corporate America entschieden. Andere wiesen darauf hin, dass viele Firmen eine neue Einstellungspolitik hätten, in der bevorzugt Minderheiten eingestellt wurden – der Bedarf für Vielfalt sei also offensichtlich da. Eine Frau erzählte, sie wäre bewusst zum marketing to minorities ausgewählt worden, was die Situation extrem bescheuert auf die Spitze treibt.
Viele Statements erinnerten mich schmerzlich an meine eigenen Zwanziger, in denen ich auch frohgemut dachte, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, wir haben alle die gleichen Chancen, wenn ich gut genug bin, klappt das alles. Nur um dann – natürlich – zu merken, dass man manchmal nicht dagegen ankommt, wenn der weniger begabte Art Director befördert wird, weil er mit dem Chef gerne ein Bierchen trinkt, und nicht die Frau, die bis Mitternacht in der Agentur sitzt, um ihren Job nicht nur gut, sondern exzellent zu machen. (Ob das so sinnvoll ist, spielt hier keine Rolle.) Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir meine derzeitige Karrierestufe reicht, dass ich keine Kreativdirektorin werden will, sondern nur irgendwo in der Ecke sitzen und schreiben möchte, aber ich habe ernsthaft deswegen ein schlechtes Gewissen. Hätte ich den Schritt nicht wegen der Vorbildfunktion eifriger verfolgen müssen? Denn wie eine Dame in der Ausstellung so schön sagte: “Not a lot of people in power look like me.” Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Vorreiterinnen. Aber das wissen wir ja alle.
Auch das hat mich ein bisschen deprimiert: die hoffnungsvollen Statements, die noch an die eigene Stärke glauben, an den Bonus, den die eigenen Individualität der Firma bringen wird. Ich würde die Frauen gerne in 20 Jahren noch einmal vor die Businesstapete stellen und fragen, wie’s ihnen jetzt geht. Ich hoffe, besser als ich erwarte.
Fazit der ersten Ausstellung: natürlich eine Anguckempfehlung. Läuft noch bis zum 2. Juni, der Eintritt ist frei. Wir erwähnen im Gespräch einen VICE-Artikel über das Projekt (2016, nicht 2013, wie ich anfangs rumplappere) sowie meine Rezension zu Ibram X. Kendis Stamped from the Beginning.
00.48:00. Der zweite Wein.
00.50:35. Die zweite Ausstellung: Little Boy’s Luminous Legacies läuft in der Lothringer 13 und beschäftigt sich, der Titel lässt es erahnen, mit dem Atomzeitalter.
Wir erwähnten die Postwar-Ausstellung im Haus der Kunst, die eine für uns zunächst überraschende, aber dann sehr sinnvolle Zeiteinteilung schuf: Dort wurde mit der Stunde Null nicht der Sieg über den Faschismus bzw. Hitler-Deutschland bezeichnet, sondern der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Damit begann eine neue Zeitrechnung. Die Exponate dort waren ungleich stärker, was mir persönlich die Ausstellung in der Lothringer 13 etwas verleidete; sie kam mir etwas zahn- und ziellos vor, und ich weiß immer noch nicht so recht, was ich von ihr halten soll.
Wir sprachen längst nicht über alle Kunstwerke; mir hat ein Werk von Henrik Plenge Jakobsen am besten gefallen: „Manhattan Engineering District“, wo ein Diaprojektor 80 Bilder an die Wand warf, die im Laufe des Manhattan Projects entstanden waren. Sie haben keinen Zusammenhang und kein Narrativ, zeigen Menschen, Gebäude, Fahrzeuge, technische Apparaturen, die für mich auch für die Ostereierproduktion hätten sein können (der Physiker am Tisch verneinte). Ich mochte genau diese Zusammenhangslosigkeit, das Zufällige, Unscheinbare, das nur dadurch eine Bedeutung bekommt, weil man weiß, was das Manhattan-Projekt war.
Von Jakobsen war noch ein zweites Werk in der Ausstellung. In einer Vitrine lag ein Stück Trinitit, ein künstliches Glas, das beim Trinity Test im Juli 1945 durch die große Hitze entstand. Neben dem kleinen Klumpen lag strahlendes Uranit, und auf beide war ein Geigerzähler gerichtet, der an einen Laptop angeschlossen war, auf dessen Bildschirm anscheinend Strahlung angezeigt wurde, ich konnte mit den Maßeinheiten oder der Tabelle, die dort sichtbar war, nichts anfangen. Aber es war das einzige Ausstellungsstück, das mir sehr deutlich vor Augen führte, dass diese Strahlung da ist. Um mich herum waren Foto- und Filmprojekte, die sich mit Fukushima beschäftigten, die aber für mich so aussahen wie kleine Störungen in der Matrix, nichts Aufregendes. Der sich bewegende Graph auf dem Bildschirm hat mich eher überzeugt. Wir sprachen in der Aufnahme auch über die bewussten Euphemismen wie „Kernkraft“ statt „Atomkraft“, weil’s halt ungefährlicher klingt.
Fazit: auch hier drei Daumen nach oben, von mir eher nach der Diskussion entstanden. Als ich aus der Ausstellung rauskam, war ich nicht so überzeugt, nach unserem Gespräch schon. Ihr habt noch bis zum 9. Juni, mal selbst zu gucken, wie’s euch geht.
01.17:00. Der dritte Wein.
01.45:10. Wir lösen die Weine auf: Nummer 1 hat uns allen am besten geschmeckt, aber wir würden alle drei wieder kaufen.
Wein 1: Hommage 2016 von der Yaffo Winery, Cuvée aus Merlot und Syrah, 13,5%, koscher, für 24 Euro beim Partnerweingut Schaetzle. (Auf der isrealischen Website steht, dass der Wein zu 10% aus Merlot besteht, auf meiner Flasche stehen 40.)
Wein 2: Mount Hermon Red von der Golan Heights Winery, 2017, Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot und Malbec, 14%, koscher, für 11 Euro bei Karstadt.
Wein 3: Judean Hills von Tzora Wineyards, 2015, Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot und Merlot, 13,5%, koscher, für 35 Euro bei Lobenbergs gute Weine.