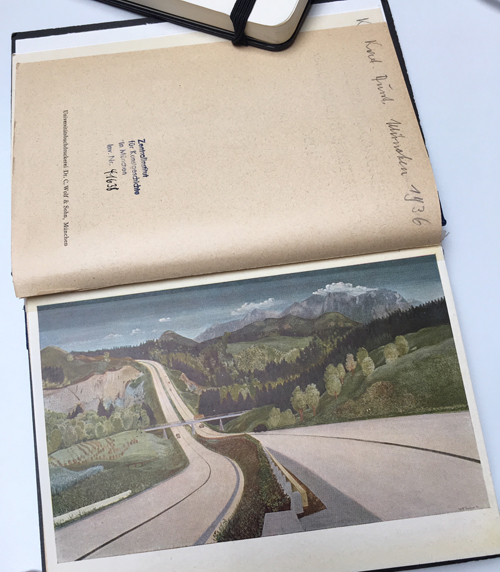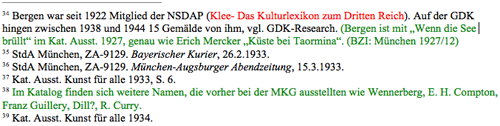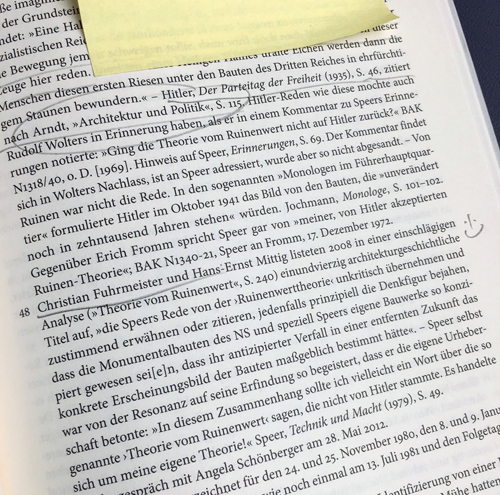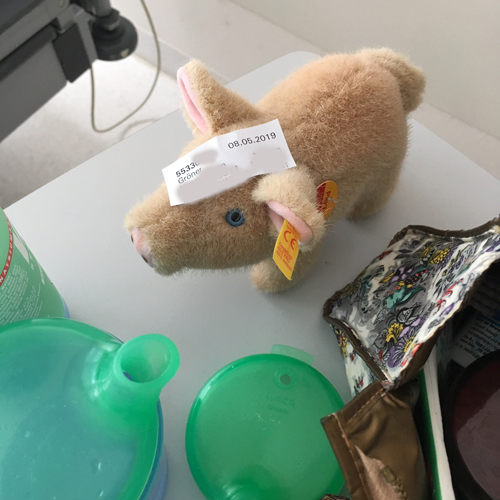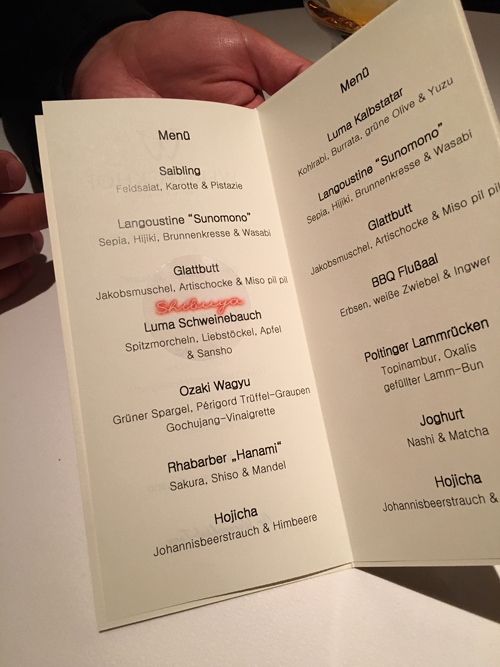Tagebuch Freitag, 31. Mai 2019 – Was man glauben möchte
Als gestern am späten Nachmittag ein Tweet von Moritz Hoffmann in meiner Timeline landete, in dem es um das Blog von Mlle ReadOn ging und ihre, Zitat, „Hochstapelei“, war mein erster Gedanke: „Ach, ist ihr endlich jemand auf die Schliche gekommen?“
Ich kaufte den digitalen Spiegel, denn die Story, die Hoffmann erwähnte, war mir fünf Euro wert, und las, dass nicht nur mein vages Unwohlsein gegenüber dem Blog gerechtfertigt, sondern dass es noch viel schlimmer war als ich vermutet hatte. Wenn die Spiegel-Story stimmt, und natürlich haben wir alle jetzt Relotius im Hinterkopf, hat Frau Hingst nicht nur im Blog Teile ihrer Biografie erfunden oder verfälscht, sondern, und deswegen bin ich seit gestern abend extrem pissig, Dokumente beim Archiv von Yad Vashem eingereicht. Zitat aus dem Artikel:
„Tatsächlich aber hat Hingst die Namen von 22 angeblichen Holocaust-Opfern […] dem Archiv der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gemeldet – 22 Menschen, von denen die meisten gar nicht existierten. Die Unterlagen des Stadtarchivs [Stralsund] und weitere Quellen zeigen: Nur drei Personen haben wirklich gelebt. Keiner von ihnen war Jude, keiner wurde ermordet.“
Und:
„2018 wurde Hingst bei einem Essaywettbewerb mit dem »Future of Europe«-Preis der »Financial Times« ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Dublin – man kann sie im Internet hören – erzählte sie wieder vom Leidensweg ihrer vermeintlich jüdischen Familie und verglich deren Schicksal mit dem der Flüchtlinge, die heute an Europas Küsten strandeten. Es gab starken Beifall.
Wer ist diese Frau, und warum hat sie das getan? Hochstapler gibt es viele, überall auf der Welt. Der Wunsch, Opfer des Holocausts zu seinen Vorfahren zu zählen, dürfte eine deutsche Besonderheit sein.“
Und genau das ist die Fallhöhe.
Hingsts Blog war seit Jahren auf meinem Radar; ich stolperte irgendwann darüber, als sie noch auf Englisch schrieb, dann wechselte sie zu Deutsch, woraufhin mehrere Leute in meiner Timeline oder meiner Blogblase sie häufiger zu lesen und zu verlinken schienen. Ich kam mit ihrem poetischen Stil nicht so recht zurande, mir war immer alles zu hübsch und noch ein Adjektiv und hier noch ein Nebensatz; bei Büchern nenne ich den Stil „Da hängen immer Lichterketten in den Bäumen“ und lese die betreffenden Werke meist nicht zuende.
Das war aber nicht das ursächliche Problem, warum ich dem Blog schließlich recht bewusst fernblieb. Ich kann den genauen Eintrag nicht mehr benennen – und jetzt kann ihn auch nicht mehr suchen, denn das Blog ist gelöscht oder zumindest offline –, aber ein paar historische Details, den Holocaust bzw. ihre Familiengeschichte betreffend, schienen mir nicht so recht zusammenzupassen. Es war mir nicht wichtig genug, um das ganze Blog rückwärts zu lesen oder die Inhalte ernsthaft zu prüfen – es war nur ein unbehagliches Gefühl. Ich ahne inzwischen, warum ich diesem Gefühl nicht weiter nachgegangen bin – was bilde ich mir als Nachkomme der Tätergeneration ein, eine Opfergeschichte anzuzweifeln?
Und genau das ist die Fallhöhe.
2017 erschienen dann weitere Artikel über Hingst oder unter Pseudonym von ihr; es ging um eine Klinik, die sie in sehr jungen Jahren angeblich in Indien eröffnet hatte und um eine Beratungssprechstunde für arabischstämmige Geflüchtete, mit denen sie offen über Sexualität sprach. Einer dieser Artikel erschien in der Zeit, die inzwischen der Meinung ist, die Inhalte damals nicht gut genug überprüft zu haben. Zitat:
„Am 27. Mai 2019 erreichte uns ein Hinweis des Spiegel, der nahelegt, dass die Geschichte um die beschriebenen Aufklärungsstunden erfunden sei. Wir nahmen daraufhin erneut und diesmal erfolgreich Kontakt mit der Autorin auf und baten sie um eine Stellungnahme.
In einem Telefonat versicherte sie erneut die Authentizität ihrer Geschichte. Sie nannte uns Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Menschen, die sie bestätigen könnten. Wir sind den Hinweisen der Autorin nachgegangen und haben darüber hinaus weitere Personen, Institutionen und Behörden kontaktiert. Wir sind in die von ihr benannte Kleinstadt gefahren und haben vor Ort die genannten Adressen und weitere Personen überprüft.
Dabei haben wir festgestellt, dass die Autorin – wohl erneut – versuchte, uns mit Scheinidentitäten, falschen Zeugen und vermeintlichen Belegen zu täuschen. Hierfür hat sie etwa die Identität einer verstorbenen Person benutzt, um in deren Namen E-Mails an uns zu schreiben. Zudem hat sie versucht, uns über die Existenz und die Lebensumstände von Verwandten und ihre Familienverhältnisse zu täuschen.
Erst ein Besuch bei einer engen Verwandten schaffte Klarheit über das Ausmaß der Legende, die sie offensichtlich seit vielen Jahren aufgebaut hat. Die Autorin hat Teile ihrer Biografie erfunden, andere verfälscht, und mit großem Aufwand jahrelang öffentlich vorgetäuscht, eine Person zu sein, die sie nicht ist. Selbst Teile ihres engeren Umfelds scheinen ihren Schilderungen bis heute zu glauben. Wir haben die Autorin mit diesen Recherchen konfrontiert, sie möchte sich derzeit nicht dazu äußern.“
Auch hier: Wer bin ich als behäbige Mittelstandsdeutsche, eine antirassistische, engagierte Kämpferin für Aufklärung und Gesundheit anzuzweifeln? Zudem besänftigten die damaligen Berichte mein gefühltes Unwohlsein, denn ich dachte mir, prä-Relotius, dass große Medienhäuser Storys vermutlich akribisch überprüften. Vor allem solche, die sich relativ leicht überprüfen lassen: einfach mal in die angebliche Kleinstadt fahren und gucken, ob’s die angebliche Sprechstunde überhaupt gibt. Ich ging nun davon aus, dass mein Unwohlsein der Biografie und der Autorin gegenüber ungerechfertigt gewesen sei, blieb dem Blog aber weiterhin aus stilistischen Gründen eher fern und es wurde mir egal.
Ich bekam allerdings mit, dass Hingst mindestens einmal einen Kommentar (oder eine DM oder eine Mail, ich erinnere mich nicht genau) veröffentlichte, in der eben genau ihre Biografie angezweifelt wurde; in der an sie als Historikerin appelliert wurde, es mit den Fakten genauer zu nehmen, gerade bei diesem sensiblen Thema. Ich las die gefühlt 100 Kommentare, die ihr beistanden und es nicht fassen konnten, dass sie angezweifelt wurde, aber mein Unwohlsein war wieder da: Ich war anscheinend nicht die einzige, die stutzig geworden war.
Mich selbst bzw. mein Blog verlinkte Hingst mindestens einmal: Mein Konzertbericht von Januar 2018 hatte ihr anscheinend gefallen. Ich verlinkte sie auch, und auch deswegen war ich gestern pissig und bin es heute noch mehr, denn meine Verlinkung betraf den 9. November sowie die Stolpersteine, zu denen Hingst eine Meinung hatte, die ich netterweise im Blog zitierte, weswegen ich sie jetzt nochmal zitieren kann:
„Ich wünschte an jedem 9. November wäre es still, ich wünschte einmal nur wären wir mit unseren Toten allein, ich wünschte es gäbe keine Stolpersteinputzkolonnen, keine Spruchbänder, keine Aufrufe, keine Bilder der Namen mit den Namen der Toten, die sich nicht weigern können, die blank sein sollen, denn jetzt wird ihrer gedacht und das ist auch leichter, denn die Fragen nach dem Ring mit dem blauen Stein am Finger einer anderen Frau sind schwieriger.
An keinem Tag wie am 9. November wünschte ich mir, ich könnte die Steine mit Laub bedecken, sie davor bewahren wieder Ziel deutscher Sauberkeit und Gründlichkeit zu werden, aber ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, dass die Enkel und Kinder der Toten nur stören im unbedingten Willen zu gedenken.“
Ich selbst schrieb folgendes:
„Der Blogeintrag hat mir aber wieder einmal klar gemacht, dass hier die Täter*innen(nachkommen) darüber entscheiden, wie der Opfer gedacht wird. Das ist im Prinzip genauso eklig wie Menschen, die anderen Menschen vorschreiben möchten, sich nicht so anzustellen, wenn ihnen Missbrauch widerfährt, ohne dass sie selbst wissen, wie sich ein solcher anfühlt. (Das Thema ist ja leider gerade wieder aktuell.) Bei den Stolpersteinen weiß ich immerhin, dass es auch genug Juden und Jüdinnen gibt, die diese Form des Gedenkens gutheißen, siehe den verlinken SZ-Artikel. Aber der Blogeintrag zeigt, dass es natürlich nicht alle sind, wie vermutlich nie irgendetwas von allen gleich beurteilt wird.“
Und damit sind wir erneut bei der Fallhöhe.
Holocaust-Opfer zu erfinden, ist nicht nur geschmacklos, es ist gefährlich. Es ist Wasser auf den Mühlen der Holocaust-Leugner, es ist Wasser auf den Mühlen derer, die Opfern eine Mitschuld unterstellen, ganz gleich, von was sie Opfer geworden sind, es ist Wasser auf den Mühlen der Geschichtsverfälscher und -umdeuter, die im Nachhinein besser wissen wollen, was passiert ist und wie wir damit umgehen sollten („Schlusstrich“, „langt jetzt auch“, „DRESDEN!“).
Es ist zum Kotzen, und ich bin sehr wütend. Wütend auf Hingst, wütend auf mich selbst, dass ich das Unwohlsein bequem zur Seite geschoben habe, aber auch wütend darauf, dass so viele in meiner Timeline sich auf Hingsts Seite schlagen, ohne den Spiegel-Artikel gelesen zu haben, der faktenreich belegt, worum es geht.
Es geht nicht darum, dass die Dame eventuell ihr Leben in Dublin ein bisschen aufgehübscht und Lichterketten in Bäume gehängt hat. Es ist egal, ob die Tasse, aus der sie morgens Tee trinkt, nun blau oder grün ist, ob das Kälbchen existierte oder welches Auto der Tierarzt fuhr, wenn es ihn denn gab. Mich haben gestern die vielen Reaktionen auf Twitter überrascht, in denen Hingst bescheinigt wurde, dass, selbst wenn das alles ausgedacht war, es doch immerhin schön zu lesen war.
Aber: Es macht einen Unterschied, ob man sich eine evangelische oder eine jüdische Großmutter erfindet. Es macht einen Unterschied, ob man sich eine Opferperspektive und damit eine Deutungshoheit aneignet, die man schlicht nicht hat. Es macht einen Unterschied, ob man Lesern und Leserinnen vortäuscht, ein Leben zu führen, das nicht existiert oder es von vornherein als ein literarisches Experiment aufzieht und kenntlich macht. Wenn Hingst das getan hätte, hätte es vermutlich öfter Kommentare gegeben, die genau diese Opferperspektive latent geschmacklos gefunden hätten, ähnlich wie bei Würgers Roman Stella, bei dem die Perspektive ähnlich war.
Ihr letzter Blogeintrag versuchte genau das – das Blog als Experiment und Literatur zu verbrämen, das es einfach nicht war. Ich bin ihr auf Twitter schon länger nicht mehr gefolgt und jetzt sind ihre Tweets geschützt, weswegen ich ihre Rechtfertigungen nicht lesen kann. Sie sind mir aber auch eher egal.