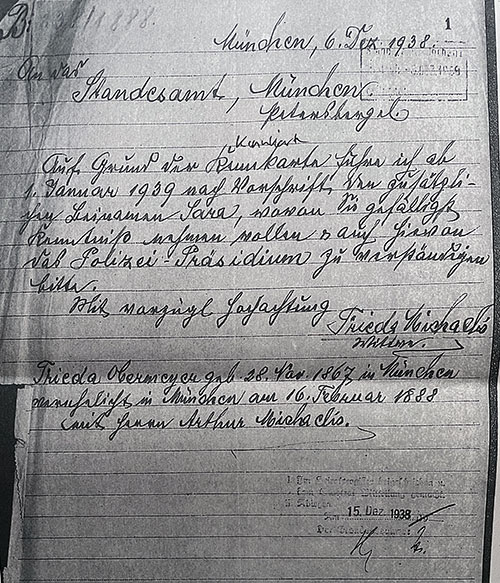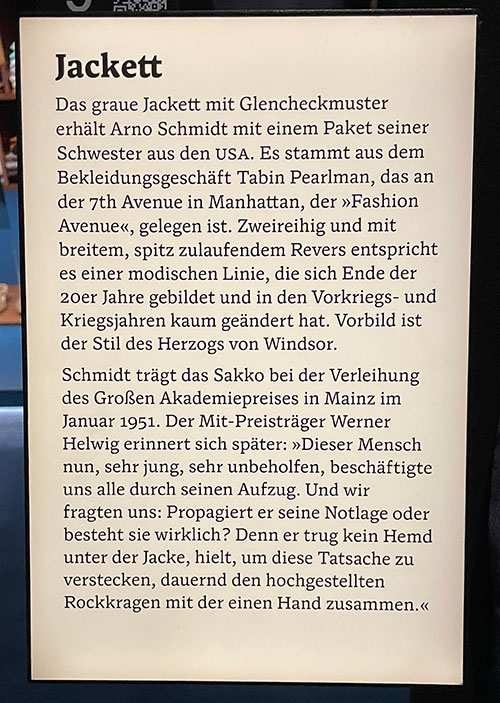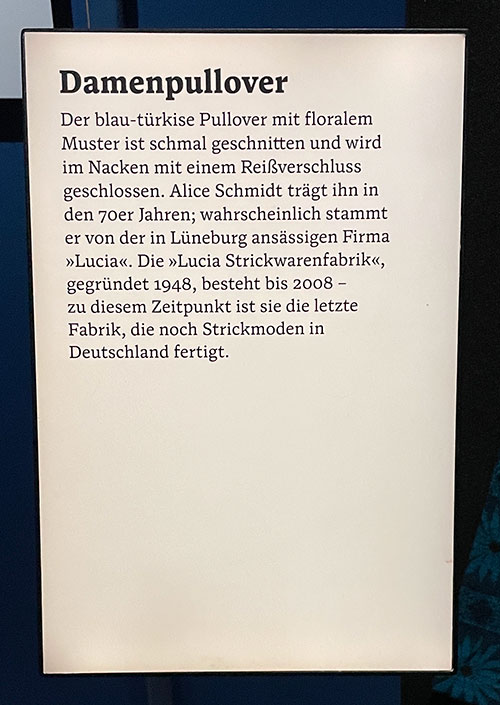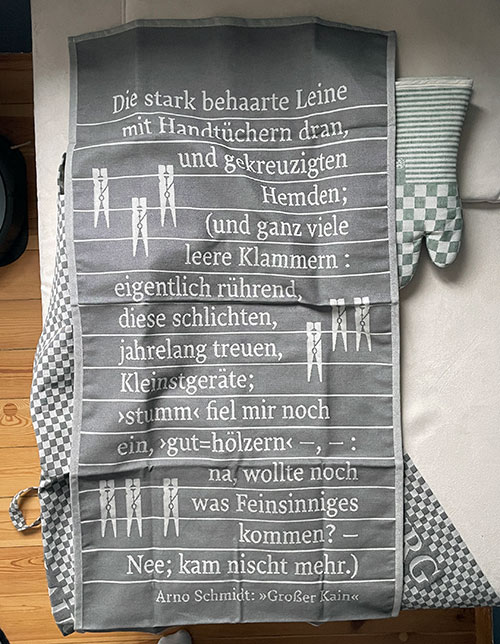Gestern vor fünf Jahren brannte Notre Dame, ich bloggte, noch mitten in der Promotion, ziemlich verzweifelt darüber.
Diese Verzweiflung wich dann relativ schnell einer gewissen Genervtheit, weil Twitter, Sie erinnern sich, es war ja nicht alles gut da, mal wieder den Bodensatz von Quatsch-Argumenten hervorspülte. In einem weiteren Blogeintrag schrieb ich etwas gefasster darüber, warum man über eine kaputte Kirche einen Hauch traurig sein könnte.
„Trotzdem darf man über die alten Bauteile weinen, ja meiner Meinung nach muss man das sogar. Denn auch wenn man alte Dachstühle durch neue ersetzen kann: Was unwiederbringlich verloren ist, ist das Material. Man konnte es datieren, teilweise lokalisieren, also feststellen, wo die Eichen gefällt wurden, mit denen gebaut wurde, man konnte anhand von Schlagspuren Werkzeuge rekonstruieren, Baugeschichte erfahren, die anders nicht überliefert war. Das ist, zumindest was den Dachstuhl angeht, alles verloren. Aber: Es ist, danke Wissenschaft, immerhin dokumentiert. Notre Dame wurde in den letzten Jahren, soweit ich weiß, komplett digital vermessen. Und dazu ist es als meistbesuchtes Baudenkmal Frankreichs von Millionen Tourist*innen fotografiert worden. Hat Instagram doch mal was Gutes. (Gotik-Influencer! Das wär’s!)
Daher bin ich auch immer noch wimmerig, was jetzt aus den Fensterrosen geworden ist. Klar kann man die neu basteln, es ist nur Glas und Blei. Aber zu wissen, dass da eventuell etwas verloren gegangen ist, das teilweise die Französische Revolution, zwei Weltkriege und alle Touristenhorden dieser Welt überstanden hat, macht mich halt traurig. Genau wie es mich traurig machen würde, wenn Raffaels Sixtinische Madonna in Flammen aufginge, auch wenn wir die kleinen Putten auf fünf Milliarden Kaffeetassen abgebildet haben.“
—
Das Datum hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf, aber „Le Monde“ hatte auf Insta eine clever zusammengestellte Reel mit Aufnahmen von damals und heute, die gestern in meiner Timeline landete.
Dass ich „Le Monde“ folge, ist noch relativ neu. Ich erwähnte vor einigen Monaten, dass ich mit Duolingo versuchte, Hebräisch zu lernen. Das habe ich inzwischen zu den Akten gelegt; die App ist für diese Sprache leider äußerst suboptimal. Hebräisch wird ohne Vokale geschrieben, das heißt, ich lese nur die Konsonanten. Bei vielen anderen, deutlich weiter verbreiteten Sprachen wie Französisch, bekommt man so ziemlich jeden Satz und jedes Wort in verschiedenen Aussprachen irgendwann mal vorgelesen, was gerade beim Vokabellernen nett ist. Genau diese Funktion fehlt aber bei Hebräisch, was die App für mich schlicht unbenutzbar macht. Oder mindestens sehr unkomfortabel.
Um meinen Streak nicht abreißen zu lassen, klickte ich daher Anfang Februar spaßeshalber mal auf Französisch, wofür ich die App 2015 oder so mal geladen hatte. Und seitdem lerne ich jeden Tag Französisch, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das jetzt der vierte Versuch ist, diese Sprache zu lernen.
In der Schule hatte ich zwei (oder sogar drei?) Jahre Unterricht als dritte Fremdsprache nach Englisch und Latein. In meinen Zwanzigern belegte ich mit Papa mal einen Volkshochschulkurs; Papa sprach Englisch und ein bisschen Spanisch. Das war aber für uns beide nichts. Der letzte Versuch fand Ende des Bachelorstudiums statt, also 2015, als ich noch für zwei Semester einen Sprachkurs belegen musste; das behauptet jedenfalls mein eben ergoogelter Blogeintrag, ich hatte schon wieder vergessen, warum ich in diesen Übungen saß. Der erste Versuch war Italienisch:
„Cum tempore ist eine Erfindung der GöttInnen, die aber anscheinend nicht für die Volkshochschule zuständig sind. Da findet nämlich um 8 Uhr morgens (pünktlich!) mein Sprachkurs statt, den ich im 4. und 5. Semester in Kunstgeschichte belegen muss. Den hätte ich mir ersparen können, wenn ich mir im 1. Semester meine 25 Jahre alten Lateinkenntnisse hätte anerkennen lassen, aber ich motiviertes Mäuschen dachte mir damals(TM), ach, wenn die Uni mir schon einen Sprachkurs bezahlt, wäre ich ja doof, wenn ich das Angebot nicht annehmen würde. Ich verfluche das motivierte Mäuschen, als mein Wecker um 6 klingelt.“ (Blogeintrag vom 11. April 2014, mein viertes Semester.)
Im Wintersemester belegte ich dann lieber Französisch, wie mein Stundenplan anklingen lässt. Über den Blogeintrag musste ich eben sehr grinsen, denn dort kam auch die Vorlesung bei meinem späteren Doktorvater vor, die der Grund dafür war, dass ich mich mit dieser Zeit deutlich intensiver beschäftigen wollte als vorher:
„Dienstag, 12–14 Uhr: Kunst in Deutschland 1925–1960
Und ich kleines Ding dachte, da kriege ich brav den Kanon vorgebetet, aber nein, das hatte sich der Dozent anders vorgestellt: Er erzählt uns lieber was über KünstlerInnen, die noch nicht so recht im Kanon sind, deren Werke sich selbst in unseren kunsthistorischen Datenbanken nur sehr spärlich finden (mein Riechsalz!), aber deren Namen wir dringend kennenlernen sollten. Nebenbei kriegen wir natürlich trotzdem den Kanon mit und ich bin sehr zufrieden mit meiner Kurswahl.“
Und einen zweiten Blogeintrag ergoogelte ich, denn an den erinnerte ich mich gut. Dort beschrieb ich, wie begeisternd und emotional uns die Dozentin eine Fremdsprache beibringen wollte, im Gegensatz zu der Dame, die ich im letzten Halbjahr im Grundkurs hatte:
„Bei der Kursbelegung für dieses Semester achtete ich darauf, nicht wieder die gleiche Lehrerin zu bekommen und habe es bisher keine Sekunde bereut. Ich twitterte und facebookte gestern schon begeistert ein paar Sätze meiner neuen Lehrerin: „Sie müssen emotional an eine Fremdsprache gehen! Kaufen Sie sich das schönste Vokabelheft und tragen es bei sich. Sie müssen da gerne reingucken wollen! Hören Sie Chansons oder Radio, schreiben Sie auf, was Sie verstehen – das ist immer ein Erfolgserlebnis! Und wenn’s nur mittendrin zwei Worte sind. Egal, aufschreiben und lernen. Überlegen Sie sich, was Sie Wichtiges über sich sagen wollen – das übersetzen Sie und lernen es auswendig. Finden Sie Wörter, die Sie gerne mögen und bilden Sie Sätze damit. In meinen Aufsätzen kam immer (Wort x, nicht verstanden, ähem) vor.“ […]
Schon ist aus meiner negativen Haltung eine sehr positive geworden, und innerlich denke ich über Sätze nach, die ich dann locker-flockig in Frankreich sagen werde können, wenn ich mir endlich mal alle Kathedralen angucke. Erster Satz (muss ich noch übersetzen): „DAS HIER IST NE KIRCHE, KÖNNT IHR EURE BLÖDE BROTZEIT BITTE DRAUSSEN MACHEN?“ (Vom letzten Notre-Dame-Besuch in Paris inspiriert.)“
Durch das dauernde Nutzen von Duolingo ist mir endlich mal aufgefallen, wie mich irgendwas dazu bekommt, mich länger mit einer Sprache auseinanderzusetzen, die nicht Englisch ist: der kleinstmögliche Widerstand. Ich hänge eh den ganzen Tag am Handy und neuerdings fast nur noch auf Instagram (Bluesky nur für Fußball, Masto fast nur noch als Linkschleuder). Ich hatte schon seit Längerem den Account von Schloss Versailles abonniert, weil Schloss Versailles halt. Die posten auf Französisch und Englisch, weswegen ich den französischen Teil immer übersprang und den englischen las.
Aber vor Kurzem merkte ich: Ich kriege den Großteil des Textes auch mit, wenn ich französisch lese. Also abonnierte ich noch das Museé Picasso, Louvre hatte ich eh schon, Musée d’Orsay auch, und begann, brav die französischsprachigen Texte zu lesen. Vor einigen Wochen kamen dann Le Monde und L’Équipe dazu, seit gestern folge ich ein, zwei Verlagen, die Comics verlegen – die kannte ich aus einem Artikel in der „Écoute“, von der ich mir mal ein Probeheft gönnte. Da merkte ich auch sofort, dass Insta für mich deutlich sinnvoller ist: In der „Écoute“ stehen zwar Artikel, die vermutlich eher auf meinem Sprachniveau liegen, die mich aber thematisch null interessieren. Was Museen posten, interessiert mich aber total, also lese ich es freiwillig.
Ich ahne, dass auch diese Sprachbegeisterung wieder nur kurz hält, aber momentan ist das ganz nett, nicht nur Deutsch und Englisch im Feed zu haben. Ich nehme gerne Hinweise auf französischsprachige Köche, Köchinnen und Foodblogs entgegen, die keine hektischen Videos machen, sondern schön altmodisch Fotos posten, zu denen ich Text in Zeitlupe entziffern kann. Merci!