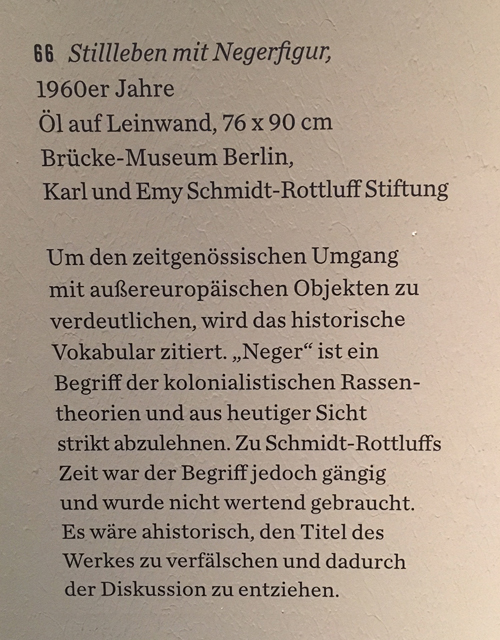Tagebuch, Dienstag, 10. April 2018 – Pseudostudentin
Da mein Gehirn bei Werbung relativ schnell mit den Augen rollt, ich aber nicht dauernd in Archiven rumsitzen kann, um meinen grauen Klumpen glücklich zu machen, möchte ich in diesem Semester wieder ein paar Vorlesungen besuchen. Das wird großartig: Ich muss nichts mitschreiben, ich muss keine Lernkärtchen basteln, ich muss theoretisch nicht mal mitdenken, ich kann da wie bei einem Diavortrag sitzen und mich berieseln lassen, denn ich muss keine beknackte Klausur mehr am Semesterende über den Stoff schreiben, den ich, wie ich nach elf Semestern weiß, sowieso sofort wieder vergesse, sobald ich den Prüfungsbogen abgegeben habe. Leider. Aber mal sehen – vielleicht bleibt ja was hängen, wenn ich weiß, dass eigentlich nichts hängen bleiben muss.
So radelte ich gestern frohgemut in die Luisenstraße in ein für mich neues Gebäude, wo, soweit ich weiß, schon seit letztem Semester Vorlesungen für uns Geistis stattfinden. In den Schaukästen neben den Hörsälen liegen aber immer noch lauter Geoden und Zeug; so ganz sind die Geologinnen wohl doch noch nicht umgezogen. Vielleicht teilen wir uns das Gebäude auch, aber es steht was von Geisteswissenschaften über dem Eingang. Egal. Ich radelte dort also hin, fand auch dank LMU-Raumfinder online den Hörsaal sofort, öffnete die Tür – und sah niemanden. Okay, es war fünf vor zehn, die Vorlesungen gehen mit akademischem Viertel los, aber das Thema ist so anfängerinnen-kompatibel, dass ich auf einen recht vollen Hörsaal getippt hatte. Hm.
Ich ging wieder vor die Tür, wo noch andere Studis warteten und fragte, ob sie eine Mail bekommen hätten, dass die Vorlesung ausfalle. Ich hätte sie auf keinen Fall bekommen, denn ich hatte mich schließlich gar nicht angemeldet. Alle verneinten. Ich guckte im Blog des Instituts nach – nichts. Ich schaute noch einmal bei LSF, dem elektronischen Vorlesungsverzeichnis, nach – nichts. Also setzte ich mich in den Hörsaal und zückte mein Buch, andere taten es mir gleich, und bis 10.25 Uhr saßen mit uns noch ungefähr 30 weitere Leute sinnlos rum, bis eine junge Dame vor mir meinte, sie hätte noch gar nicht in ihre Mails geguckt … ah ja, da ist ja die Absage, schon gestern abend, hihi. (Augenrollen bei der alten Frau hinter ihr, die sich zum wiederholten Male fragte, warum niemand seine Mails checkt.)
So radelte ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause und hatte nichts über Fotografie gelernt. Auch heute werde ich nichts lernen, denn die Vorlesung, die ich mir für Mittwoch rausgesucht hatte, beginnt erst nächste Woche. Das steht immerhin schon im LSF, sonst wäre ich heute nochmal umsonst zur Uni gefahren.
—
Why Scientists Are Battling Over Pleasure
Verschafft es eine andere Art von Befriedigung, Kunst anzuschauen oder ist dieses Glücksgefühl vergleichbar mit gutem Essen oder Sex? Die Neurowissenschaft diskutiert.
„The arguments over Dr. Christensen’s paper pointed to disputes within the emerging field of neuroaesthetics, or the study of the neural processes underlying our appreciation and the production of beautiful objects and artworks:
– On Team 1 you’ll find the argument that the experience of pleasure from art is neurobiologically identical to the experience of pleasure from candy or sex.
– Team 2 believes that both making and appreciating art can offer unique neurobiological rewards.
– Team 3 asks, “Who knows?!” (“Who cares?!” seems to be a subset of this group.)
Given that pleasure is known to be a powerful motivator of human behavior, it’s a dispute with implications far beyond art — at least according to Team 1 and Team 2.“
Wenn ihr keine Lust auf Neurologie habt, dann vielleicht auf dieses Video, das auch im Artikel verlinkt ist: Christie’s filmte die Menschen, die sich Salvator Mundi anschauten, bevor er verkauft wurde. Das ist zwar fies kalkulierter PR-Kram, aber so ganz kann ich mich den Bildern nicht entziehen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass ich nicht die einzige bin, die manchmal mit offenem Mund vor Kunstwerken steht.
—
Ich gebe zu, einige Male, wenn ich morgens vor dem Walken die herrlich bequemen Lauftights angezogen hatte, dachte ich eine Millisekunde darüber nach, mich mit ihnen wieder ins Bett zu legen. Damit bin ich anscheinend nicht alleine. Die Nike Pro Chiller Leggings sind mein liebster Clip aus der letzten Saturday-Night-Live-Sendung. (Gibt’s natürlich auch bei NBC, aber nicht für mich, weil ich kein VPN uswusf.)