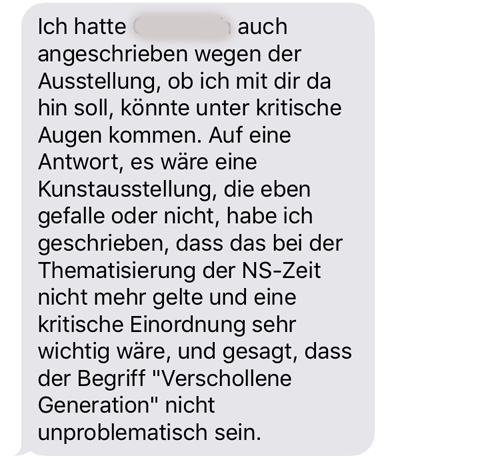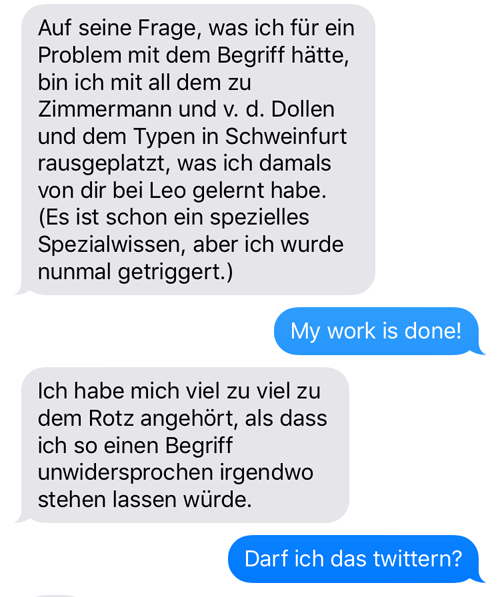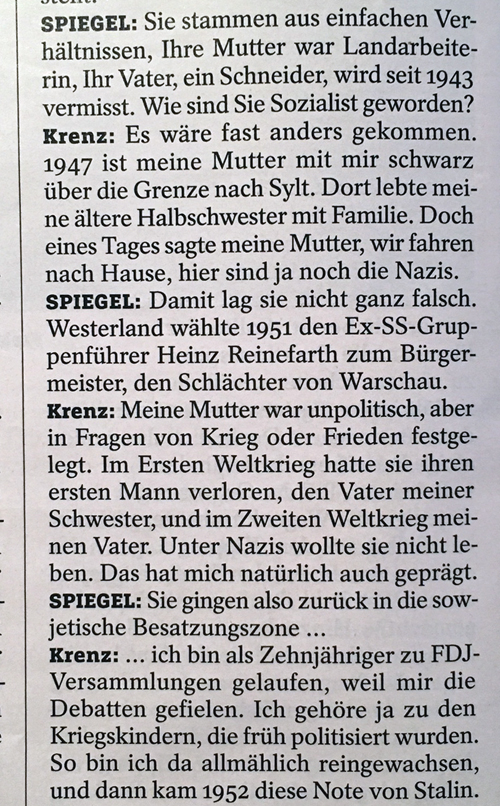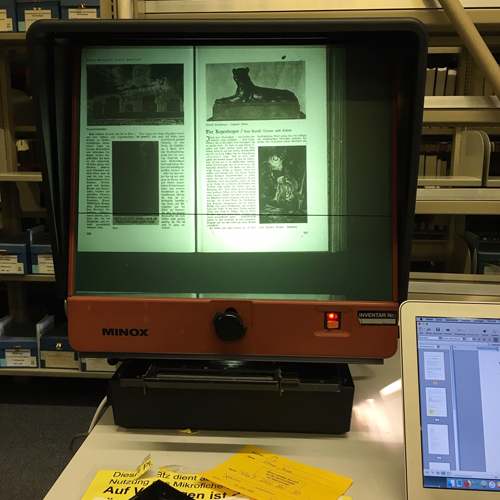(Ich zitiere Christian: „Die Fragen stammen ursprünglich aus dem Flow-Magazin, Johanna von pink-e-pank.de hat daraus eine persönliche Blog-Challenge gemacht, und Beyhan von my-herzblut.com hat das PDF erstellt.“)
281. Malst du oft den Teufel an die Wand?
Ich würde es anders ausdrücken: Im Kopf gehe ich so viele Stresssituationen oder Unannehmlichkeiten durch wie möglich, wenn ich einen Termin, ein wichtiges Meeting oder ein Vorstellungsgespräch habe, ein Referat halte, in den Urlaub fahre oder irgendwie sonst mit Koffer irgendwo hinmuss, gar mit diversen Verkehrsmitteln und Menschen. Ich nenne das „eine gute Vorbereitung“ und nicht „den Teufel an die Wand malen“.
282. Was schiebst du zu häufig auf?
Ich erwähnte neulich mal den geplanten Titel meiner Autobiografie: „Was weg ist, ist weg.“ Darin schwingt auch mit: Wenn ich was zu erledigen habe, dann mache ich das, denn das ist es erledigt. Steuer, Post, Packstation, Altpapier, Werbetexte, Dissertationen, her damit, weg damit.
Nur zu Ärzten oder Ärztinnen krieche ich erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Außer zum Zahnarzt, da bin ich innerhalb von fünf Minuten.
283. Sind Tiere genauso wichtig wie Menschen?
Nein.
284. Bist du dir deiner selbst bewusst?
Hä? Cogito ergo sum oder was willst du, Fragebogennase?
Okay, ich antworte mal ganz brav. Ich bin mir meines Körpers vermutlich öfter bewusst als schlanke Menschen. Ich bin mir meiner Privilegien erst seit einigen Jahren bewusst und vergesse auch gerne mal, dass ich sie habe. Ich mache mir öfter selbst bewusst, was ich kann, weil ich das sonst in schlechten Momenten vergesse. Daran anschließend kommt natürlich die Spirale, was ich alles nicht kann, aber da muss ich dann durch. Zufrieden, Fragebogen?
285. Was war ein unvergesslicher Tag für dich?
Ich kriege keine ganzen Tage zusammen, glaube ich. Es gibt aber durchaus Ereignisse, an die ich mich gerne zurückerinnere. Die Stunden am und auf dem Chiemsee und Frauenwörth mit dem ehemaligen Mitbewohner. Der Sonnenblumen-Irrgarten bei der Wiedereröffnung des Van-Gogh-Museums mit F. Der Wind und das Meer auf Sylt mit dem Kerl. Die Momente, in denen ich die ägyptischen Pyramiden und die Chinesische Mauer das erste Mal sah. Der erste Anflug auf Chicago. Der Herheim–Parsifal in Bayreuth. Der Augenblick, in dem ich vor dem Prüfungsamt das Masterzeugnis aufschlug und die Note sah. Meine Geburtstagsparty im März.
286. Was wagst du dir nicht einzugestehen?
Ich bin mit mir auf Du, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Es gibt aber durchaus Dinge in mir, an die ich nicht gerne rankomme. Um die gehe ich immer auf Zehenspitzen rum, aber ich weiß, dass sie da sind.
287. Bei welcher Filmszene musstest du weinen?
Bei ungefähr einer Million Filmszenen. Am schlimmsten war vermutlich Schindlers Liste, aber das ist lange her. Ansonsten weine ich in jedem Pixar-Film, wie sich das gehört.
288. Welche gute Idee hattest du zuletzt?
Blumen für den Balkon zu besorgen. Ich hätte nie gedacht, wie gerne ich vom Schreibtisch aus auf sie raufgucke. Und wie beruhigend das ist, sich morgens und abends kurz um sie zu kümmern: gießen, Verblühtes ausputzen, einfach ein bisschen anschauen und sich über so etwas Schlichtes, Schönes freuen.
Kräuter waren übrigens eine genauso gute Idee. Nicht ganz so hübsch, aber ich finde es ernsthaft immer noch toll, mir einfach ein bisschen Würze vom Balkon zu holen.
Ich denke jetzt natürlich über Palmengärten und Zimmerpflanzen nach und ich glaube, diese Büchse der Pandora ist ganz schön groß.
289. Welche Geschichten würdest du gern mit der ganzen Welt teilen?
Immer die, die ich nicht teilen darf. Erzählt mir bloß keine Geheimnisse, irgendwann verblogge ich die aus Versehen. (Außer Dienstliches, da bin ich der totale Geheimhaltungsstreber.)
290. Verzeihst du anderen Menschen leicht?
Anderen vermutlich leichter als mir selbst.
291. Was hast du früher in einer Beziehung getan, tust es heute aber nicht mehr?
Fremdgehen.
292. Was hoffst du, nie mehr zu erleben?
Verletzungen. Vor körperlichen habe ich fast mehr Angst als vor seelischen, und ich hoffe, dass dieser Satz mich nicht mal übel in den Arsch beißt.
293. Gilt für dich das Motto „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“?
Ja. Ich bin aber blöderweise neugierig und will immer alles wissen.
294. Wie wichtig ist bei deinen Entscheidungen die Meinung anderer?
Ich ahne, dass mich Instagrambilder inzwischen mehr beeinflussen als ich mir eingestehen möchte, jedenfalls was Einrichtungsgegenstände angeht. Bei Klamotten bin ich relativ unbeeinflussbar, weil ich da kaufen muss, was mir freundliche Onlineshops für dicke Menschen anbieten (hrmpf. Projekt „Endlich nähen lernen“ rückt immer weiter nach vorne auf die innere To-Do-Liste). Was berufliche Entscheidungen angeht, diskutiere ich die zwar gerne durch, mache dann aber, was ich eh machen wollte. Kurz gesagt: Die Vorstellungen anderer fließen sicherlich in meine Bewertung ein, aber im Endeffekt bin ich diejenige, die mit der Entscheidung leben muss.
Ich weiß gerade selber nicht, ob ich die Frage beantwortet habe.
295. Bist du ein Zukunftsträumer oder ein Vergangenheitsträumer?
Ich bin ein generell-in-der-Gegend-Rumträumer. Heißt: Ich denke eher, total sinnvoll, über meine Karriere als Drehbuchautorin in den USA und meine Riesenwohnung in Wien nach als über Werbeakquise und Nazischeiß. Darüber denke ich schließlich sonst nach.
296. Nimmst du eine Konfrontation leicht an?
Nein, ich laufe vor Konfrontationen sehr gerne weg. Alles viel zu anstrengend.
297. In welchen Punkten unterscheidest du dich von deiner Mutter?
Ich habe Internet und koche gern. Ich kann Geschichten beim Erzählen davor bewahren, völlig auszuufern, damit niemand um den Tisch rumsitzt und sich fragt, worum’s eigentlich geht und ob nach zehn Minuten irgendwann mal ne Pointe kommt. Ich wiege eindeutig mehr, aber im Gegensatz zu meiner Mutter stresst es mich nicht mehr. Ich will kein riesiges Haus haben und nicht auf dem Land wohnen.
Ich merke mit zunehmendem Alter aber auch, dass ich ihr in vielen Dingen ähnele. Hauptsächlich, dass wir beide den ganzen Tag vor uns hinbrabbeln.
298. Wo bist du am liebsten?
Zuhause, wo immer das gerade ist. Kann auch ein Hotelzimmer sein. Irgendwo, wo ich eine Tür hinter mir zumachen kann. (Nein, Zugklo zählt nicht.)
299. Wirst du vom anderen Geschlecht genug beachtet?
Ach Gottchen.
300. Was ist dein Lieblingsdessert?
Eis und/oder Schokolade gehen immer. Wobei die Welfenspeise ziemlich unschlagbar ist. Das Rezept aus Deutschland vegetarisch ist seit Jahren mein Standardrezept. #sturmfestunderdverwachsen
ist seit Jahren mein Standardrezept. #sturmfestunderdverwachsen
(2014) von Sebastian Dickhaut. Gestern gab es daraus Möhren mit Senfbutter und das eingedampfte Rezept habe ich auf Instagram beschrieben. Dass man von den Möhren Streifen schneidet, habe ich vorausgesetzt und daher nicht notiert.