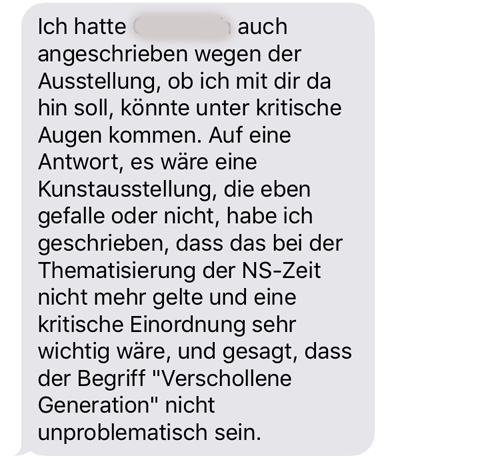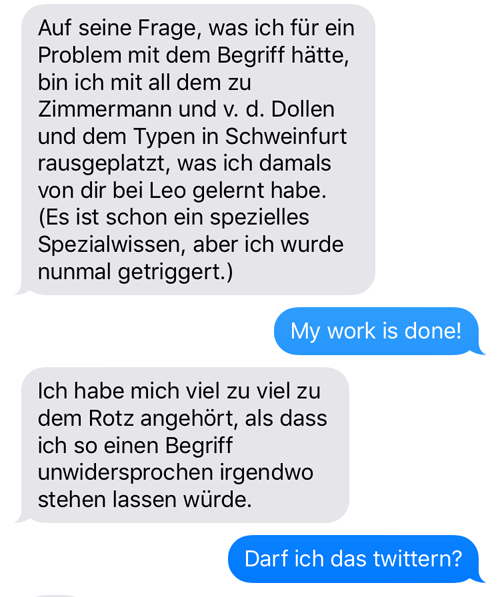Am Freitag erfolgreich weiter an der Diss gearbeitet. Jetzt, fünf Tage später, habe ich schon wieder keine Ahnung mehr, was ich geschrieben habe.
—
Am Samstag fuhren F. und ich nach Würzburg. Eigentlich wollte nur der Herr fahren, um sich die Bayern-Amateure bei ihrem ersten Drittligaspiel nach erfolgreichem Aufstieg anzuschauen, aber wir haben ein lauschiges Pärchen-Wochenende daraus gemacht, weil gemeinsame Urlaube gerade aus Gründen etwas schwierig sind.
Ereignislose und pünktliche Zugfahrt, Umstieg in Nürnberg, ich winkte dem Kunstarchiv zu, das man zwar von der Bahnstrecke aus nicht sehen kann, aber ich weiß, es ist da, my precious.
In Würzburg dann in die Tram gestiegen, die direkt vor dem Hauptbahnhof hält und bis fast vor die Hoteltür geshuttelt, genau wie ich es mag. Und ähnlich nett ging es weiter: Das Hotel hatte uns ein Upgrade gegeben, warum auch immer, und so durften wir im sehr neuen Hoteltrakt nächtigen. Statt in einem Zimmers eines Betriebs, der sich angeblich seit 1408 um Gäste kümmert, schliefen wir im Neubau, der quasi erst vor fünf Minuten fertiggestrichen wurde. So roch es jedenfalls. Das war aber auch das einzige, an dem wir etwas zu meckern hatten. Okay, die fehlenden Handtuchhaken, die die Handwerker vergessen hatten, wie die plauderige Dame an der Rezeption meinte. Und der Bewegungsmelder, der den Fußboden zum Bad schon eifrig beleuchtete, wenn ich mich im Bett umdrehte. Aber das war’s dann wirklich. Ich meine: der Ausblick alleine! Und: eine Klimaanlage, die lautlos alles auf gefühlte 14 Grad runterkühlte. Es waren vermutlich 23, aber irgendwann kroch ich ernsthaft unter die Bettdecke, weil es einen Hauch zu frisch wurde. Große Liebe.

Außerdem gab’s einen Obstteller und Wasser und einen kleinen Bocksbeutel und einen Blumenstrauß, den ich wirklich gerne mitgenommen hätte, und dann dieses Zeug, aus dem F. kaum wieder seine Füße nehmen wollte. Also aus denen, auf denen sein Name stand.

Ansonsten hatte ich persönlich noch nie soviel Platz in einem Hotel; das Bad alleine war so groß wie ein gesamtes Zimmer im Motel One. Und die Regendusche machte mich sehr glücklich, als wir nach drei Stunden in praller Sonne vom Fußball wiederkamen. Den Preis, den das Zimmer normal kosten würde, würde ich dafür zwar nicht zahlen wollen, aber quasi geschenkt – gerne wieder. Der Rest vom Laden war auch äußerst nett (Menschen) oder lecker (Frühstück).
—

Gerade erwähnt: drei Stunden in praller Sonne. Das war nicht so meins, und die Amas sind mir eigentlich auch egal und das Spiel war eher mies, aber das Stadion der Würzburger Kickers war wirklich nett. Da passen, soweit ich weiß, ungefähr 10.000 Leute rein und das ist eine Größe, die mir sehr sympathisch war. Der Stadionsprecher war allerdings pure Hysterie. Ich weiß, das gehört zum Berufsbild, dass jedes Tor und jede Mannschaftsaufstellung und jeder Wechsel gefeiert wird wie die Heilung von Krebs, aber das hier war wirklich eine Nuance zu viel. (Und der Sprecher bei den Bayern-Damen drei Nuancen zu wenig, aber das nur nebenbei.)
Wir wurden stets ermahnt, viel zu trinken und das hätte ich auch gerne gemacht, aber die beiden rührend kleinen Getränkeausgaben füllten jeden Becher ernsthaft erst nach Bestellung. In den größeren Stadien stehen batterienweise fertige Becher rum, so dass nur jemand zugreifen muss, und viele Stadien haben auch Bezahlkarten, womit das leidige Geldwechseln entfällt. Hier nicht, was ich als Gast auch okay fand, dass ich keine Karte brauchte, aber meine Güte, hat das alles gedauert. Ich hatte vor dem Spiel einen halben Liter getrunken und habe es nicht mal bis zur Halbzeitpause ausgehalten, den nächsten zu holen. Das dauerte ungefähr eine Viertelstunde, danach ließ mich F. von seinem Getränk nippen, weil die Schlange am Stand immer länger wurde. Ich hoffte ein bisschen auf einen Wasserschlauch in den Gästeblock, der aber leider nicht kam. Wäre bei 34 Grad vielleicht eine Idee gewesen.
Deswegen saß ich in der zweiten Halbzeit auch fast nur noch stumm und still rum und fächerte mir Luft zu, weil ich Angst um meinen Kreislauf hatte. Der hielt, aber das mache ich vermutlich nicht nochmal. Aber hey, meine erste Auswärtsfahrt! Und mein erstes Drittligaspiel!
—
Abends gönnten wir uns im Hotelrestaurant Kuno 1408 ein schönes fränkisches Menü plus regionaler Weinbegleitung. Ich hatte schon nach den Küchengrüßen keine Lust mehr zu fotografieren, weil ich einfach nur dasitzen und zufrieden sein wollte, daher sind die Bilder danach von F.
Aber meinen freundlichen Sitznachbarn konnte ich noch knipsen. Nächstes Mal möchte ich den Tisch, an dem der Panda saß. (Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung, warum da Stofftiere waren.)

Die Reinkommer: eine tolle Kartoffelkrokette, ein knuspriger Keks, ein fruchtiges Gelee, das sich mir nicht ganz erschlossen hat.

Der erste Gang war gleich mein Liebling des Abends: Forellentatar und Forellenkaviar, dazu eine Honigsenfsauce, in der eingelegte Dillstängel steckten, dazu Selleriefond. Normalerweise ist Anis nicht so meins und Dill auch nur in kleinen Dosen, aber das war alles perfekt. Frisch und zart und trotzdem voller Tiefe, hier ein bisschen Süße, hier was Saures, ach, herrlich, hätte ich mich reinlegen können.

Auch toll: eine Kohlrabischeibe, ungeschält, wie ich interessiert feststellte, mit Spargel drin, Radieschen, Kartoffelschaum, irgendwas Knusprigem obendrauf und dann leider einem Hauch zu viel Bacon in der Mayonnaise bzw. als Bröckchen. Ich weiß, Speck geht immer und mit allem, aber hier hätte ich mir die Souveränität gewünscht, das ganze vegetarisch zu lassen.

Nochmal toll: Kaninchen. Ewig nicht mehr gegessen, sollte ich eventuell öfter machen. Unten im äußerst formschönen Teller lag ein hohler Semmelknödel, der mit Blumenkohlpüree gefüllt war. Darauf dann zwei Sorten vom Fleisch, zwischen denen ein Crisp lag – ich tippe auf Pastinake, bin mir aber nicht sicher –, worauf noch ein bisschen Senfeis balancierte. Das happste man einfach so weg (F.) oder ließ es in die Sauce fallen (ich). Auch der Gang war überraschend süß, aber ich mochte ihn sehr gern.

(Memo to me: F. sagen, er möge bei Essensbildern immer, haha, Fleisch dranlassen, also großzügig mit Umgebung fotografieren, damit ich das Bild gerade zum Horizont ausrichten kann, ohne das Gericht beschneiden zu müssen. Hier ist nix ausgerichtet, weil dann das Eis nicht mehr im Bild gewesen wäre.)
Und dann kam leider für mich ein Totalausfall. Ich habe noch in keinem Sterneladen bisher einen Gang gehabt, den ich so gar nicht mochte, aber der hier war es. Zum geflämmten Zander gab es unter anderem eingelegte Gurke, Dörrtrauben, Hirsesalat und ein Ziegenkäsesößchen. Mag ich in Einzelteilen alles gern, aber das ging gar nicht zusammen. Den Zander fand ich langweilig, die Gurken undefiniert, die Trauben viel zu süß und ich wusste nicht, was sie auf dem Teller sollen, die Hirse schmeckte gammelig, der Ziegenkäse ließ endgültig alles ins Unangenehme kippen, und ich fand es doof, dass ich mir alles von zwei Tellern zusammenbasteln musste.


Der mummelige Kondensmilchflan mit dem herrlich frischen Erdbeerlimesorbet konnte mich auch nur halb wieder glücklich machen, denn unter der gewöhnungsbedürftigen Gewürzsahne lag fies saurer Rhabarber. Auch eigentlich etwas, das ich mag, aber auch hier war es die Kombi, die mich etwas unzufrieden zurückließ. Aber: frittierter Rucola! Grandios.

Die Petit Fours waren dann wieder gut. Nougatcreme auf eine Platte zu schmieren, durch die man mit dem Löffel durchfährt, fand ich super. Auch das Brot zum Mahl war gut, die Weine waren nett, der Käse war gut, jajaja. Aber ich hadere immer noch mit dem ollen Zander.

Als Absacker einen Sauerkirschbrand, dann lange und gut geschlafen.
—
Den Sonntag verbrachten wir Würzburg-Touri-gerecht zunächst in der Residenz, wo ich wieder eine Powerpoint-Folie aus einer Univorlesung abhaken konnte: das Treppenhaus mit dem Deckengemälde von Tiepolo habe ich jetzt auch gesehen und war angemessen beeindruckt. Ansonsten werden Barock und ich keine Freundinnen mehr, und wir durchstreiften die ganzen Prachträume recht schnell, bevor wir uns in den Garten setzten, schön geschützt unter Bäumen, denn es begann zu nieseln, und Leute stellten sich stilvoll unter.

Danach shuttelten wir mit der Kulturlinie 9, kleiner Tipp für euch, von der Residenz zur Festung hoch. Dort knipsten wir nur den Ausblick auf die Stadt, weil es wieder über 30 Grad heiß war, ich matschig und im Prinzip auch nur mit Eincremen und der Sonne ausweichen beschäftigt war. Im Biergärtchen ein Radler getrunken.
Im in der Festung gelegenen Frankenmuseum sahen wir dann eine Ausstellung, die wir auch in München hätten sehen können, aber mei: Sieben Kisten mit jüdischem Material. Von Raub und Wiederentdeckung 1938 bis heute. Ich musste an die Tagung zur Provenienzforschung denken, wo genau über diese Judaica gesprochen wurde (vorletzter Absatz), die seit Jahrzehnten in deutschen Museen rumliegen, weil keiner so genau weiß, wo sie herkommen. Ich fand die Ausstellung sehr unaufgeregt präsentiert, gut betextet, schön aufbereitet, kein unnötiges Pathos, aber viele Infos.
Ich bin nur im englischen Text, der neben dem deutschen auf den Tafeln stand, über das Wort „Kristallnacht“ gestolpert. Ich kannte „night of broken glass“, hätte aber auch gedacht, dass diese Begriffe inzwischen unüblich geworden sind, so wie wir heute ja auch „Novemberpogrome“ sagen, um das Verniedlichende aus dem Begriff bzw. dem Ereignis zu bekommen. Lustigerweise las ich einen Tag später im New Yorker in einem Artikel, in dem das Stuttgarter Museum erwähnt wird, genau darüber: „There was a small display with three cut-crystal goblets. “Pogrom of November 9, 1938,” the caption said, using the Russian word in place of the more familiar Kristallnacht.“ Scheint also im Englischen weiter benutzt zu werden, das letzte Wort.
Die Kulturlinie wieder zur Residenz gefahren, in einem Restaurant, was zwischen dort und dem Hotel lag, in dem noch unsere Koffer standen, was gegessen und weitergeschwitzt und gefächelt, aber ich zählte innerlich schon die Minuten, bis ich endlich wieder zuhause war. Das ist einfach nicht mein Wetter, dieses über 30 Grad, und ich wusste, wir sitzen noch zwei Stunden im Zug und ausnahmsweise auch nur in der zweiten Klasse, weil das Kuno teuer genug gewesen war. So litt ich vor mich hin, vergnatzte den armen F. mit meinem offensiven Rumleiden, und wir kamen beide nach einem eigentlich schönen Wochenende schlecht gelaunt in München an.
—
Montag hatten wir uns aber schon wieder zusammengerauft. Den Vormittag verbrachte ich mit Rumliegen, ich war immer noch fertig, und es war immer noch zu heiß. Nachmittags musste ich aber raus, denn eine Dame von der Süddeutschen wollte mit uns über unseren kleinen Kunstpodcast reden. Dazu gab es KEINE FRANZBRÖTCHEN, DIE WAREN AUS, WAS DENN NOCH, ALLES IST SCHLIMM BEI 30 GRAD, also Johannisbeerkuchen und drei Flat White für mich, weil sie halt so gut waren. Kann Bean Batter weiterempfehlen.

—
Und dann konnte ich mich Dienstag wieder nicht erholen, denn wir saßen schon wieder im Zug! Dieses Mal nach Bayreuth, wieder über Nürnberg, allmählich hatte ich keine Lust mehr zu winken. Ein von mir geschätzter Videokünstler hatte uns Karten für die Generalprobe des neuen Tannhäuser besorgt, und so konnte ich F. endlich mal das Festspielhaus zeigen, in dem ich immer leide (ZU WARM, IMMER, IMMER, IMMER. Außerdem Folterstühle, aber hauptsächlich zu warm), aber gleichzeitig auch immer vor Glück heule. So auch dieses Mal wieder, Pilgerchor halt, kriegt mich immer.
Offensichtlich Hügelwetter. F. musste einen schönen Wortwitz machen.

Eine andere Musik kriegte mich aber auch. Ich lache seit Dienstag darüber, dass die Melodie der Maus in Bayreuth gespielt wurde.
Über die Probe darf ich euch leider gar nichts sagen, aber vielleicht schaltet ihr heute den Livestream oder Samstagabend einfach 3sat ein, dann können wir endlich darüber reden! Und ich habe so viel zu sagen! Außerdem bin ich sehr auf die Kritiken gespannt, die mir vielleicht ein paar Referenzen erklären, die ich nicht mitgekriegt habe. Aber ich ahne, was der Couch Gag sein wird, ha! (In dem eben verlinkten Artikel fand ich die Frage: „Sind Wagner-Sänger nicht ohnehin abgebrühter, weil sie – im Gegensatz zu den Verdi-Kollegen – durch viele Konzept-Stahlbäder gegangen sind?“ sehr großartig.)
Hinter uns im zahlreich erschienenen Publikum – das Haus war in der oberen Parketthälfte voll, würde ich sagen, die untere war abgesperrt – saß ein Pärchen. Die Dame meinte vor der Ouvertüre: „Aber den Deckel vom Orchestergraben machen sie noch auf, oder? Sonst sehe ich ja die Musiker gar nicht!“ Ich grinste sehr, merkte aber im Laufe des Stücks, als sie immer bei den richtigen Szenen lachten (ja, es durfte bei Wagner gelacht werden, sehr schön), dass der Graben-Satz vermutlich auch ein Insider war. Vielleicht hatten sie ihn mal von einem Hügel-Newbie gehört und trugen ihn nun als Running Gag weiter. Ich werde das übernehmen.
—
Eigentlich hatten wir den Mittwoch auch noch in Bayreuth verbringen wollen, aber nach dem anstrengenden Würzburg-Wochenende und den nächsten Tagen und Wochen, die für uns beide ähnlich anstrengend werden, buchten wir kurzerhand Montag abend noch um und verließen das schon wieder viel zu heiße Bayreuth gegen 9 Uhr morgens.
Und wenn mein Internet sich nicht um 16 Uhr verabschiedet hätte, hätte ich gestern unverschwitzt auf dem Sofa gesessen. So musste ich aber mal wieder Schränke durchwühlen, um meine Festnetznummer rauszufinden, die ich nie benutze, um bei der Telekom zu eruieren, ob ich die einzige bin, deren Interweb zickt. War ich nicht. Lustiges Tethering, für das der Laden immerhin 10 GB für lau springen ließ. Na gut dann. Halbherzig die zwei Termine für diese Woche vorbereitet, aber da muss ich nochmal ran.
Besorgt meine Balkonblumen beobachtet, wie sie genau wie ihre Mami vor sich hinlitten. My babies! Mit diesem Rumpflanzen hätte ich also auch nicht beginnen dürfen, ich bin zu emotional für durstige Petunien! So, Hitze, du Mistvieh. Jetzt isses persönlich! *emogießen*