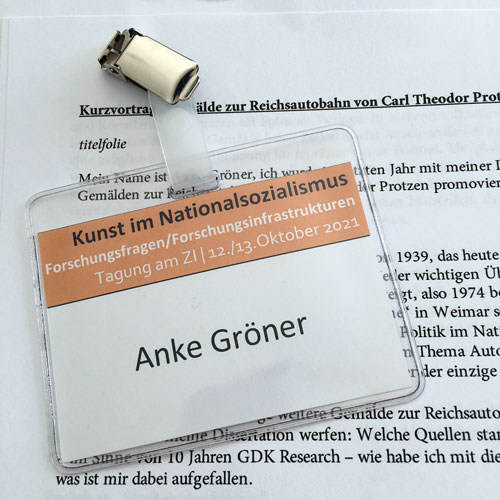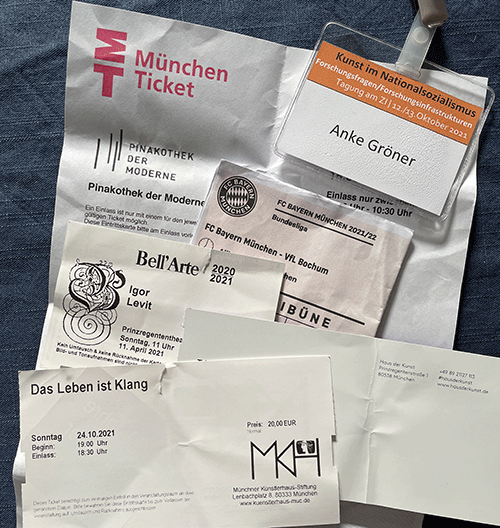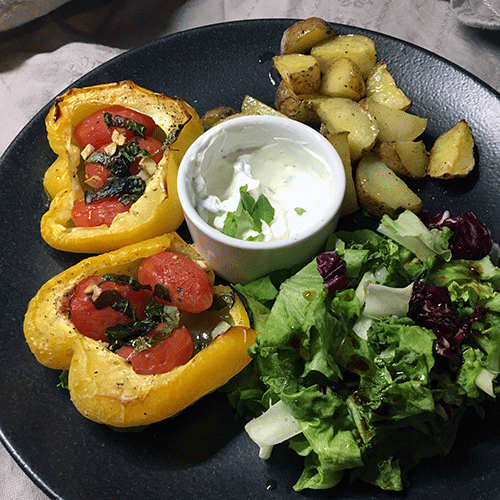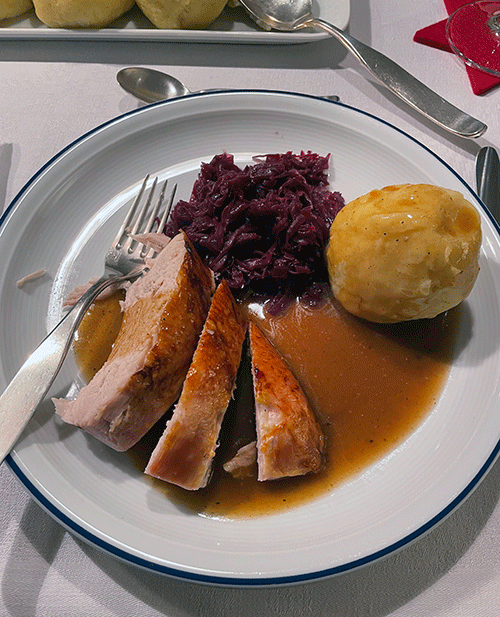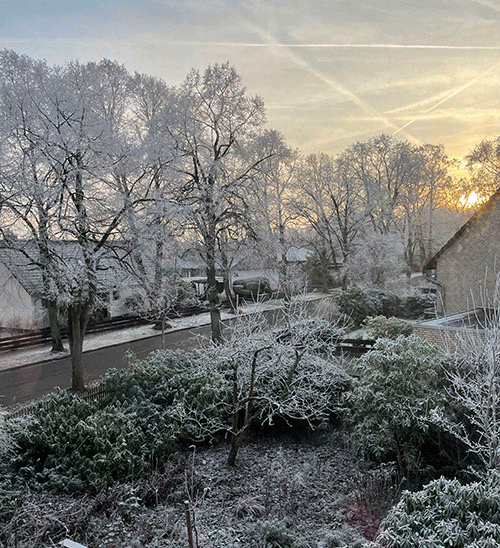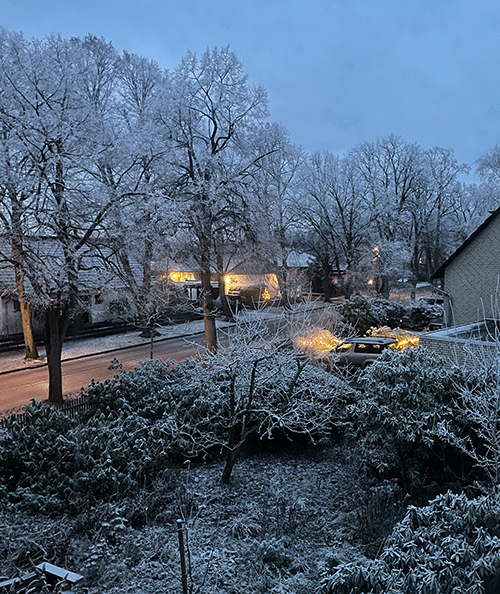(2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.)
1. Der hirnrissigste Plan?
Davon auszugehen, dass die Pandemie vorbei oder ein Klacks sein wird, sobald genügend Impfstoff für alle da ist.
2. Die gefährlichste Unternehmung?
Atmen.
3. Die teuerste Anschaffung?
Ein MacBook Pro, das mein MacBook Air von 2012 ablöste, auf dem ich meine Bachelor- und Masterarbeit sowie meine Dissertation schrieb. Snif.
4. Das leckerste Essen?
Das tollste Essen auswärts genossen wir im Sparkling Bistro in München, weil F. und ich gefühlt ewig nicht auswärts essen wollten und im August endlich F.s Impfschutz komplett war; meiner war schon im Juni vollständig, aber ich habe auf den Herrn gewartet, um wieder etwas mit ihm teilen zu können, was uns beiden sehr viel Freude macht. Er war noch etwas nervös, ich komischerweise nicht und es gab selten eine Mahlzeit, die ich so genossen habe. Einfach weil die letzte, die ich nicht selbst gekocht hatte, schon so lange her gewesen war.
Das inspirierendste Essen hatten wir dann im November (NOVEMBER OMG) im Jante in Hannover. Es galt 2G, in Niedersachsen waren die Inzidenzen bei knapp über 100, während München gerade an der 800 kratzte, ich war drittgeimpft und wir fühlten uns, als ob draußen kein Virus umherwabert. Das war nicht nur von der Atmosphäre her wie Urlaub, sondern auch vom wirklich spannenden Essen und den ebenso spannenden Weinen.
Ansonsten begeisterte mich in diesem Jahr jedes Ofengemüse mit Feta sowie meine tolle neue Biokiste, die seit September bei mir wöchentlich ankommt und mich verlässlich glücklich macht.
5. Das beeindruckendste Buch?
Sachbuch: High on the Hog. A Culinary Journey from Africa to the Americas von Jessica B. Harris. Viel gelernt über US-amerikanische Küche und ihre Geschichte. In Nebensätzen war auch immer Frauen- und Minoritätengeschichte lesbar.
LTI. Notizbuch eines Philologen von Victor Klemperer. Kannte ich bisher nur in Auszügen. Wenig überraschendes Fazit: ein wichtiges Buch.
Die Übernahme von Ilko-Sascha Kowalczuk. Hat mein Bild der Wiedervereinigung sehr erweitert, was komisch ist, denn ich war ja dabei. Die letzten 30 Jahre habe ich miterlebt, aber trotzdem einiges nicht mitbekommen.
Die Welt nach Wagner von Alex Ross. Irrwitzige Faktendichte. Zum Schluss war ich ein bisschen erschlagen und musste querlesen, aber gerade die Wirkung Wagners auf die verschiedenen Künste schon im 19. Jahrhundert fand ich äußerst aufschlussreich.
Fiktion: Tauben im Gras von Wolfgang Koeppen, Kleiner Mann, was nun? von Hans Fallada, Effingers von Gabriele Tergit und Junge Frau, am Fenster stehend, blaues Kleid etc. von Alena Schröder sowie Yaa Gyasis Homegoing trotz der Schwächen im letzten Viertel, um wenigstens zwei Bücher aus der heutigen Zeit in der Liste zu haben. Ich stellte aber auch in diesem Jahr fest, dass die Klassiker nicht umsonst Klassiker heißen. Hier Rant über die verspätete Rezeption Tergits einfügen wie bei so ziemlich allen künstlerischen Werken von Frauen.
6. Der ergreifendste Film?
Ich habe, um mich vom Da Draußen abzulenken, das komplette Marvel Cinematic Universe auf Disney+ geguckt. Alles, wobei ich Captain America anhimmeln konnte, war super. Nicht ergreifend, aber praktisch. Serien sind auch toll, die dauern länger.
7. Die beste Musik?
Alles auf Spotify, was ich im Zug aus dem Norden hörte, denn das hieß, mein Knochenjob war erstmal erledigt, ich konnte wieder schön am Schreibtisch sitzen. Und: Ich bin wieder bei Bohuslav Martinů angekommen, dessen Werk ich mir jetzt werkgruppen- und jahrgangsweise ganz buchhalterisch erschließe.
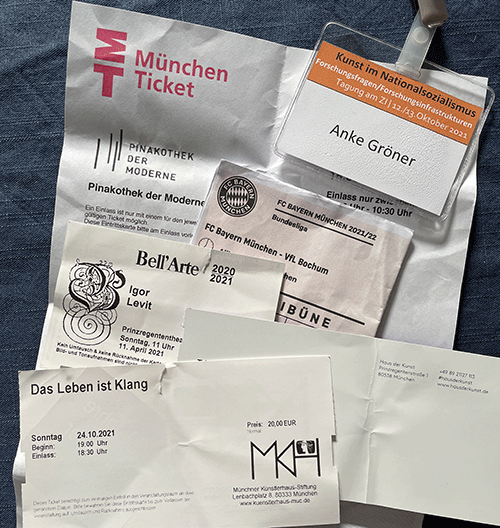
8. Das schönste Konzert?
Blasmusiker im Hof und Igor Levit im Prinzregententheater. Letzteres war das einzige offizielle Konzert, das ich in diesem Jahr sah.
9. Die tollste Ausstellung?
Nach ewigen Zeiten traute ich mich im August wieder in ein Museum und bewunderte sehr glücklich drei Werke von Carl Grossberg in der Pinakothek der Moderne. Von Protzens Donaubrücke bei Leipheim konnte ich leider nicht Abschied nehmen, die wurde aus dem Saal 13 abgehängt, als er umgestaltet wurde, in einer Zeit, in der ich mich gerade nicht vor die Tür wagte.
Ansonsten hat mich Heidi Bucher im Haus der Kunst begeistert.
10. Die meiste Zeit verbracht mit …?
Gefühlt mit Papa im Norden, während das Mütterchen wie geplant in der Reha und dann sehr ungeplant im Krankenhaus war. Vermutlich aber eher mit der zu veröffentlichenden Diss und Impfpanik.
Gerade nachgezählt: Es waren im Laufe von knapp drei Monaten 32 Tage, die ich im Norden verbrachte und in denen ich für Vaddern zuständig war. Klingt nach nicht viel, war aber für den Kopf das anstrengendste im ganzen Jahr.
11. Die schönste Zeit verbracht mit …?
Geimpft zu werden. Und alles mit F.
12. Vorherrschendes Gefühl 2021?
Vor April: GIB IMPF! Nach Mai: WARUM WOLLEN NICHT ALLE IMPF? Ab spätestens Oktober blinde Wut auf alles und zu viele Versalien im Blog.
Aber: Ab Oktober auch erstmals das Gefühl, dass die Doppelkarriere Kunsthistorikerin und Werbetexterin funktionieren könnte. Falls aus der Pandemie jemals eine Endemie wird und ich wieder in Archive darf, ohne sechs Wochen auf einen Platz warten zu müssen, und ich außerdem wieder etwas regelmäßiger gebucht werde als zwischen März 2020 und September 2021.
13. 2021 zum ersten Mal getan?
Auf einer kunsthistorischen Konferenz einen Vortrag gehalten. Die philippinische Küche entdeckt. Einen Kalmar ausgenommen. Mit Kutteln und Steckrüben gekocht. Eine Biokiste abonniert. Einen Pflegeheimplatz für ein Elternteil organisiert. Ein Elternteil im Pflegeheim besucht. Einen Weihnachtsfilm geschnitten; wenigstens in dieser digitalen Datei können alle aus der Familie gleichzeitig an einem Ort sein.
14. 2021 nach langer Zeit wieder getan?
In einer Kneipe gesessen mit vielen Menschen und Bier. Also drinnen. Letztes Mal irgendwann März 2020, vermutlich, 2021 am letzten Septembertag wiederholt. Das war dann auch der einzige Kneipenbesuch drinnen in diesem Jahr. Im Biergarten war ich einmal, in der Außengastronomie vermutlich fünfmal, wenn’s hochkommt.
Garnelen ausgenommen. Einen Staubsaugerroboter besessen. Auf einer Hochzeit gewesen. Eltern um Mietzuschüsse gebeten. Ein Buchmanuskript an einen Verlag geschickt – mit dem ganzen Rattenschwanz vorneweg und hinterher, Vertrag unterschreiben, Korrekturen abnicken oder ablehnen, Titelbild auswählen, ihr kennt das, wir Bloggenden haben inzwischen ja alle ein Buch geschrieben. Mein Opus magnum erscheint im Februar 2022.
15. Drei Dinge, auf die ich gut hätte verzichten können?
Eine globale Pandemie. Papas verschlechterter Zustand. Mamas temporär verschlechterter Zustand.
16. Die wichtigste Sache, von der ich jemanden überzeugen wollte?
Dass die Pflege Papas zuhause für über zwei Jahre ging, aber jetzt nicht mehr. Dieser Meinung waren alle Pflegenden und die Familie, aber das Mütterchen Löwenherz musste erst selbst krank werden, bevor sie eingesehen hat, dass auch ihre Kraft jetzt aufgebraucht war.
17. Das schönste Geschenk, das ich jemandem gemacht habe?
Wie schon 2020: Zeit zu haben, so oft es Diss und Pandemie zuließen, in den Norden zu fahren und meiner Mutter wenigstens ein bisschen Arbeit abnehmen zu können.
18. Das schönste Geschenk, das mir jemand gemacht hat?
Jedes Essen, das F. mir ausgegeben hat.
20. Der schönste Satz, den ich zu jemandem gesagt habe?
„Ich hab dich lieb, Papa.“
19. Der schönste Satz, den jemand zu mir gesagt hat?
„Ich hab dich auch lieb, Anke.“
21. 2021 war mit einem Wort …?
Kräftezehrend.