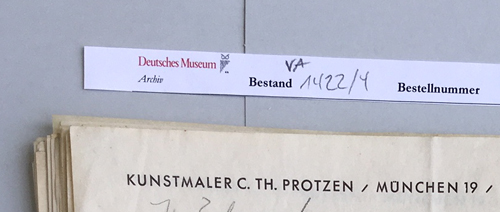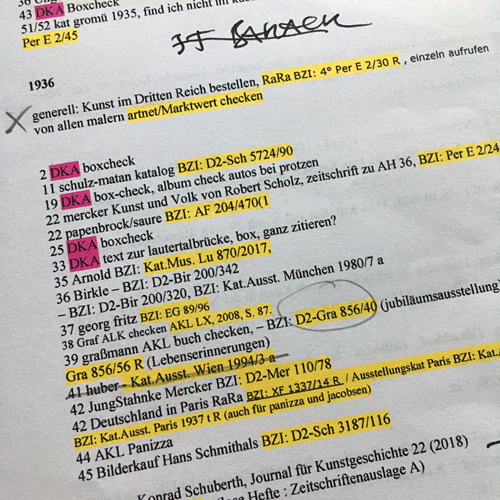Tom Kha Gai
Aww, mein erstes thailändisches Rezept nach der irgendwie hingewürgten Currypaste. Dieses Mal auch mit allen Zutaten, die das Rezept wollte, ha! Okay, fast.
Auf meinem Einkaufszettel standen eigentlich frische Limettenblätter, aber bei denen war ich mir nicht sicher, ob sie der Asiashop bei mir um die Ecke hatte. Dort gibt es einen kleinen Kühlraum, in dem kistenweise Gemüse und Kräuter liegen (und Udon-Nudeln, die total ungeplant in meinem Rucksack landeten, keine Ahnung, wie das passieren konnte), und in dem fand ich keine frischen Blätter, sondern Grünzeug, das ich nicht zuordnen konnte, weder vom deutschsprachigen Regalschild noch vom englischsprachigen Aufdruck auf den durchsichtigen Tüten. Und von der Optik schon gar nicht, weil ich bis auf Koriander nichts aus der thailändischen Küche wiedererkenne. Also kaufte ich, was ging und bestaunte zuhause meine Schätze.

Dann ging es ans wirklich einfache Zubereiten. Von Masterchef Australia hatte ich gelernt, auf dem Zitronengras mit dem Messerrücken rumzuklopfen, um die Aromen freizusetzen, und fühlte mich sehr professionell. Für alles andere schaute ich erstmal ein Video. Vor ein paar Tagen fragte ich auf Twitter nach Tipps für thailändische Küche, und die Bücher und YouTube-Filme von Pailin Chongchitnant wurden mehrfach erwähnt. Also guckte ich ihr erstmal zu, wie sie Suppe zubereitete und lernte, dass die ganzen Kräuter und Gewürze nicht mitgegessen werden. YouTube-Uni wirkt!
Das Tollste an dem ganzen Ding war, an der frisch aufgeschnittenen Galangal-Wurzel zu schnuppern (wie Ingwer, nur nicht so aggro) sowie erstaunt festzustellen, dass einem ein irrer Limettenduft entgegenkommt, wenn man nur die Tüte der getrockneten Blätter öffnet (eat this, schnarchige Lorbeerblätter). Diese Zutat werde ich dringend nochmal benutzen müssen. Vielleicht mache ich die Currypaste nochmal, jetzt habe ich ja alles im Haus. (Auch Thai-Basilikum, siehe Bild oben!)

Für zwei bis drei Tellerchen.
1 Dose Kokosmilch (400 ml) mit
125 ml Hühnerbrühe zum Kochen bringen. Darin befinden sich
1 Stange Zitronengras, in grobe Stücke geschnitten,
1 daumengroßes Stück Galgant, in Scheibchen,
3 Korianderwurzeln, grob gehackt,
4 Bird’s-Eye-Chilis, sehr grob gehackt oder wenigstens aufgebrochen, und
4 Kaffirlimettenblätter. Mit
3 EL Fischsauce würzen und alles zehn Minuten köcheln lassen. Von Pailin im Video gelernt: Getrocknete Blätter gehen auch, dann eben mehr nehmen. Hab ich gemacht. (PS: Der Name Kaffirlimette ist zu recht nicht unumstritten. Ich kann auch mit Thai-Limette gut leben.)
Nach den zehn Minuten die ganzen Gewürze rausfischen (oder gleich in einem Teesieb mitsimmern lassen).
100 g Champignons (oder Austernpilze), mundgerecht zerteilt, in die Suppe geben und fünf Minuten mitköcheln lassen.
Danach
200 g Hähnchenfleisch, bei mir Filet, mundgerecht zerteilt, dazugeben. Kochen, bis das Fleisch durch, aber noch saftig ist, das sind nur wenige Minuten. Mit
3 EL Limettensaft,
1 TL Palmzucker (bei mir brauner Zucker) und notfalls noch mehr Fischsauce abschmecken. Mit Koriandergrün und Chili-Ringen servieren. Pailin meint im Video, dass man die Gewürze auch drinlassen kann, dann sollte man den Gästen aber sagen, dass der ganze Kram nicht mitgegessen wird. Ich fische das lieber vorher raus, aber das Süppchen sieht natürlich schicker aus, wenn mehr Zeug drin ist.
Ich fand die ganz leichte Schärfe der Suppe hervorragend. Sie ist alles andere als brennend, sondern eher frisch. Die Lippen zwirbeln nach der Suppe noch etwas, aber für mich unterstützte die Schärfe alles andere anstatt es zuzuballern. Wenn man die Deko-Chilis mitisst, ist das allerdings ein anderer Schnack. (Ging auch!)
Aus dem Asiashop habe ich mir auch eine andere Fischsauce mitgebracht als meine bisherige aus dem Supermarkt. Ich behaupte, auch sie (angeblich aus Thailand importiert) schmeckt frischer und weniger streng als meine alte. Duftet auch deutlich angenehmer. Überhaupt, der Duft von allem! Ich komme gerade überhaupt nicht damit klar, wie anders meine Küche riecht. Ganz wundervoll.