Tagebuch Donnerstag, 14. November 2019 – Pachinko und Relotius
Der Titel ist bereits Makulatur und begonnen habe ich das Ding schon 2017, aber hey, eingetragen.
—
Vorgestern Pachinko ausgelesen, das mich im letzten Drittel ein wenig ratlos zurückgelassen hat. Die Geschichte beginnt quasi richtig in den 1930er Jahren in Korea und verlagert sich dann nach Japan, wo sie anschließend größtenteils bleibt. Die Hauptfigur ist die junge Sunja, die im Laufe des Buchs altert, und nach und nach übernehmen Figuren aus der Familie eher die Funktion der Protagonistin, denen wir statt ihrer länger folgen. Genau das hat mich etwas genervt, weil gefühlt alle 20 Seiten eine neue Figur ins Spiel kam, die mir relativ egal war, weil ich sie noch nicht so lange kenne wie Sunja.
Ich fand es schade, dass sie nicht mehr im Zentrum stand, sondern an die Peripherie wanderte. Mir ist schon klar, dass Autorin Min Jin Lee aufzeigen wollte, dass Rassismus und Diskrimierung (hier von Koreaner*innen durch Japaner*innen) eben nicht irgendwann aufgehört hat, sondern – solange geht das Buch – bis mindestens in die 1980er Jahre fortwirkte. Ich fragte mich trotzdem, ob man dafür die eigene Hauptfigur zur Randfigur machen muss und das recht gnadenlos. Die neuen Figuren hatten auch meist nicht so viel Zeit und Platz, sich zu etablieren, da passierte schon wieder etwas Schlimmes, das passiert ja dauernd in diesem Buch, und plötzlich waren sie weg oder auch an den Rand gewandert. Deswegen fand ich das Buch im Ganzen etwas unbefriedigend, weil ich zum Schluss das Gefühl hatte, Lee wollte einfach fertigwerden.
Andererseits: Dinge gelernt, die ich noch nicht wusste.
—
Gestern dann in einem Rutsch Juan Morenos Tausend Zeilen Lüge: Das System Relotius und der deutsche Journalismus durchgelesen. Das ist schon sehr unwiderstehlich geschrieben, auch wenn es lustigerweise Methoden einsetzt, über die das Buch sich beschwert. Nämlich der Leserin das zu geben, was sie lesen will, um sich bestätigt zu fühlen, was gerade Relotius angeblich so gut hinbekommen habe, dass er in sehr kurzer Zeit ungewöhnlich erfolgreich werden konnte.
Ich musste besonders bei einer Seite grinsen, aber das hat eher persönliche Gründe. Irgendjemand twitterte mal, ich glaube, es war wer von der FAZ, dass ihn oder sie das nerve, wenn man Pointen nicht nur dramatisch im letzten Satz verballere, sondern den auch noch im Schriftbild absetze, um es noch dramatischer zu machen. Ich muss gestehen, dass ich dieses Stilmittel auch sehr gerne in meinen Blogeinträgen eingesetzt habe, ist halt ein schöner sucker punch. Nach dem Tweet habe ich mich aber brav kritisch hinterfragt und bemühe mich seitdem, es nicht mehr so ausufernd einzusetzen.
Und dann las ich diese Seite und musste einfach gackern.
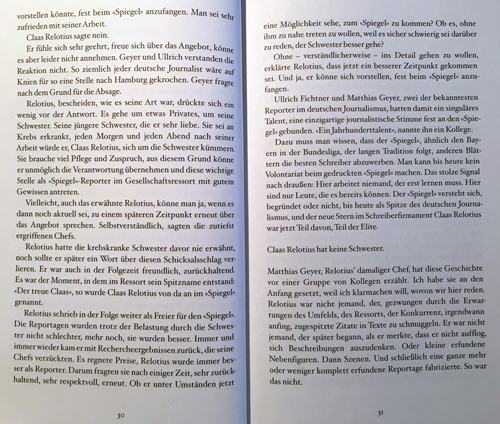
(Ja, das Bild ist klein. Mir ging es um den allein stehenden Satz, den man auch erkennen kann, wenn der Text nicht mehr ganz mühelos lesbar ist. Müsste trotzdem mal über größere Bilder im Blog nachdenken, müsste ich nicht?)
Exkurs: Was ich mir auch abgewöhnt habe, ist die Wiederholung, um Dinge zu betonen, die sehr, sehr wichtig sind (das da eben, das meine ich). „Sehr wichtig“ reicht nämlich auch, meistens reicht sogar „wichtig“. Darüber stolpere ich bei anderen jetzt dauernd.
Zurück zum Buch: Gern und ungern gelesen. Las sich halt wie geschnitten Brot, machte aber auch sehr deutlich, warum das System Relotius so gut funktionieren konnte: weil wir eher kleine Lügen anzweifeln als die ganz große, weil wir gerne Dinge lesen, die unsere eigene Weltsicht bestätigen und weil leider die üblichen Seilschaften und eigenen Karrierepläne stärker sind als die unangehme Wahrheit.
—
Als Rausschmeißer eine kleine Würdigung. Ich folge dem Historiker Patrick Bormann (@PatBorm), der sich jeden Morgen die Mühe macht, an einen Verfolgten oder Ermordeten (m/w/d) des NS-Regimes zu erinnern. F. kennt den Herrn persönlich, und immer wenn ich darüber jammere, wie sehr mich das belastet, die ganzen NS-Quellen zu lesen, erinnert er mich an Bormann, der F. sinngemäß mal gesagt habe, dass ihn das auch belastete, dass es aber nötig sei.
(Habe mich sehr zusammenreißen müssen, „Aber: Es ist nötig“ nicht als einzelne Zeile zu schreiben.)
Ich erinnere mich selbst auch oft an eine Social-Media-Aktion von Yad Vashem, die mich in ihrer Einfachheit sehr beeindruckt hat und die anscheinend noch nachwirkt. Die Gedenkstätte twitterte bzw. stellte am letzten Holocaust-Gedenktag auf Instagram Menschen vor, die Opfer der Shoah wurden. Man konnte sich einen Namen, ein Gesicht, einen Menschen zuweisen lassen und über ihn lesen und das, wenn man wollte, retweeten oder regrammen. Seitdem erinnere ich mich sehr oft an Malka Apelman, die auf ihrem Bild sehr weit weg ist von den Bildern aus Konzentrationslagern. Und das ist genau der Punkt. Die unfassbar große Zahl an Opfern wird hier heruntergebrochen auf ein einziges, und das hat ein Gesicht und einen Namen. Und immer, wenn ich die Arschlöcher von der AfD von „den Ausländern“ reden höre oder „den Flüchtlingen“, denke ich an Malka Apelmann, die irgendwann nur noch „eine Jüdin“ war, bevor sie zum Opfer wurde.
Worte sind wichtig. Und es ist wichtig, daran zu erinnern, dass aus ihnen Taten werden. Der Holocaust war nicht irgendeine historisch unvermeidbare Konsequenz, sondern etwas, das Menschen anderen Menschen antaten, ganz bewusst. Und alles begann mit Worten. Deswegen reagiere ich so allergisch auf diese Partei und habe auch keine anderen Begriffe für diese Hetzer, die ganz genau wissen, was sie tun.
Ich ahne, dass ein täglicher Tweet nichts an der Gesinnung dieser Damen und Herren ändern wird und dass Bormann vermutlich auch kaum Follower hat, die nichts von der Shoah wissen. Es macht nie Spaß, seinen täglichen diesbezüglichen Tweet zu lesen, aber ich halte es für wichtig, ihn zu schreiben und ihn zu rezipieren und sich daran zu erinnern, dass es Worte sind, mit denen alles beginnt oder mit denen alles verändert werden kann. Auch zum Schlechten, weswegen mich die ständigen Angriffe auf die Institutionen unseres Rechtsstaats etwas ängstigen. In der FAZ stand am Montag ein langer, sehr guter Artikel von Heinrich August Winkler über die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich in der Bundesrepublik bzw. der DDR der Demokratie zu nähern. Kostet leider, lohnt sich aber sehr. Ich twitterte Montag schon einen kleinen Ausschnitt davon.






