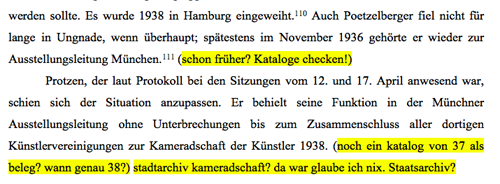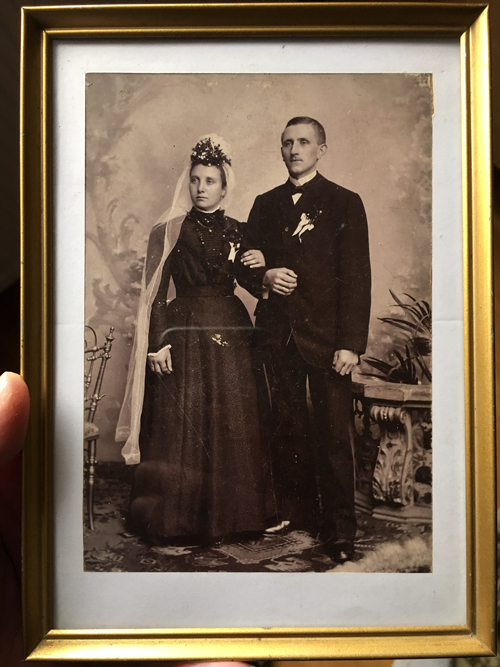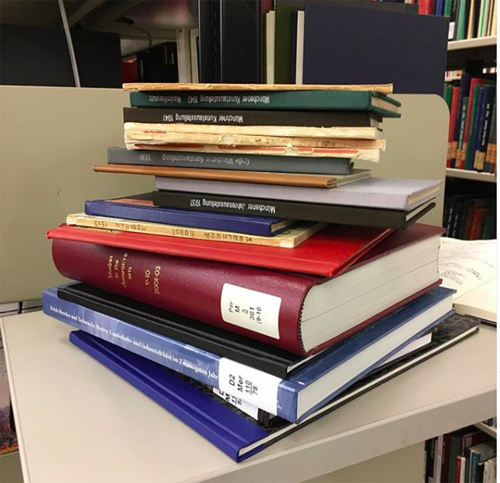1000 Fragen, 341 bis 360
341. Worüber kannst du dich immer wieder aufregen?
Ich kann mich eben nicht mehr immer wieder über irgendwas aufregen. Wenn ich das könnte, wäre Twitter entspannter. Ich will mich aber nicht mehr über jeden Scheiß aufregen, weil der meiste Scheiß nicht wichtig genug ist, um den Puls dafür in die Höhe zu jagen. Ich will auf meinem kleinen ruhigen Fluss vor mich hintreiben.
342. Kann jede Beziehung gerettet werden?
Nein. Muss sie auch nicht.
343. Mit welchem Körperteil bist du total zufrieden?
Mit meiner Supernase.
344. Womit hältst du dein Leben spannend?
Hä? Das macht mein Leben schon ganz alleine, dieses Spannendsein, dafür muss ich gar nichts machen.
345. Kannst du unter Druck gute Leistungen erbringen?
Ja.
346. Welche Lebensphase hast du als besonders angenehm empfunden?
Generell mag ich mein Leben als Spätstudentin und Teilzeitarbeiterin außerordentlich gern. Ich wollte gerade schreiben, dass ich damit vielleicht früher hätte anfangen sollen, aber dann wären die Ersparnisse noch nicht da gewesen und auch nicht der Leidensdruck von einer Million sinnloser Meetings.
347. Findest du andere Menschen genauso wertvoll wie dich selbst?
Ja. Ich finde viele von ihnen unsympathisch oder doof, aber natürlich sind sie wertvoll in ihrem Dasein.
Jedenfalls die allerallermeisten. Bei ganz wenigen muss ich mir dauernd selbst sagen, dass Gott/das Universum/das fliegende Spaghettimonster sie vielleicht als schlechtes Beispiel erschaffen haben, damit wir uns an ihnen abarbeiten und es besser machen können.
348. Hast du immer eine Wahl?
Meine spontane Reaktion auf die Frage war „Nein“, aber … hm. Ich glaube, man hat fast immer eine Wahl, wenn es um eigene Entscheidungen geht. Wenn allerdings Dinge einfach passieren – wie Krankheiten –, hat man sie natürlich nicht. Aber bei so ziemlich allem anderen kann man sich natürlich auf die beliebten äußeren Umstände berufen, um diese Entscheidung und nicht die andere zu treffen. Aber die Wahl für diese Entscheidung liegt immer noch bei einem selbst. (Das ist jetzt alles bauchgefühliges Rumtheoretisieren. Ich habe gerade kein wirkliches Beispiel. Frage auf Wiedervorlage.)
349. Welche Jahreszeit magst du am liebsten?
Frühling oder Herbst. Rest ist zu warm oder zu kalt. Hübsch sind aber alle.
350. Wie würdest du heißen, wenn du deinen Namen selbst hättest aussuchen dürfen?
Als Kind wollte ich Nicole heißen, weil das C so schick ist. Irgendwann habe ich nicht mehr über meinen Namen nachgedacht, der ist halt da. Heute finde ich ihn gut, weil es ihn nicht so irre oft gibt und man ihn kaum falsch schreiben kann. Kaum.
351. Wie eitel bist du?
Nur noch sehr wenig. Wenn ich neue Leute treffe, achte ich darauf, wie ich aussehe. Alle anderen kriegen inzwischen die sehr konsequent ungeschminkte Anke in Jeans und Turnschuhen. Meine Faszination von Kleidung an mir selbst war nie besonders ausgeprägt, und je älter ich werde, desto geringer wird sie, falls sie überhaupt noch geringer werden kann. Ich gucke aber sehr gerne andere Menschen in spannenden Klamotten an oder bewundere Frauen, die ihren Lidstrich in der Tram ziehen können. Ich bin schon froh, wenn ich mich dort beim Schalumlegen nicht selbst stranguliere.
352. Folgst du eher deinem Herzen oder deinem Verstand?
Beim Essen dem Herz, beim Schreiben dem Verstand.
353. Welches Risiko bist du zuletzt eingegangen?
Fahrradfahren im deutschen Straßenverkehr. Ansonsten bin ich eine Freundin von Risikovermeidungsstrategien, immer schön dicke Umsteigezeiten und Sitzplätze buchend.
354. Übernimmst du häufig die Gesprächsführung?
Kommt aufs Thema an. Versuche mal, mich auf mein Diss-Thema anzusprechen und guck, ob du was sagen darfst.
355. Welchem fiktiven Charakter aus einer Fernsehserie ähnelst du?
Rory Gilmore mit weniger gutem Kalorienverbrauch und ohne Häuschen am Pool. Was sinnlose Übersprungshandlungen angeht: Monica aus Friends. (“YOU DON’T KNOW THE SYSTEM!”)
356. Was darf bei einem guten Fest nicht fehlen?
Bequeme Sitzmöglichkeiten.
357. Fällt es dir leicht, Komplimente anzunehmen?
Ich glaube schon. Los, sag mir was Nettes!
358. Wie gut achtest du auf deine Gesundheit?
Kaum bewusst. Ich versuche, mich irgendwie mal zu bewegen, halbwegs anständig zu essen und generell darauf zu achten, dass es mir gut geht, aber ich habe keine Schrittzähler und hasse Vorsorgeuntersuchungen, außer beim Zahnarzt. Ich gehe erst zum Arzt, wenn irgendwas weh tut.
359. Welchen Stellenwert nimmt Sex in deinem Leben ein?
Das geht dich einen Scheiß an, Fragebogen.
360. Wie verbringst du am liebsten deinen Urlaub?
Ausschlafen, gut essen, Rest ist Verhandlungssache.