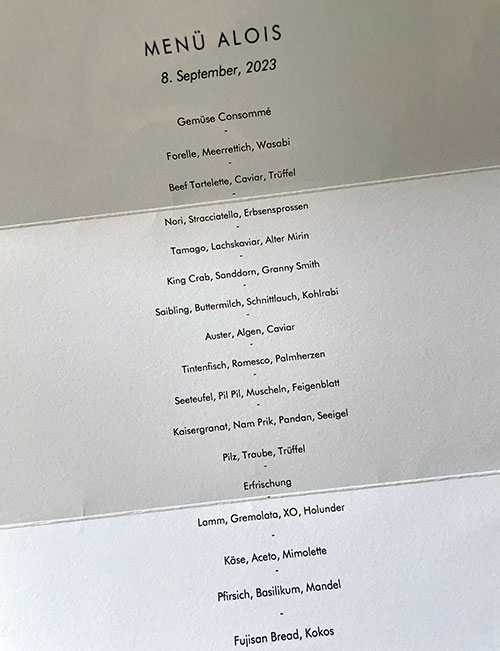Tagebuch Dienstag, 19. September 2023 – 500 miles
Okay, es waren nur 500 Kilometer, aber ein Lied namens „500 kilometers“ kenne ich halt nicht.
Ich hatte einen Termin, der gute 250 Kilometer von München weg war, und aus Gründen (zweimal umsteigen, wenige Verbindungen, zu wichtiger Termin) buchte ich nach Ewigkeiten mal wieder einen Mietwagen anstatt mich gemütlich in den Zug zu setzen.
Ich bestellte das Fahrzeugmodell, das das Mütterchen fährt, denn so, dachte ich, wüsste ich immerhin halbwegs, wie die Karre funktioniert. Aber weil man ja weiß, dass das Leben kein Wunschkonzert ist, guckte ich ernsthaft am Vorabend ein paar YouTube-Videos über Navigationssysteme der verschiedenen Hersteller – wie gehen die an, wo ist das Radio, muss man den Autoschlüssel irgendwo einstecken oder liegt der nur rum; halt den ganzen modernen Schnickschnack, von dem ich keine Ahnung habe. Wir erinnern uns: Das neueste Auto, das ich je selbst besessen habe, war ungefähr Baujahr 1992, weiß ich nicht mehr genau, und mein letztes, das ich immer noch vermisse, war sogar noch älter.
Es kam wie erwartet: „Mein“ Wagen war nicht da und so erhielt ich einen, dessen Marke ich nicht mal kannte. Ich bin noch weiter raus aus der ganzen Autogeschichte als mir bisher bewusst war. Vom letzten Mal Mietwagen hatte ich mir immerhin gemerkt, dass das Navi erst funktioniert, wenn ich nicht mehr in der Parkgarage stehe. Also ließ ich die gefühlt riesige Karre todesmutig an, erschrak ob es äußerst hässlichen Displays (Star Trek für Arme in der chinesischen Fake-Version), erklomm die Auffahrt zur Ausfahrt sehr entspannt (ich hatte neben den YouTube-Videos auch „Anfahren am Berg Automatik“ ergoogelt, weil ich wusste, dass mein Zielgebiet quasi nur aus Hügeln besteht) und fuhr draußen sofort wieder rechts ran, um das Navi anzuwerfen.
Es kannte natürlich die Adresse nicht, aber ich wusste eine, die reichen würde, um in die Nähe zu kommen. Das Radio fand ich eher durch Raten und wildes Rumtippen und weil die Göttinnen nett sind, war schon eine 80er-Jahre-Station eingestellt, die mir die Fahrt versüßen würde. Beim Losfahren merkte ich dann, dass das Navi englisch mit mir sprach, aber das war okay, ich hatte keine Lust, mich in die Tiefen der Bedienung zu stürzen, um auf Deutsch umzustellen.
Ich war nervöser wegen der Fahrt als wegen des Termins an sich, weil ich schlicht schon ewig nicht mehr lange Strecken gefahren bin. Aber das ging alles wunderbar, das Körpergedächtnis wusste noch, wie sich eine Autobahn anfühlt, und ich behaupte, die Leute rasen nicht mehr so wie früher. Ja, es gab die wenigen Fahrzeuge, die sehr plötzlich sehr nahe hinter mir waren, aber ansonsten zuckelte ich mit 120 bis 130 vor mich hin und alle anderen taten das auch. Geht doch. Tempolimit jetzt, hallo FDP, es scheinen nicht viele Menschen etwas dagegen zu haben.
Mir fiel auch wieder auf, wie wenig moderne Autos mir als Fahrerin übermitteln, wie schnell ich gerade bin, ich musste dauernd auf den Tacho gucken. Für mich fühlten sich 80 und 120 nicht großartig anders an, was mich etwas unruhig machte. Das ist zwar nett, wie wenig man Geschwindigkeit spürt, aber eben auch sehr verführerisch und gefährlich. (Oma Gröner möchte wieder in ihren ICE, wo sie bewundernd auf die Anzeige „300 km/h“ guckt.)
Die Autofahrt hatte noch andere Vorteile neben der kürzeren Fahrtzeit verglichen mit ICE, Regio und Bus, die meine Alternative gewesen wären, sowie der Flexibilität: Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren als die Fahrt (und die Texte der 80er-Songs, die ich mitsang). Daher war ich halbwegs entspannt beim Termin, aber abends dann auch komplett platt. Nach Zugfahrten bin ich nicht so matschig, wobei mich da allerdings die anderen Menschen im Waggon stressen könnten. Private Salonwagen jetzt, hallo FDP, das müsste doch genau euer Ding sein.
(Sie dürfen gerne Daumen drücken für das Ergebnis des Termins.)