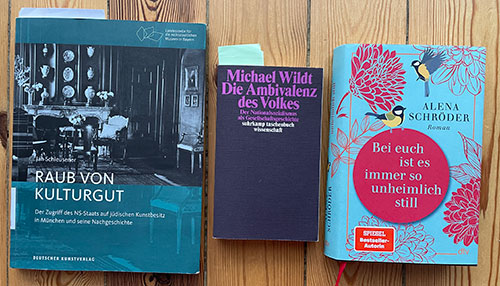Mit Turner auf Reisen
Meine letzte Amtshandlung in der Elternzeitvertretung im Lenbachhaus war ein Blogeintrag zur Turner-Ausstellung, die im Oktober eröffnet wird. Der Eintrag inklusive der meisten Zitate beruht fast komplett auf dem Buch „Turner. The Extraordinary Life and Momentous Times of J.M.W. Turner“ von Franny Moyle.
Wer mag, kann zum Lenbachhaus rüberklicken und ihn dort lesen. Wer ein paar Links zu Bildern und der Wikipedia möchte, bleibt hier:
—
Ab dem 28. Oktober zeigen wir „Turner. Three Horizons“ im Kunstbau. Die Werke von Joseph Mallord William Turner (1775–1851) erzählen auch von seinen vielen Reisen durch die Natur in Großbritannien und Europa.
Turner fiel bereits als Kind durch seine Landschafts- und Architekturzeichnungen auf, weswegen er schon mit 14 Jahren ein Stipendium an der Royal Academy of Arts in London erhielt. Dort gab es allerdings keinen Lehrstuhl für Landschaftsmalerei; sie galt erst im 19. Jahrhundert als akademische Gattung. So brachte sich der junge Turner die nötigen Fähigkeiten selbst bei, vor allem durch intensives Naturstudium. Nach und nach verließ er London für immer weitere und längere Reisen – zunächst durch England, Schottland und Wales und ab 1802 auch durch Europa.

„?Margate: The Great Beach with the Pier and Lighthouse and Jarvis’s Landing Place at Sunset“, c. 1829–40, Joseph Mallord William Turner.
© Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
Ende des 18. Jahrhunderts war Reisen eher beschwerlich als erholsam. Viele wohlhabende Bürger*innen reisten daher lieber in ihrer Vorstellung, indem sie Gemälde und Drucke mit Landschafts- oder Stadtmotiven kauften. Noch im 17. Jahrhundert zeigten diese Ansichten oft kontinentaleuropäische Szenerien. Zu Turners Zeit begann eine anhaltende Faszination für die englische Landschaft und ihre Bauten, Klöster, Schlösser und Landsitze. Das lag auch am Krieg gegen das revolutionäre Frankreich, der den Kontinent für viele britische Reisende schwerer zugänglich machte. Einer der ersten Orte, die Turner als junger Mann bereiste, war Margate im Osten Englands. Hier sah er zum ersten Mal das Meer, das ihn zeitlebens als Motiv begleiten sollte.

„Cader Idris: A Stream among Rocks near the Summit“, 1798, Joseph Mallord William Turner. © Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
Um unterwegs arbeiten zu können, trug Turner eine Art Reiseaquarellkasten mit sich. In einer kleinen Ledertasche verwahrte er Aquarelltabletten, die in Wasser aufgelöst wurden. Während frühere Künstler*innen sich ihre Farbpigmente noch selbst mischten, konnte Turner auf fertige Farben zurückgreifen, die er dann in der gewünschten Stärke anrührte. Die Skizzenbücher, die der Maler auf seinen Reisen zu Dutzenden benutzte, sind bis heute erhalten geblieben. Eine Seite aus dem Hereford Court Sketchbook zeigt den Bergrücken Cader Idris in Wales. Offensichtlich geriet Turner beim Malen in einen Regenschauer, denn die Seiten sind mit Wassertropfen übersät. Der Maler Joseph Farington schrieb in seinem Tagebuch, dass Turner 1798 in Süd- und Nordwales unterwegs gewesen sei: „alone and on horseback – out 7 weeks – much rain but better for effects.“
Im März 1802 beendete der Friede von Amiens den Zweiten Koalitionskrieg, in dem Großbritannien unter anderem gegen Frankreich gekämpft hatte. Nachdem der Ärmelkanal neun Jahre lang für Tourist*innen gesperrt gewesen war, nutzte Turner nun die Gelegenheit, nach Frankreich zu reisen. Er war nicht allein: Im September 1802 befanden sich laut eines Chronisten mindestens 12.000 britische Gäste in Paris. Auch viele von Turners Malerkollegen reisten in die französische Hauptstadt, denn seit 1793 war der Louvre ein öffentlich zugängliches Museum. Der britische Emissär in Paris beschwerte sich in London über die große Menge an Reisepässen, die er ausstellen musste – auch an Parlamentarier, die teilweise nur für einen Tagesausflug nach Calais fuhren. Turner besuchte mit Farington und anderen Freunden verschiedene Ausstellungen zu französischer Kunst, die er allerdings eher negativ beurteilte: „very low – all made up of Art.“ Damit meinte er, dass die nachrevolutionäre Kunst auf ihn sehr stilisiert wirkte und – in seinem Sinne – wenig natürlich.
Turner hatte neben Paris noch ein anderes Ziel: die Alpen. Auf dem Weg dorthin fertigte er über 100 Zeichnungen an, auf deren Grundlage in den Folgejahren mehrere Aquarelle und Ölbilder entstanden. Er berichtete Joseph Farington über seine Eindrücke der mächtigen Massive: „The country on the whole surpasses Wales; and Scotland too.“ Der Maler nahm bei der Darstellung dieser beeindruckenden Bergketten Bezug auf das philosophische Konzept des „Erhabenen“, das auf Edmund Burke zurückgeht. Laut Burke war Schönheit beruhigend, während Erhabenheit, „Sublimity“, durch Größe und Herrlichkeit fast erschreckend sein sollte. Viele von Turners Werken zeigen bedrohliche Naturgewalten, die durch seine Darstellung dennoch überwältigend schön wirken. Diese Erhabenheit wurde allerdings nicht von allen geschätzt. George Beaumont, der später Mitbegründer der National Gallery werden sollte, befand, dass einer von Turners aufgewühlten Himmeln wie „Erbsensuppe“ aussähe; ein anderer Kritiker meinte, der Himmel sei von „einem Verrückten“ gemalt worden.

„Sunset From the Top of the Rigi“, c. 1844, Joseph Mallord William Turner. © Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
Das mag auch an der Arbeitsweise des Malers gelegen haben: Turner übernahm teilweise Techniken seiner Aquarelle und übertrug sie auf seine Ölgemälde. So grundierte er die Leinwände in weißen anstatt in dunklen Tönen, damit die Farben heller strahlten. Er verdünnte Ölfarbe, um sie ähnlich verarbeiten zu können wie Wasserfarbe. Und schließlich nutzte Turner nicht nur seine Pinsel und Palettmesser als Werkzeuge, sondern bearbeitete seine Werke ebenfalls mit den Händen: Er kratzte Farbe mit den Fingernägeln ab, betupfte sie mit einem Schwamm oder auch nur seinem Hemdsärmel und trug sie neu auf. Diese aufgewühlte Atmosphäre in Form und Farbe ist vor allem in seinem Spätwerk sichtbar.

„House beside the River, with Trees and Sheep“, c. 1806–7, Joseph Mallord William Turner. © Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
1805 baute Turner ein Haus außerhalb Londons nahe der Themse, behielt aber sein Quartier im Stadtzentrum weiterhin, wo er inzwischen auch eine eigene Galerie hatte, um seine Werke zeigen und verkaufen zu können. Für das neue Haus erwarb er ein Boot, von dem aus er fischte, zeichnete und sogar malte. Auch auf seinen Reisen skizzierte Turner nicht nur sitzend oder stehend in der Landschaft. Einige seiner Entwürfe sind leicht aufsichtig und lassen vermuten, dass er arbeitete, während er zu Pferd unterwegs war. Andere Skizzen sind offensichtlich auf einem Boot entstanden, mit dem Turner Flüsse wie die Themse oder die Loire abfuhr.
Mit seinen kurzen Reisen flussauf- und abwärts in Großbritannien kompensierte Turner, dass ihm Europa durch den erneuten Kriegsausbruch zwischen England und Frankreich zeitweilig wieder versperrt war. Er schuf aus seinen vielen Skizzen und Vorzeichnungen weitere Gemälde und ließ sie auch erstmals drucken. Damit folgte er einem seiner Vorbilder, dem Maler Claude Lorrain, der seine Werke damit katalogisieren wollte. Turners Vorzeichnungen sind nicht immer detailliert, aber sie genügten stets für eine kompositorische Wiedergabe. Ein Journalist, der ihn beim Zeichnen beobachtet hatte, bescheinigte dem Maler 1866, also nach Erfindung der Kamera, ein „fotografisches Gedächtnis“.

„Sunset“, part of the Rheinfelden Sketchbook, 1844, Joseph Mallord William Turner. © Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
1816, nach der Schlacht bei Waterloo, konnte Turner wieder auf den Kontinent reisen. Er bestieg in Margate ein Schiff – „Once more upon the waters! yet once more!“ – und segelte zunächst nach Belgien, bevor er nach Köln weiterreiste, von wo er den Rhein bis nach Mainz zu Fuß erkundete. Nachdem er auf dem Fluss zurück bis Bingen gereist war, brach er nach Holland auf. Sein Rucksack blieb dabei bewusst leicht gepackt: „a Book with Leaves, ditto Cambell’s Belgium [ein Reiseführer], 3 Shirts, 1 Night ditto, a Razor, a Ferrule for Umbrella, a pair of Stockings, a Wais[t] Coat, 1/2 Doz. of pencils, 6 Cravats, 1 Large ditto, 1 Box of colours.“

„Venetian Festival“, c. 1845, Joseph Mallord William Turner. © Tate, Photo © Tate, CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)
1819 reiste Turner erstmals nach Venedig, was seine Malerei für immer verändern sollte. Der Porträtmaler Thomas Lawrence hatte in einem Brief an Farington erklärt, warum Turner unbedingt nach Italien kommen sollte – unter anderem, um die „Verschmelzung von Erde und Himmel“ in seinen unnachahmlichen Farbtönen einzufangen: „He has an elegance and often a greatness of invention that wants a scene like this for its free expansion; […] the subtle harmony of this atmosphere […] wraps every thing in its own milky sweetness.“ Turner gab die „milchige Süße“ der Lagunenstadt in einem träumerischen, zeitlosen Ausdruck wieder, der ihn zu einem modernen Maler machte. Sein Malstil veränderte sich in Italien völlig; auf einem pastelligen, fahlen Untergrund tauchten nun Schemen und Konturen flüchtig auf, wie Geister der Vergangenheit. Turner zeichnete weniger massive Gebäude oder Strukturen, sondern Luft und Raum.
In den Folgejahren reiste Turner weiterhin von Großbritannien aus nach Europa, besuchte erneut Frankreich, Italien, Belgien, Holland und die Schweiz. 1840 war er in Deutschland und skizzierte die entstehende Walhalla. Als das Monument 1842 eröffnet wurde, schuf er mehrere Aquarelle und Ölbilder nach diesen Zeichnungen. Eines davon, „The Opening of the Walhalla, 1842“, war das erste Gemälde, das Turner von England aus verschickte, um es im Ausland auszustellen. Es wurde auf der Münchner Kunstausstellung 1845 gezeigt, wo das deutsche Publikum nicht auf diese Art der Naturdarstellung vorbereitet war. Ein Kritiker bezeichnete das Bild als „unbegreifliches Kuriosum“ und schrieb, dass die angebliche „Allegorie“ auf das Bauwerk „bis zum Unkenntlichen [in ein] phantomistisch verschwimmendes Farbengemengsel getaucht“ sei und „daß der Kritik nichts übrig bleibt, als ihr Bedauern darüber auszusprechen, daß die britische Landschaftsmalerei auf so seltsame, fast komische Art vertreten wurde.“
1845 reiste der Maler ein letztes Mal nach Frankreich, um sich zu erholen. Danach blieb er, auch aus Altersgründen, weitgehend in London und Umgebung. Seit einer Cholera-Erkrankung im Mai 1850 verließ er sein Haus nur noch selten. Noch im Winter 1851 schmiedete er allerdings Reisepläne mit einem Bekannten, obwohl beide vermutlich wussten, dass der Maler diese Reise nicht mehr antreten würde.
Joseph Mallord William Turner starb am 19. Dezember 1851. Uns hinterließ er seine einzigartige Welt von Farbe und Licht.