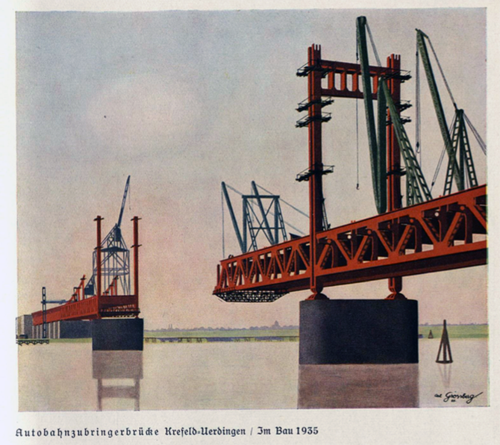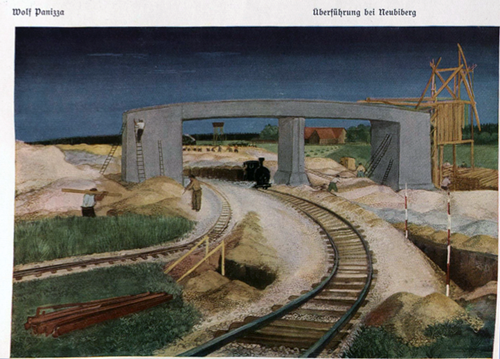Was schön war, Samstag, 7. September 2019 – Kolloquium, Tag 2
Um kurz nach 9 wieder im kunsthistorischen Institut gewesen, dem kleinen Winzladen. Normalerweise hätten wir im größeren von zwei Räumen arbeiten sollen, wie auch schon Freitag, aber es gab Probleme mit dem Institutsrechner (ach was), weswegen wir in den zweiten, kleineren Raum auswichen, was mir persönlich sehr gut gefiel. Der größere Raum ist ein doofer Schlauch, der kleinere, quadratische hingegen perfekt für unser Grüppchen aus knapp 15 Leute. Man sitzt beim Referat nicht so irre alleine da vorne wie im großen Raum, weil dort niemand in der ersten Reihe von zehn sitzen will, während es im kleinen gerade mal Platz für vier bis fünf Reihen gibt, je nachdem wie fies man die Stühle gruppiert. Und auch wenn die Luft schneller stickig wird – ich habe mich im kleinen Raum immer wohler gefühlt. So auch gestern.
Wieder fünf spannende Vorträge gehört, zu allen eine Stunde diskutiert. Zwischendurch leerte ich meine Thermoskanne mit meinem geliebten Bünting-Tee, während der Rest sich mit Kaffee und Teilchen vom Bäcker versorgte. Vorgestern hatte ich ein Sandwich dabei, was auch bitter nötig war, gestern trug ich den Jogurt wieder ungegessen nach Hause; das Frühstück aus Rührei, Bacon, Tomatensalat und Brot war anscheinend sehr sättigend gewesen.
Ich war immer noch emotional verkatert vom Abend vorher; das „Fuck“ aus dem gestrigen Blogeintrag hätte fast zu dusseligen Übersprungshandlungen geführt. Ich war sehr traurig, aber zehn Minuten mit lauter Wuselnasen, die über NS-Kunst reden, machten mir sofort wieder gute Laune. Und dann kam irgendwann eine Mail, die ich in einer Pause zwischen zwei Vorträgen las, die genau das war, was ich gestern hören musste. Ich konnte mich gar nicht so gut bedanken, wie ich es gerne getan hätte, mir fehlten irgendwie noch die Worte. Aber ich las sie gestern ungefähr 20 Mal und werde sie mir vermutlich demnächst ausgedruckt irgendwo hinlegen, damit ich sie noch 20 Mal lesen kann, wenn mein Hirn wieder „Fuck“ sagt und traurig wird.
(People. The best!)
Eine Kommilitonin kam aus Frankreich und referierte auf Englisch, und ich hatte einen instantanen Akzent-Crush bei jedem deutschen Begriff, der sich in ihren Vortrag mischte. Bei jeder Aussprache von „monuments men“ musste ich grinsen, und bei jeder Erwähnung von Rose Valland war ich sehr verliebt. Und nebenbei lernte ich, wie Frankreich mit Kollaborateur*innen im Kunstbetrieb umgegangen ist: gefühlt etwas rigoroser als wir. Je suis Jack’s total lack of surprise.
Auch das war wieder anstrengend: Wir wissen alle um die Kontinuitäten, die nicht vorhandene Stunde Null, aber wenn man es mal wieder so geballt hören muss, nervt es doch sehr. Namen, die gestern fielen und die ich euch einfach mal weiterreiche zur Eigenlektüre: Bruno Lohse, Alois Miedl, Pieter Menten.
Zum Abschluss, nach allen Vorträgen und Diskussionen, standen wir noch ein bisschen zusammen, brachten uns auf den neuesten Stand, was Beruf und Zeug anging und kamen irgendwie auf die dümmsten Sprüche, die wir uns hatten anhören müssen, wenn man sein Forschungsgebiet erwähnt. Auf meiner persönlichen Hitliste der Sätze waren: „Gefallen dir diese Bilder?“ (immer mit der Implikation, man wäre doof, wenn’s so wäre oder aber, dass einem die gar nicht gefallen dürften), „Hat das familiäre Gründe?“ (weil wir ja alle nur Großmütterchens Sammlung beschützen wollen) oder, der war mir neu: „Bitte doch mal die AfD um ein Stipendium, haha“. Eine Mitpromovierende meinte auch: „Zunächst finden alle das Thema irgendwie eklig und denken, man wäre komisch, weil man sich damit freiwillig befasst, dann wollen alle die Bilder aus der Zeit sehen, und dann sind alle enttäuscht, wenn es nur Blumenstillleben sind.“
Ich sprach noch mit einer Kommilitonin, die mit mir im Rosenheim-Seminar gesessen hatte und die es als Provenienzforscherin an ein nettes Museum geschafft hat. Zu ihr meinte ich, du hast’s gut, dich finden bestimmt alle toll, du machst ja was Anständiges, woraufhin sie sagte: „Nee, ganz im Gegenteil: Die Museen hassen mich, weil ich ihre Sammlung überprüfe, der Kunsthandel hasst mich, weil ich auf lückenlosen Provenienzen bestehe, Erben hassen mich, wenn ich sie frage, wo genau an der Ostsee der Opa denn 1942 dieses Werk „erworben“ hat, und eigentlich telefoniert man den ganzen Tag mit Amtsgerichten.“ Wieder was gelernt.
—
Um 16 Uhr zuhause gewesen, den warmen Jogurt gegessen und dann direkt auf dem Sofa bei einer Serienfolge weggenickt. Abends mit F. ein bisschen zu viel Riesling getrunken und das komplette Kolloquium nacherzählt. Gemeinsam eingeschlafen.