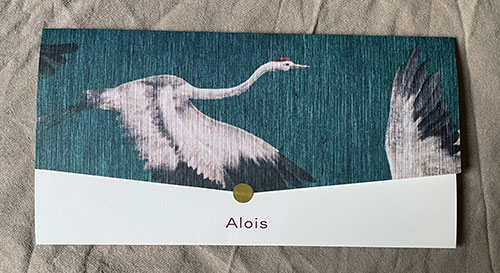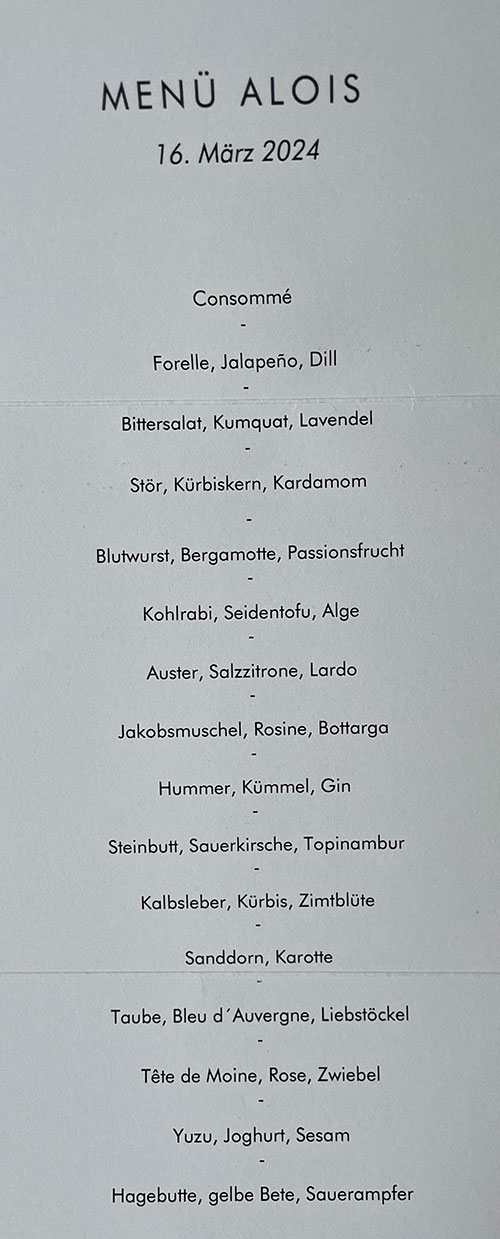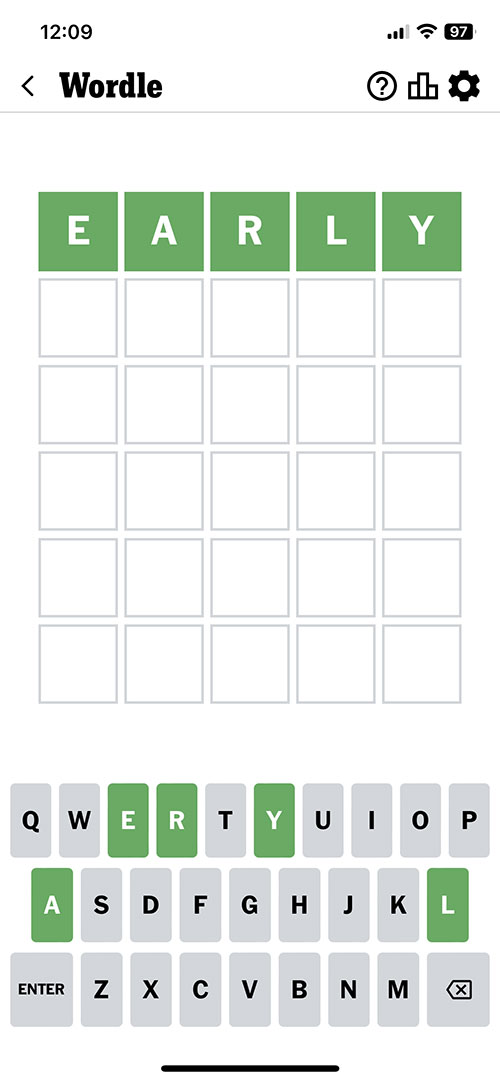Seit Anfang Januar abonniere ich die Meal Plans von Rainbow Plant Life, einem veganen Blog, ich erwähnte es bereits mehrfach, vor allem auf Instagram. Nach zehn Wochen Shoppen, Preppen, Kochen und vor allem Genießen kann ich euch diese Ausgabe sehr ans Herz legen.
Als diätgeschädigter Mensch stehe ich Essensplänen sehr kritisch gegenüber. Seit ich regelmäßig für mich koche, um gute Laune zu haben und nicht, um in einem Kalorienbudget zu bleiben, also erst seit gut 15 Jahren, mag ich die tägliche Freiheit, machen zu können, was ich will. In den ersten Jahren habe ich wahllos aus Kochbüchern und Blogs nachgekocht, angefangen bei Oliver und Mälzer, die meiner Meinung nach recht nahbare und halbwegs einfach nachkochbare Rezepte anbieten. Dann war ich irgendwann bei Ottolenghi und Seiser, die etwas mehr Erfahrung brauchen, deren Rezepte aber so gut wie immer funktionieren und mir vor allem immer schmecken. In den letzten zwei, drei Jahren bin ich in Indien, Thailand und Vietnam angelangt, wenn auch in europäischer Schärfedosierung; wenn ein Rezept fünf Chilis will, nehme ich zwei, es ist für mich immer noch scharf genug. Außerdem bin ich, keine Ahnung mehr warum, eher von Blogs weggegangen und treibe mich auf YouTube rum, um Rezepte oder Zubereitungsarten zu suchen. Dort wird mir der Algorithmus wohl irgendwann Nisha auf die Startseite gespült haben, und nach den ersten nachgekochten, veganen Rezepten bin ich ihren Videos treu geblieben.
Mein letztes Jahr war aus verschiedenen Gründen stressiger als geplant, und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich meine Mahlzeiten selber langweilen und es mir immer schwerer fällt, mal eben Rezepte aus irgendwelchen Blogs zu suchen; ich war schlicht unmotiviert und genervt vom Aufwand. Gleichzeitig war ich genervt davon, dass ich nicht mehr so gut esse wie in den letzten Jahren, also mit Lust und Spaß und Genuss im Fokus. Dass das meist vegetarisch und viel Gemüse bedeutet, ist ein netter Nebeneffekt. Ich liebe auch meinen Reiskocher und werde nicht müde, den guten Thai-Reis aus dem Asiashop kiloweise zu essen, aber meist kamen dazu nur Tofu und Gemüse und irgendeine nussige Sauce, was im Prinzip super ist, aber nach dem zwanzigsten Mal dann doch eher mau. Ich wollte aber auch nicht wieder zurück zu Büchern und Blogs, ich war einfach müde von allem, und genau in diesem Moment ploppten die Meal Plans auf.
Ich haderte mehrere Tage damit, mir wieder vorschreiben zu lassen, was ich essen soll, aber ich erinnerte mich daran, dass mir so ziemlich jedes Rezept von Nisha schmeckt und ich meist alles dafür an Gewürzen oder aromatics im Hause habe. (Ich habe keine vernünftige Übersetzung für aromatics gefunden, das ich dauernd bei Masterchef höre. Wie nennt man frischen Ingwer, Knoblauch, Chili etc. denn als Sammelbegriff auf deutsch? „Würzmittel“? „Aromaträger“?)
Also abonnierte ich den Plan mal für ein Vierteljahr, was mich 18 Dollar im Monat kostet. Dafür bekommt man wöchentlich vier Rezepte für vier Personen, genauer gesagt, drei Hauptmahlzeiten und einen Salat, der zu allem passt. Ich bereite von allem immer die Hälfte zu, wobei ich bisher noch nie zweimal dasselbe gegessen habe, sondern einmal das, was im Plan steht, und dann noch eine Mahlzeit, bei der ich übriggebliebene Komponenten bunt mische. Schon alleine das macht mir deutlich mehr Spaß als nach fünf bis sechs Gerichten pro Woche auf die Suche zu gehen, denn ich habe so quasi schon alles im Kühlschrank und vor der Nase. Und an manchen Tagen tut es auch ein Käsebrot.
Was für mich die Pläne aber noch besser macht: Es gibt erstens eine Einkaufsliste, nach Rezept oder nach Produktgruppe geordnet; ich gucke immer nach der Produktgruppe, weil ich so schneller erkenne, was ich einkaufen muss, was meistens nur frisches Gemüse ist, was ich eh kaufen würde, nur halt eher ziel- und planlos. Zu den Rezepten gibt es zweitens zwei Seiten lang Tipps: Wie kann man eine Zutat ersetzen, wie nicht, kann man Reste einfrieren, was kann man weglassen, was kann man noch addieren, um zum Beispiel mehr Protein oder mehr Grünzeug zu sich zu nehmen? Darauf komme ich gern zurück.
Außerdem gibt es drittens ein paar Tipps für die Tage, an denen man für nichts Zeit hat: Wenn dieser Schritt gerade zu lange dauert, mach doch das stattdessen. Darauf musste ich noch nie zurückkommen, daher kann ich dazu nichts sagen. Und viertens, und das ist mein Lieblingsfeature neben der Einkaufsliste, die mir alle Denkarbeit für eine Woche Leckerkram abnimmt, gibt es eine Rubrik zur Vorbereitung. Man bekommt den Meal Plan am Donnerstag, kann Freitag und Samstag einkaufen, und Sonntag wird dann ungefähr eine Stunde lang gepreppt, damit man ab Montag nur noch Dinge zusammenwerfen muss, um in sehr überschaubarer Zeit richtig gutes Essen auf dem Tisch zu haben. Oder auf dem Sofa, wo ich gerne esse.
Das sah bei mir vorletzte Woche zum Beispiel so aus:

(Seit The Bear schneide ich Schildchen brav gerade ab, anstatt sie von meiner Tesa-Krepp-Rolle einfach abzureißen.)
Ich habe rote Zwiebeln eingelegt, die jedem Gericht eine süßsaure Komponente geben, ein Korianderpesto und eine Jogurtsauce hergestellt sowie ein Dressing aus Tahini, Limettensaft, Olivenöl und der Zauberzutat Ahornsirup zusammengerührt, die mein Dressing-Game um Meilen verbessert hat. Außerdem röstete ich Süßkartoffeln im Ofen und wässerte und kochte Linsen, die danach ausgekühlt in formschöne Boxen verpackt auf ihren Einsatz warteten, um zu indischen Ofenkartoffeln mit Kichererbsen, Dal Tadka und theoretisch Tacos zu werden; meine Tacos schmeckten irgendwie meh, daher aß ich nur die als Füllung vorgesehenen Dinge mit schnell aufgebackenen Papadams, aber auch nur die Innereien waren großartig. Theoretisch kann man auch schon als Vorbereitung Gemüse kleinschneiden und Knoblauch hacken, aber das mache ich immer erst am Tag, an dem ich diese Zutaten verwenden möchte.

„Loaded Sweet Potatoes, Indian Style“

„Restaurant-Style Dal Tadka“

„Chickpea Tacos with Cilantro Pesto“
Das Schöne an den Rezepten ist, dass sie immer „shared components“ haben, man also die vorbereiteten Würzsaucen und Kleinigkeiten bei mindestens zwei, gerne bei allen Rezepten verwenden kann. Das heißt natürlich auch, etwas sinnvoller einzukaufen und weniger zu verschwenden. Wie erwähnt, koche die Rezepte für zwei Personen; manchmal schaffe ich die Menge alleine, ähem, meist bleiben Reste, die ich dann einfach anderweitig verwende oder kombiniere. Ich koche auf jeden Fall spannender und abwechslungsreicher als vorher, und das ist genau das, was ich mir von den Plänen erhofft hatte. Bisher musste ich auch kaum Dinge weglassen oder ändern; aus „kale“ mache ich allerdings inzwischen immer Spinat, denn Grünkohl ist für mich weiterhin deftiges, norddeutsches Novemberessen und kein Hipstergrün, sorry not sorry.
Was ich jede Woche spannend finde: Die Rezepte klingen erstmal total simpel, des Öfteren dachte ich auch schon, naja, so richtig aufregend wird das wohl nicht werden, aber bisher musste ich mir fast immer eingestehen, dass das doch besser war als erwartet. So wie hier:

Kicherbsen aus dem Ofen mit Knoblauchsauce, dazu Salat mit knusprig geröstetem Quinoa. Die Kichererbsen würzte ich mit Oregano, Zwiebeln, Knoblauch, Nährhefe, Salz und Pfeffer, nicht irre aufregend, dachte ich, aber okay. Diesen Spice Blend kippte ich schon am Sonntag beim Preppen zusammen und musste daher am Esstag nicht noch mit halben und viertel Teelöffeln rumhantieren. Der Quinoa war schon gekocht (gepreppt) und kam nun so weit wie möglich ausgebreitet auf ein Backblech, damit er knusprig werden konnte. Auch eher simpel. Dazu gab’s eine schlichte Jogurtsauce mit Knoblauch und Zitrone und einen Salat, hier im Bild nicht der im Rezept vorgesehene mit Brokkoli, den hatte ich schon verputzt, weil er so gut war, sondern mit Zeug, das ich halt noch im Kühlschrank hatte. Aber alleine diese simplen Gewürze und die Zubereitungsart, die aus Quinoa den totalen Knusperspaß machte, verwandelte alles in richtig gutes Essen.
Oder das hier:

Eintopf aus schwarzen Bohnen mit Sofrito, dazu Reis, eingelegte Schalotten, Koriandercreme und geröstete Kürbiskerne. Sofrito ist eine (gepreppte) Tomatensauce, die aus den schwarzen Bohnen aus der Dose einen richtig guten Eintopf machte. Und wie fast immer: Es sind die Kleinigkeiten, die ich noch darüberwerfe, die alles besser machen, hier die eingelegten Zwiebeln, die scharfe Creme und ein bisschen was zum Knabbern.
Man sollte Kichererbsen, Knoblauch und Koriander mögen, das kommt quasi dauernd dran, aber glücklicherweise mag ich alles sehr und noch wird es auch nicht langweilig, vermutlich auch, weil die Gewürzmischungen sich dauernd ändern, genau wie die Salatdressings oder die kleinen Extras. Nicht ganz so glücklich war ich bisher mit den Nudelgerichten, die aber eher selten vorkommen; das ist für mich immer die langweiligste Art, vegan zu essen. Gib mir Gemüse in lustigen Zubereitungsarten und ich bin glücklich; die Kohlenhydrate kann ich mir notfalls auch noch selbst dazudenken, falls ich nicht satt werden sollte, was noch nie vorgekommen ist.
Lustige Zubereitungsarten: gequetschte Kartoffeln.

Smashed Potatoes mit Tahinisauce, Erdnüssen und Jalapeno, dazu Salat aus Brokkoli und weißen Bohnen. Das war der Salat, den ich quasi eingeatmet habe: rohen Brokkoli im Zerkleinerer schreddern, mit Majo, Limettensaft, Ahornsirup und Sojasauce mischen, weiße Bohnen unterheben, fertig.
Lustige Zubereitungsarten: Tofu zerkrümeln für lauter Ecken und Kanten voller Gewürze:

Spaghetti mit Tahinisauce und Five-Spice-Tofu. Ein Hauch zu trocken, trotzdem gut. Bei nächsten Mal gab ich Reis und ein bisschen wässriges Gemüse zum Tofu, und den Rest des Spice Blends habe ich über Kichererbsen gegeben, ganz hervorragend.
Lustige Zubereitungsarten: Mandeln im Linsensalat. Diese Idee hatte ich bisher nicht, war sehr gut.

Ich halte mich bei den Rezepten nicht daran, dass sie vegan sind: Wenn „vegane Butter“ verlangt wird (aka Margarine, igitt), nehme ich Butter, wenn Mandelmilch verlangt wird, Kuhmilch usw. Und wenn ich noch ein Fitzelchen Aufschnitt übrig habe, weil ich Jieper auf Fenchelsalami hatte, dann kommt dieses Fitzelchen auch gerne mal in eine Sauce. Die Meal Plans waren für mich nicht dazu da, vegan zu leben (ich bin keine Veganerin und werde auch keine), sondern sie sollten mir wieder Spaß am Kochen und vor allem der Vorbereitung dazu vermitteln. Und genau das ist passiert: Mir bereitet das Preppen viel Vergnügen, weil es die Kochzeit am Esstag wirklich verringert. Und ich fühle mich total profimäßig, beschriftete Gläschen im Kühlschrank zu haben.
Guckt euch bei Insta um, ich poste eigentlich fast jedes Rezept. Ich verblogge sie allerdings nicht, weil jemand damit Geld verdient und das soll auch so bleiben. Es steckt gefühlt irre viel Arbeit in den PDFs, die man bekommt, und ich profitiere davon sehr. Und ich freue mich jeden Donnerstag auf die neuen Pläne, so wie vorgestern. Nächste Woche gibt es nämlich unter anderem „Sesame Baked Tofu with Chili-Garlic Rice“ sowie „Creamy White Bean Kale Spinach Soup“ bei mir. Das wird gut!