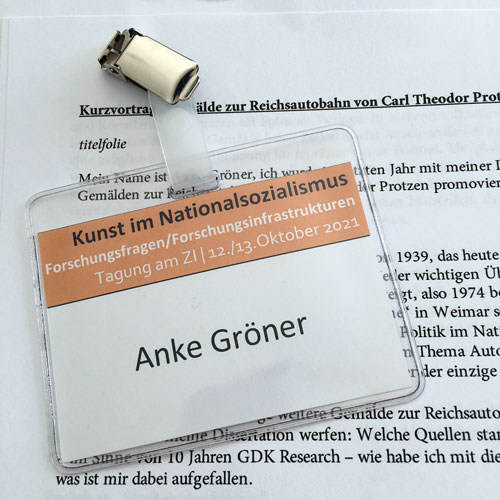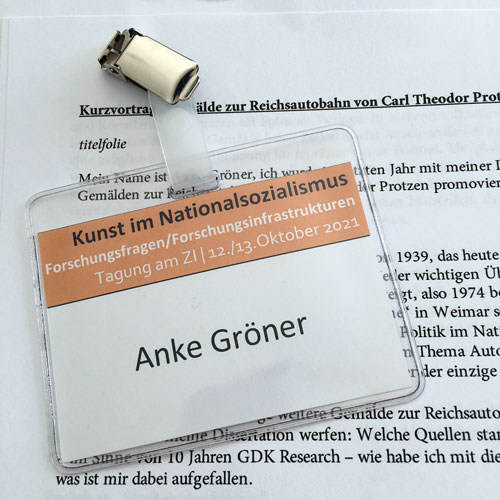In der letzten Woche verfolgte ich teils per Zoom, dann vor Ort eine Doppeltagung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Die ersten anderthalb Tage ging es um „Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder in der Kunst des Nationalsozialismus“, dann noch einen Tag um „Kunst im Nationalsozialismus – Forschungsfragen, Forschungsperspektiven, Forschungsinfrastrukturen“. Für den ersten Teil hatte ich einen Vortragsvorschlag eingereicht, der aber eher zu Recht abgelehnt wurde, da hatte ich mein Spezialinteresse (Autobahnen) einen Hauch erweitert (Autobahnarbeiter, exklusiv männlich) und ohne großes theoretisches Fundament abgegeben. Das fehlte allerdings, wie ich etwas kritisch bemerkte, auch bei vielen anderen der Vorträge und daher merke ich mir jetzt für den nächsten Call for papers: immer schön blumig bleiben, dann ist die Chance größer, angenommen zu werden.
Für den zweiten Teil bat mich mein Doktorvater um einen Kurzvortrag von lauschigen acht Minuten über mein Promotionsthema, was wir vier Vortragenden in dem betreffenden Block eine Woche vor der Tagung nochmal per Mail mitgeteilt bekamen, sinngemäß: „Ihr habt acht Minuten und dann klaue ich euch das Mikro.“ Aka: „Wir wollen alle in die Kaffeepause.“ Ich habe vermutlich wie immer zu schnell gesprochen, daher musste man mir nicht das Mikro wegnehmen.
Ich habe bei der ganzen Tagung kaum mitgeschrieben, sondern meist einfach nur zugehört, aber einiges will ich doch festhalten.
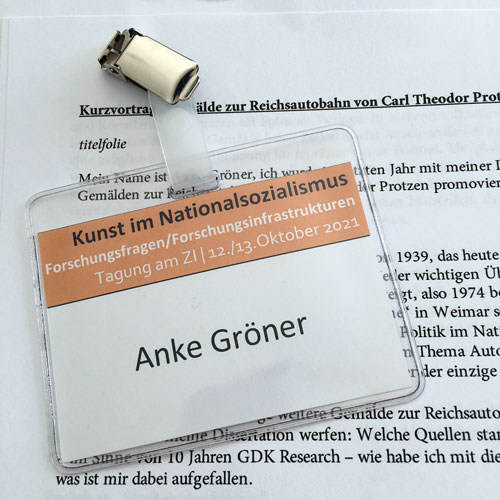
Gleich die erste Vortragende sprach über das Thema, was mich am meisten interessierte: „Die Darstellung des Arbeiters in der Industriefotografie nach 1933.“ Ich war etwas zwiegespalten nach dem Vortrag, denn er enthielt für mich nicht viel Neues, zeigte mir aber gleichzeitig, wieviel ich mir dann doch schon angelesen hatte, gerade in der Vorbereitung für die Einreichung. Die Vortragende lehrt an einer US-amerikanischen Universität und sagte den Satz, den ich mir als erstes notierte, sinngemäß: „In den USA gibt es weitaus weniger Berührungsängste mit dem Thema ‚NS-Kunst‘ und auch weitaus weniger Legitimationszwang.“ Ohne das beurteilen zu können, nicke ich das ab: Das ist immer noch schwierig zu vermitteln, warum es wichtig ist, sich mit Kunst, Werbung, Abbildungen etc. aus dieser Zeit zu befassen. Propaganda – ja natürlich. Eindeutig ideologisches Bildmaterial – muss man auch nicht diskutieren. Aber warum ich nun unbedingt was über Gemälde von Autobahnen wissen will, muss ich immer erklären.
—
Wir sprachen ganz zum Schluss noch über die Bezeichnung „NS-Kunst“ und warum sie falsch ist. Die Blumenstillleben auf den Großen Deutschen Kunstausstellungen gaukelten zwar eine unpolitische Sphäre vor, sind aber auch Stillleben, Naturalismus, Kunst aus den 1930er Jahren, Kunst des 20. Jahrhunderts, vielleicht systemkonforme Kunst des NS, aber eben keine NS-Kunst. Muss ich mir selbst auch oft genug sagen, weil es so herrlich bequem ist, einfach alles zwischen 1933 und 1945 Entstandene, das offiziell gezeigt und verkauft wurde, mit diesem halbgaren Etikett zu belegen.
—
Elisabeth Angermeier vom Stadtarchiv München sprach über vier Nachlässe aus ihrer Sammlung von Pressefotografen bzw. einer Pressefotografin. Die Fotografin war Maria Penz, die mir vorher noch kein Begriff war. Spannende Bilder und ich möchte dringend in diesem Nachlass wühlen. (Die Dame hat auch die Autobahn fotografiert.)
—
Ich lernte das Werk „Das größere Opfer“ von Adolf Reich kennen. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, auf der GDK ein großformatiges Gemälde zu sehen, auf dem ein Versehrter und eine junge Witwe zu sehen sind, aber es sagt aus: Stellt euch nicht so an in den Bombennächten, könnte noch schlimmer sein. Perfides Ding. Es hing allerdings komisch in einer Ecke mit einer Skulptur vor sich, daher blieben vielleicht doch ein paar Zweifel.
—
Ein Vortrag befasste sich mit den Frauenbildern in Frauenzeitschriften und ganz vorsichtig formuliert sind die Themen Schönheit, Kochen und Mode nicht so sehr weit weg von dem, was die „Brigitte“ uns heute noch verkaufen will. Apropos „Brigitte“: Sie geht auf die Zeitschrift „Das Blatt der Hausfrau“ zurück, das im „Dritten Reich“ unbeanstandet erschien. Wusste ich auch noch nicht.
—
Generell bot die Geschlechterthematik mir nicht irre viel Neues, aber wir stellten alle in der Diskussion eher überrascht fest, dass das Thema Mutterschaft in Kunst und Werbung nicht den Platz hatte, den wir erwartet hatten. Die Geburtenrate stieg auch trotz der tollen Mutterkreuze längst nicht so an wie von den Parteistrategen erhofft.
Für mich spannend war aber die Erinnerung daran, dass das „Dritte Reich“ kein monolithischer Block war, sondern sich veränderte, anpasste. Wo die Frau zunächst als dem Mann untergeordnet propagiert wurde, wurde sie spätestens 1939 zur Gefährtin und Schicksalsgenossin (Stichwort „Heimatfront“). So wie die Gesamtgesellschaft sich von einer angenommenen (und nicht vorhandenen, weil ausgrenzenden und rassistischen) Volksgemeinschaft entwickelte – zu einer Kampfgemeinschaft, einer Kriegsgemeinschaft, einer Schicksalsgemeinschaft und schließlich einer Opfergemeinschaft. Gerade auf letztere berief sich dann das halbe Land nach 1945.
—
Im zweiten Teil der Tagung ging es hauptsächlich um die Datenbank, auf die alle zur Kunst zurzeit des NS Forschenden vermutlich dauernd zurückgreifen: GDK-Research. Als mein Doktorvater mich im April um einen Vortrag bat, nahm ich das Thema daher auf; eine Woche vor dem Vortrag hieß es, brauchen wir doch nicht, aber ich beließ mein Manuskript wie geplant. Im Zuge der Forschung zu Protzen fielen mir nämlich durchaus einige Dinge auf, und genau die erwähnte ich im Vortrag. Ich kann ihn hier mal wieder nicht komplett publizieren, Stichwort Bildrechte, aber ich bekam positives Feedback und möglicherweise habe ich dem DHM in Berlin einen Neuzugang in der Sammlung verschafft.
Aber die Pointe meiner Arbeit kann ich jetzt verbloggen, weil die auch Teil meines Vortrags war und damit in der Öffentlichkeit ist. Daher hier ein unbebilderter Ausschnitt aus dem Vortrag, wo es ging mit Links zu Bildern:
—
Protzens Werk „Straßen des Führers“ von 1939 ist heute vermutlich das bekannteste Gemälde von ihm. Es wurde auf jeder wichtigen Überblicksausstellung zu sogenannter NS-Kunst in der Bundesrepublik gezeigt, also 1974 bei „Kunst im 3. Reich“ in Frankfurt, 1999 bei „Aufstieg und Fall der Moderne“ in Weimar sowie zuletzt 2016/17 in Bochum, Rostock und Regensburg bei „Kunst und Politik im Nationalsozialismus“. In Frankfurt und Bochum war es das einzige Werk zum Thema Autobahn, in Weimar hingen gleich vier Werke von Protzen dazu, auch hier war er der einzige Maler mit diesem Sujet.
Ein zweites Werk zum Thema Autobahn von Protzen ist die „Donaubrücke bei Leipheim“ von 1936. Es hing zwischen 2016 und 2020 im Saal 13 der Pinakothek der Moderne und dürfte daher inzwischen von mehr Menschen gesehen worden sein als „Straßen des Führers“. Anhand dieser beiden Werke sieht man schon den Spielraum, den Protzen bei seinen Werken zur RAB nutzte – von der eher neusachlichen Darstellung zur naiv-naturalistischen.
Generell lassen sich zwei Hauptmotive bei der RAB-Malerei erkennen: die fertige Strecke oder die Baustelle. Die fertigen Strecken schmiegen sich meist elegant in die Landschaft, wie hier bei Wolf Panizzas „Aufstieg zum Irschenberg“ oder Hans Neumanns „Am Seehammer See“ (im Link das erste Bild). Das war bereits eine Anforderung an die Straßenplaner. Im Gegensatz zu den italienischen Schnellstraßen, die kurz vor der RAB entstanden, sollten die Autobahnen nicht möglichst schnell von A nach B führen, sondern möglichst schön.
Ein drittes Motiv ist die menschliche Arbeit – dieses Motiv habe ich allerdings sehr selten gefunden, eher kleinformatig und meist nur in den früheren Arbeiten, hier die „Mangfallbaustelle“ von Ernst Vollbehr von 1934. Im Unterschied zur Malerei waren Menschen eher Subjekte von Fotografien.
Die häufigste Abbildung der Gemälde war das unfertige Bauwerk – die Baustelle. Die Künstler und Künstlerinnen nutzten oft Fotos als Vorlage. In mehreren Quellen kommt deutlich zur Sprache, dass diese Art Gemälde keine künstlerische Auseinandersetzung sein sollte, sondern eine möglichst genaue Abbildung im repräsentativen Format. Hauptabnehmer dieser Werke waren NS-Organisationen, Firmen, die am Bau beteiligt waren sowie die Organisationen der RAB wie zum Beispiel Raststätten oder die jeweiligen Bauleitungen der Bauabschnitte. Diese veranstalteten für die Künstler Gruppenfahrten zu den Baustellen, damit diese das Bauwerk naturgetreu abmalen bzw. Skizzen anfertigen konnten.
Trotz des immer gleichen Motivs sind stilistische Unterschiede zu bemerken. Neben eher naturalistischen Wiedergaben wie bei „Straßen des Führers“ gab es auch deutlich neusachliche Abbildungen wie Wilhelm Heises „Mangfallbrücke im Bau“, das als besonders gutes Beispiel für diese Bildgattung in diversen zeitgenössischen Publikationen herausgestellt wurde (im Link das drittletzte Bild).
Zurück zu „Straßen des Führers“. Mir standen zwei wichtige Quellen für meine Arbeit zur Verfügung. In Protzens Nachlass, der im Kunstarchiv Nürnberg verwahrt wird, finden sich vier Fotoalben: Von den dort notierten 685 Werken sind 409 als Schwarzweißfoto erhalten. Hier findet sich auch SdF, allerdings mit folgender Annotation: „Mittelstück?“ Was für mich ein Beleg dafür war, dass die Alben erst nach Protzens Tod 1956 angelegt wurden – man konnte ihn offensichtlich nicht mehr fragen.
Die zweite wichtige Quelle ist das Werkverzeichnis, dessen Kopie heute bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen verwahrt wird. Im Werkverzeichnis, das der Künstler von 1916 bis ca. 1947 führte, sind 570 Werke notiert. Protzen notierte hier ebenfalls kein Einzelgemälde, sondern ein Triptychon: Zum Mittelteil mit den Maßen 169 x 255 cm kamen zwei Seitenflügel mit den Maßen 190 x 115 cm.

(Screenshot GDK-Research)
SdF wurde nur ein einziges Mal vor 1945 ausgestellt, nämlich auf der GDK 1940, wo es auch erst als Nachhängung gezeigt wurde, es ist erst im Ergänzungskatalog verzeichnet. Es wurde für 6000 RM an die Reichskanzlei verkauft und ist damit Protzens teuerstes Werk. Es gelangte allerdings nie nach Berlin, sondern wurde bis Oktober 1943 im Haus der Deutschen Kunst verwahrt, bevor es in Altaussee eingelagert wurde. 1946 findet es sich auf einer Bestandsliste der United States Forces Austria, bevor es 1949 dem bayerischen Staat überstellt wurde. Das Werk war also im NS-Staat nur für wenige Monate auf einer einzigen Ausstellung zu sehen. Trotzdem gilt es heute als „das“ Autobahngemälde.
Im Zuge meiner Recherchen stolperte ich eher per Zufall und durch die Hilfe von Thomas Bachmann vom Staatsarchiv München über die Seitenflügel. (Hier bewusst kein Foto, da müsst ihr auf die Diss warten.) Der Mittelteil zeigt eine Baustelle – anders aber als zum Beispiel bei Heises Mangfallbrücke ist sie eingebettet in eine heimelige Landschaft. Protzen malte diese Brücke mehrfach – das Zwiebeltürmchen ist allerdings nur hier zu finden. Es stand auch nicht auf der Originalbaustelle, wie Fotos belegen. Protzen wich hier also von der Vorlage ab, was für ihn sehr ungewöhnlich war.
Gleichzeitig verknüpfte er das Motiv der Baustelle mit dem der menschlichen Arbeit, die auf den Seitenflügeln zu sehen ist. Mit ihnen gemeinsam ergibt auch die Rahmeninschrift mehr Sinn. „Rodet den Forst“ beschreibt den linken Flügel, „Sprenget den Fels“ den rechten und „Überwindet das Tal“ den Mittelteil. Die auf dem linken Flügel zu sehende rote Fahne trug im Original noch ein Hakenkreuz, wie ein Foto im Nachlassalbum zeigt. Es ist das einzige mir bekannte Triptychon einer Autobahn und auch das einzige mit einer derart programmatischen Inschrift. Es ist zudem das einzige in Protzens mir bekanntem Werk. Protzen reichte übrigens das gesamte Triptychon, nicht nur die Mitte zur GDK ein, wie Aufkleber auf den Seitenflügeln zeigen.
Für die Dissertation arbeitete ich natürlich auch mit GDK-Research. Ich nutzte die Datenbank vor allem, um nach Schlagworten wie Autobahn, Arbeiter, Straße etc. zu suchen. Meine Funde glich ich mit den gedruckten Katalogen ab. So konnte ich erstmals auflisten, wieviele – oder eher: wie wenige – Werke es zu den Reichsautobahnen auf der GDK überhaupt gab, diesem einzig genuinen Bildmotiv des Nationalsozialismus, nämlich gerade 44, wovon nur 18 größerformatige Ölgemälde waren. Sieben davon stammten von Protzen, der damit die meisten Gemälde dieses Typs auf den GDK zeigte.
—
Mein Grundgedanke während der zweieinhalb Tage war der, den ich früher immer auf den republicas hatte: „Endlich normale Leute.“ Endlich wissen alle, was man meint, wenn man GDK sagt oder RKK oder Ziegler oder Rosenberg. Man muss sich nicht für sein Forschungsinteresse rechtfertigen und hat sofort 800 Anknüpfungspunkte in jedem Gespräch.
Eigentlich bin ich ja immer noch eher menschenscheu und finde Zoom vom Sofa aus super, aber F., der olle Wissenschaftsprofi, nörgelte mich in die Präsenzveranstaltung: „Das sind deine Peers!“ Und natürlich hatte er recht. Viel mitgenommen, viel nachgedacht. Nur darüber geärgert, dass ich erst am dritten Tag dran war und daher vorher nicht so viel Rotwein in Gesellschaft trinken konnte wie erhofft.