Favorite Entries 2018
2018 revisited
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.)
1. Der hirnrissigste Plan?
Den Nachlass eines Malers in die eigene Dissertation einzuplanen, ohne vorher mal die Erben zu fragen, ob die mich da reingucken lassen.
2. Die gefÃĪhrlichste Unternehmung?
FÞr meine Handgelenke: IkeamÃķbel ohne Akkuschrauber aufbauen.
3. Die teuerste Anschaffung?
Ich wÃĪre froh, wenn es bei den sehr glÞcklich machenden Noise-Cancelling-KopfhÃķrern fÞr 250 Euro geblieben wÃĪre, aber nein, Frau Kaffeetante musste sich auch noch eine Espressomaschine fÞr 1000 Euro kaufen. Die macht zwar auch sehr glÞcklich, aber hÃĪtte ich gewusst, dass ich drei Wochen nach ihrem Kauf eine neue Wohnung mit hÃķherer Miete haben wÞrde, hÃĪtte ich sie mir verkniffen.
4. Das leckerste Essen?
Im Juli war ich im dringend nÃķtigen Spontanurlaub in Lindau im wunderbaren Villino, im November konnte mich dann Konstantin Filippou in Wien sehr erfreuen. Und jedes Caesar Dressing mit selbstgerÞhrter Majo gehÃķrt auf diese Liste.

5. Das beeindruckendste Buch?
Comic: Shit is real von Aisha Franz. Runner-up: Ein Sommer am See von Mariko und Jillian Tamaki; darÞber habe ich hier kurz geschrieben.
Sachbuch: Ganz vorne liegt Philipp Bloms Die zerrissenen Jahre, weil ich sehr viel davon mitgenommen habe und es dauernd im Blog zitieren kann. Direkt danach kommt Petra Terhoevens Die Rote Armee Fraktion: Eine Geschichte terroristischer Gewalt, die ich im Blog nicht besprochen, aber mit groÃem Gewinn gelesen habe. Und einen Ehrenplatz gibt’s fÞr Salz, Fett, SÃĪure, Hitze von Samin Nosrat, weil ich endlich wieder mit viel Lust und VergnÞgen und Neugier und Tatendrang am Herd stehe.
Fiktion: Da gab es dieses Jahr einen klaren Sieger, weil es ein vÃķllig neues Leseerlebnis war: der Ulysses von James Joyce. Ãber den Tweet des James Joyce Centre aus Dublin freue ich mich immer noch. Und Þber diesen einer Joyce-Doktorandin, der ich seitdem folge.
Deutlich bekannteres Leseerlebnis, aber Feuchtwanger geht ja immer: Exil hat mich fertiggemacht. Auch kein SpaÃ, aber wichtig: Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Ich habe bestimmt auch zeitgenÃķssische Fiktion gelesen, aber da war anscheinend nichts ÃberwÃĪltigendes dabei. Die Klassiker wissen schon, warum sie Klassiker sind.
6. Der ergreifendste Film?
Ich war nur einmal im Kino und habe Ex Libris gesehen und gemocht. DafÞr war ich Ãķfter im Theater, wo mir besonders Alles klappt und Philipp Lahm gefallen haben. Bonuspunkt fÞr den RÃĪuber Hotzenplotz in der Augsburger Puppenkiste!
7. Die beste CD? Der beste Download?
Ha, kurz vor Jahresende wirklich mal wieder eine CD gekauft bzw. sogar gleich zwei, und zwar von Bohuslav MartinÅŊ. Die waren dann wohl auch die besten.
Runtergeladen habe ich keine MP3-Sammlung, aber dafÞr versacke ich dank Amazons Prime Video, das ich als Studi fÞr ein Jahr gratis bekommen habe, nicht mehr ausschlieÃlich vor Netflix. Slow clap.
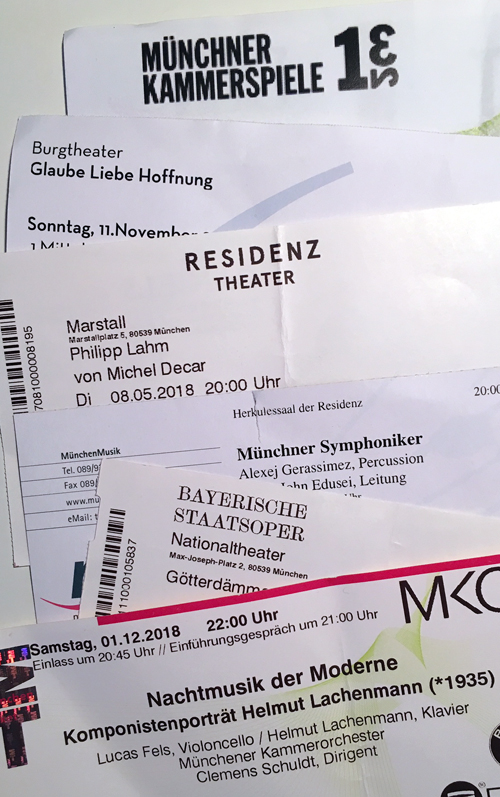
8. Das schÃķnste Konzert?
Da kann ich mich nicht entscheiden. Die 100 Metronome im Januar waren toll, genau wie Sol Gabetta im MÃĪrz (daher die Begeisterung fÞr MartinÅŊ) und die Nachtmusik der Moderne mit Helmut Lachenmann erst vor wenigen Wochen im Dezember. Hat alles meinen Horizont sehr erweitern kÃķnnen.
9. Die tollste Ausstellung?
Auch gut fÞr den Horizont (und die Diss, falls ich jemals an ihr weiterarbeiten sollte): die NeuhÃĪngung der Kunst aus den 1930er Jahren in der Moritzburg in Halle. Sehr gefreut habe ich mich Þber Basquiat in der Schirn in Frankfurt, weil ich mir erst durch diese Retrospektive sein Schaffen und seine Bedeutung etwas klarer wurden, genau der gleiche Effekt wie vor ein paar Tagen bei JÃķrg Immendorff in MÞnchen. Die Videoausstellung Generations â KÞnstlerinnen im Dialog im Haus der Kunst hat mir gezeigt, dass ich anscheinend doch mit Videos klarkomme, um die ich mich sonst gerne drÞcke. Und die Bruegel-Ausstellung in Wien war schlicht einmalig. Das werde ich so nie wieder sehen kÃķnnen.
10. Die meiste Zeit verbracht mit …?
DarÞber zu staunen, dass dieses Werbeding, von dem ich quasi fÞnf Jahre Pause gemacht habe, nach kurzem Anlaufstottern wieder ziemlich gut lÃĪuft â und vor allem auch wieder richtig Spaà macht.
11. Die schÃķnste Zeit verbracht mit …?
Die neue Wohnung schÃķnzupuscheln, jedenfalls gefÞhlt. Das hat mich die Monate seit September doch mehr in Beschlag genommen als ich dachte. Aber jetzt ist alles wunderhÞbsch.
So ziemlich jede Zeit mit F. ist die schÃķnste. Und die alleine auf dem Sofa mit dem Laptop oder in der Bibliothek mit den BÞchern auch.
Ich habe mich auÃerdem darÞber gefreut, dass meine Eltern mich mal hier unten besucht haben, und habe auch dabei viel gelernt.
12. Vorherrschendes GefÞhl 2018?
Geht doch.

13. 2018 zum ersten Mal getan?
Im Burgtheater Wien gewesen. In Halle gewesen. F. die Wedemark gezeigt. Alleine in einem Sternerestaurant gegessen. Eine Wohnung mit einem benutzbaren Balkon besessen. Ein Special-Interest-HaushaltsgerÃĪt gekauft, das mehr gekostet hat als die meisten meiner Autos, siehe oben. Die Augsburger Puppenkiste besucht. Die Fuggerei besichtigt. In Hamburg an der Texterschmiede gelehrt. An einem Doktorandenseminar teilgenommen. Wildschwein gegessen. Eine FuÃballdauerkarte besessen. Okay, immer noch keine mit meinem Namen drauf, aber im Gegensatz zur letzten Spielzeit, wo ich sie nur halb hatte, gehÃķrt sie mir gerade fÞr die ganze Saison.
14. 2018 nach langer Zeit wieder getan?
RegelmÃĪÃig mit Werbung Geld verdient. Wieder im eigenen Bett geschlafen und nicht auf einem Bettsofa. Ein eigenes Arbeitszimmer gehabt; das ist wirklich lange her, dass ich schon mal eins hatte, ich glaube, so um die 20 Jahre. Im Sprengel-Museum und den HerrenhÃĪuser GÃĪrten in Hannover gewesen. Durch die wiedererÃķffnete Hamburger Kunsthalle gesprintet. In einem Planetarium gestaunt. Den (fast) kompletten Ring gesehen; beim Siegfried war ich leider krank.
ZÃĪhlt Wahldienst nach einem Jahr? ZÃĪhlt in Wien gewesen zu sein nach zweieinhalb Jahren? Ein Umzug nach drei? Wann ja, dann das auch.
15. Drei Dinge, auf die ich gut hÃĪtte verzichten kÃķnnen?
Alte DÃĪmonen. Die AfD in allen LÃĪnderparlamenten. Die Absage der Grossberg-Erben.
16. Die wichtigste Sache, von der ich jemanden Þberzeugen wollte?
So schnell renne ich nicht weg.
17. Das schÃķnste Geschenk, das ich jemandem gemacht habe?
Nicht wegzurennen.
18. Das schÃķnste Geschenk, das mir jemand gemacht hat?
UngefÃĪhr 800 Flughafentoblerones und geduldiges LampenandÞbeln.
19. Der schÃķnste Satz, den jemand zu mir gesagt hat?
âWeil du da bist.â
Runner-up: âBrauchst du Hilfe beim Umzug?â
20. Der schÃķnste Satz, den ich zu jemandem gesagt habe?
âIch hol dich nicht vom Flughafen ab.â
21. 2018 war mit einem Wort …?
Gut.
—
What Anke Ate in 2018
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)
Mein Foodcoaching war 2009, ich ruiniere mir hier also gerade selber einen schÃķnen JubilÃĪumseintrag fÞrs nÃĪchste Jahr. Aber ich mÃķchte einen einzigen Neujahrsvorsatz fassen, der sich in den letzten Wochen immer mehr manifestiert hat: Ich mÃķchte Kochen ein weiteres Mal neu lernen.
2009 habe ich quasi essen neu gelernt: weg von dem kalorienreduzierten FertigmÞll, der nach nichts schmeckt, ran an den eigenen Herd, um Þberhaupt mal rauszufinden, was mir eigentlich schmeckt auÃer Schokolade. Ich betrachte diese Phase als ÃĪuÃerst erfolgreich, aber noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe mich mit groÃer Begeisterung auf KochbÞcher und Kochblogs gestÞrzt, habe versucht nachzukochen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Daraus ist ein kleiner Grundstock an Rezepten geworden, die ich inzwischen selber hinbekomme, manche auch aus dem Handgelenk, bei anderen lese ich immer wieder nach â auch deswegen verblogge ich Rezepte. Das hier ist meine Sammlung an Dingen, die ich mag.
Mir fiel aber immer Ãķfter auf, dass ich weiterhin nur nachkoche â im Sinne von: Ich befolge Rezepte, weià aber gar nicht warum. Daher ist das jetzt mein erster Schritt vor dem zweiten, den ich schon gemacht habe: Ich mÃķchte die Basics lernen. Das heiÃt zum Beispiel, mal zu lernen, wie man einen Fisch filetiert, um nicht wie gestern zum hundertsten Mal an der Fischtheke zu stehen und irgendein Filet zu kaufen, sondern einen ganzen Fisch, dessen Teile werde ich dann verwerten und aus dem Rest wird ein Fond gekocht. Das habe ich nÃĪmlich auch bis heute nicht gemacht, nicht mal aus GemÞse, was allen Kochblogs zufolge echt nicht so schwierig sein sollte.
Generell werde ich weiterhin wenig Fleisch und Fisch essen, ich mÃķchte aber nicht ganz darauf verzichten. Und auf Milchprodukte schon gar nicht. Ich will aber selber schweren Herzens von meinem bequem zu erreichenden Metzger nebenan Abschied nehmen und zum Biometzger gehen, der mir vermutlich eher sagen kann, wo die hoffentlich glÞckliche Kuh gelebt hat und wo sie mÃķglichst schonend geschlachtet wurde, bevor aus ihr mein BratenstÞck wurde. Neulich lÃĪsterte ich Þber den Menschen, der mir eventuell die Zeitung klaut, dass, wer sich die Miete hier leisten kann, sich auch die FAZ kaufen kÃķnne. Das gilt auch fÞr mich: Ich kann mir das teure Fleisch leisten. Und wenn es mir zu teuer ist, dann esse ich es eben nicht. Das ist der einzige Zwang, den ich mir beim Essen wieder auferlegen will. Allen anderen ZwÃĪngen und Vorschriften, was meine ErnÃĪhrung angeht, habe ich 2009 abgesagt, und es hat mein Leben wie keine andere Entscheidung sehr zum Positiven verÃĪndert.
Und jetzt schmÃķkere ich weiter in meinem neuen Kochbuch, aus dem ich mir gleich drei Dinge fÞrs SilvestermenÞ ausgesucht habe. Die Vorbereitungen gestern haben mir schon viel Freude gemacht, und ich weiÃ, dass ich mich mit der gleichen Freude immer wieder an den Herd stellen werde. Ich kann der Frau Lu gar nicht oft genug dafÞr danken, was sie alles in einer Woche im August 2009 in mir angestoÃen hat.
























—
Was schÃķn war, Montag, 24. bis Mittwoch, 26. Dezember 2018 â Weihnachten (ach was)
Den Sonntag, 23. Dezember, mit dem grauenhaften Spiel in Augsburg und der Niederlage in der letzten Minute lasse ich einfach mal weg. Immerhin gab’s abends noch Geschenkeaustausch zwischen F. und mir. Very happy!
—
Montag am spÃĪten Vormittag in der S-Bahn zum Flughafen gesessen. Lufthansa war gÞnstiger als die Deutsche Bahn, daher gÃķnnte ich mir den zweiten innerdeutschen Flug in diesem Jahr. Der erste war im Januar gewesen, und mit dieser CO2-Bilanz kann ich als autofreier Mensch leben.
In der S-Bahn glotzte ich mÃķglichst unauffÃĪllig die zwei Herren an, die mir gegenÞber saÃen. Beide schienen asiatische Wurzeln zu haben, kannten sich nicht, saÃen nur zufÃĪllig nebeneinander, aber ich mochte an beiden so viele kleine Details, dass ich hoffentlich nicht zu aufdringlich geschaut habe. Der eine Herr hatte schon leicht ergraute Haare, eine runde Brille mit sehr dicken BÞgeln, was sehr gut zusammenpasste. Unter seiner schwarzen Hose zeichneten sich krÃĪftige Oberschenkel ab, die deutlich nach Muskeln und nicht nach Fett aussahen (nicht, dass letzteres nicht auch vÃķllig okay gewesen wÃĪre). Vielleicht ist er ein leidenschaftlicher FuÃballspieler. Der zweite Herr trug einen hellbraunen Wollmantel Þber schmalen schwarzen Hosen und einem schwarzen Pullover; seine halblangen Haare fielen ihm dauernd in die Stirn, was ich gut beobachten konnte, weil er meist die Augen geschlossen hatte, als er seinem Handy per In-Ears lauschte.
Ich vermisste an mir mal wieder die FÃĪhigkeit, schlichte Klamotten so zu kombinieren, dass sie effektvoll aussahen und nicht nur langweilig â oder generell die FÃĪhigkeit, Kleidung fÞr mich auszusuchen, die etwas Þber mich aussagt anstatt dass sie einfach nur halbwegs passt. DafÞr muss ich als dicker Mensch ja schon dankbar sein, weswegen ich mir mehr gar nicht zutraue. An den meisten Tagen im Jahr ist mir Kleidung egal, weil ich fÞr sie einfach kein HÃĪndchen habe, an manchen finde ich es schade, dass eben das so ist. Aber so wichtig, dass ich mir dabei Hilfe holen mÃķchte, ist es dann auch wieder nicht.
—
Ein pÞnktlicher Flug nach Hannover. Der KapitÃĪn lieà den Kindern an Bord ausrichten, dass das Christkind erst abends kÃĪme, wenn es dunkel ist, was niedersÃĪchsische Kinder vermutlich eher verwirrt hat, denn bei uns bringt der Weihnachtsmann den Krempel und nicht das Christkind. Schwesterchen und Schwager holten mich und mein bewusst sparsam gepacktes KÃķfferchen ab, wir tranken bei ihnen noch zwei Kannen grÞnen Tee, bevor sie mich zu meinen Eltern fuhren. Dort gab es die ersten Kekse von gefÞhlt zwei Kilo, die ich in den letzten Tagen zu mir genommen habe, und alles war gut.
Mein pragmatischer Papa hatte den Baum geschmÞckt, der ein Ast einer riesigen WeiÃtanne war, die im Niemandsland zwischen unserem und dem NachbarsgrundstÞck wÃĪchst, weswegen sich die GrÃķners und die Nachbarn den teilen.

Um 18 Uhr ging’s in die Kirche, wo mich der glockenhelle Sopran meiner Schwester Þberraschte, die sonst immer eine Oktave tiefer bei den Liedern mitbrummt.
FÞr ein TomatensÞppchen, das ich am Mittwoch zum Mittagessen kochen sollte, hatte meine Mutter Gin besorgt. Gin? Wir haben doch nie Gin im Haus! Und dann natÞrlich kein Tonic Water. Und auf dem Dorf keine Tanke, bei der man eben mal vorbeikann. GroÃstadtvermissung! Aber wozu habe ich das Internet? Gefragt, was ich aus Gin und nix mixen kann und viele gute Tipps gekommen. Es ist dann die Kreation Gin, Ananassaft (siehe einen Absatz weiter unten), Triple Sec und Mineralwasser geworden, und aus Verbundenheit zu meinen ostpreuÃischen Vorfahren habe ich den Drink âThe Schlubbercheâ getauft. OstpreuÃen, Ananas, das drÃĪngt sich ja geradezu auf.
—
Keiner hatte Lust auf ein groÃes Festmahl gehabt, ich auch nicht, also hatte der kochbegeisterte Schwager Toast Hawaii vorbereitet â natÞrlich nicht einfach nur Kochschinken und Gouda, sondern drei verschiedene Schinkenarten plus drei verschiedene KÃĪsesorten. Ich hatte nachmittags schon den Tipp fÞr Estragonsenf weitergegeben, und so fand sich auf einigen Toasts auch ein bisschen Senf. Bitte mal merken: Wacholderschinken mit GruyÃĻre! Der Knaller! ZugegebenermaÃen ohne Ananas noch besser.
Als Nachtisch gab’s den traditionellen Nachtisch, mit dem meine Schwester und ich groÃgeworden sind: Milchreis auf SchÃĪlchen verteilt, in zwei SchÃĪlchen am Tisch verstecken sich jeweils eine Haselnuss und eine Mandel, und wer eine von beiden findet, bekommt ein kleines Geschenk. In diesem Jahr waren Mama und Papa die glÞcklichen Gewinner. Neulich las ich irgendwo, dass man als Erwachsene bitte aufhÃķren sollte, die Eltern mit derartigen Kosenamen zu bezeichnen, das mache man doch nur als Kind. Sehe ich ganz anders. Meine Mutter bleibt immer meine Mama, auÃer wenn es im Blogeintrag zuviele Wortwiederholungen gibt, und ich werde auch als fast 50-JÃĪhrige nicht anfangen, zu meinem Papa âVater, gibt’s du mir bitte mal die Butter?â zu sagen.
Nach dem Essen brachte ich das GesprÃĪch unvorsichtigerweise auf meine Diss und die Malerei zur Reichsautobahn, woraufhin Mama einfiel, dass es in der Wedemark auch noch Reste von BrÞcken gibt, aus denen nie eine StraÃe geworden war, was dazu fÞhrte, dass die ganze Familie um Landkarten der Umgebung rumsaÃ, man Artikel aus LokalblÃĪttchen vorlas und ich ein Spontanreferat Þber die kÞnstlerische Begleitung des Propagandaprojekts in Form von GemÃĪlden, Romanen und Filmen sowie die regional unterschiedlichen Bauweisen von BrÞcken und RaststÃĪtten hielt.
—
Kurze Bescherung, wir schenken uns seit Jahren nichts bzw. immer das gleiche. Dieses Mal hatte ich immerhin eine kleine Ãberraschung dabei, denn F. hatte mir Pralinen aus einem Kaffeehaus in Augsburg mitgegeben, in dem wir im Oktober alle gemeinsam gewesen waren, worÞber sich alle sehr freuten. Mir hatte er vorher schon eine kleine Auswahl an Nougats mitgebracht, und seitdem ich die genossen habe, will ich den Onlineshop leerkaufen. So gut!
Danach standesgemÃĪÃes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich habe haushoch verloren.
—
Am Dienstag literweise gemeinsamer Tee mit den Eltern, ewig den VÃķgeln vor dem KÞchenfenster zugeguckt, die sich in ihrem Bad vergnÞgten oder die MeisenknÃķdel leerfutterten. Rumgelungert, angenehme GesprÃĪche gefÞhrt, dem im 15-Minuten-Abstand folgenden Dialog meiner Eltern zugehÃķrt â âLegst du bitte noch was aufs Feuer?â âHab ich grad.â â, NachmittagsschlÃĪfchen gemacht im alten Kinderzimmer, mich Þber meine eigene Wohnung gefreut, abends zum Schwesterchen spaziert und dort Salat, Wildschweinbraten und natÞrlich Welfenspeise vorgesetzt bekommen. Wildschwein war der Wunsch meiner Mama, ich wollte das noch nie essen und weià jetzt auch, dass einmal reicht. Aber die Preiselbeeren waren super.
StandesgemÃĪÃes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich war bis zum letzten Spiel Vorletzte, aber dann hat Papa mich noch Þberholt.
—
Mittwoch die alten Bilder im Bettkasten durchgewÞhlt, weil ich wusste, dass da das alte Foto meiner Oma gerahmt lag. Das hatte ich in Hannover in meiner Wohnung in der KÞche hÃĪngen gehabt, beim Umzug nach Hamburg kam es dann wieder zu meinen Eltern und da lag es jetzt 20 Jahre. Gestern wickelte ich es dick in die FAZ ein, die ich aus MÞnchen hergeschleppt hatte (ich wusste gar nicht, dass am 24. noch eine Zeitung kommt), verstaute es zwischen zwei Lagen Klamotten im Koffer, darauf kamen acht Kilo Kekse und SÞÃigkeiten und noch vier SÞÃweinglÃĪser, ca. Jahrhundertwende, die meine Mutter loswerden wollte. Ich hatte noch keine SÞÃweinglÃĪser, ich nahm die mal fÞrsorglich unter meine Fittiche. Danke FAZ, danke Klamotten, alles heile in MÞnchen angekommen.

Das Bild ist von 1935. Ja, wir kÃķnnen Þber Motiv und Bildauffassung reden. FÞr mich ist es zuerst ein Foto meiner Oma und dann erst ein kunsthistorisches Zeugnis seiner Zeit. Aber ja, wir kÃķnnen Þber Motiv und Bildauffassung reden.
Dann wÞhlte ich mich durch Mamas Rezeptbox, in der sich Zeitungsausschnitte aus 40 Jahren wiederfinden mit Rezepten, die sie nie gekocht hat. Aber auch selbstgetippte oder beschriftete Karteikarten. Ich ÃĪrgere mich seit Jahren, dass ich die Rezepte von Omi nicht mehr erfragen kann, also bat ich um alles, was vielleicht noch da war. Ich fand immerhin den Biskuitteig und die Buttercreme, woraus ich Omis Frankfurter Kranz nachbauen kann. Und diese Karte mit ihrer Handschrift, von Mama mit halbwegs korrekten Mengen- und Zeitangaben ergÃĪnzt, denn Omi kochte eben aus dem Handgelenk. Auf Instagram haben andere Anmerkungen ihrer GroÃmÞtter angelegt.
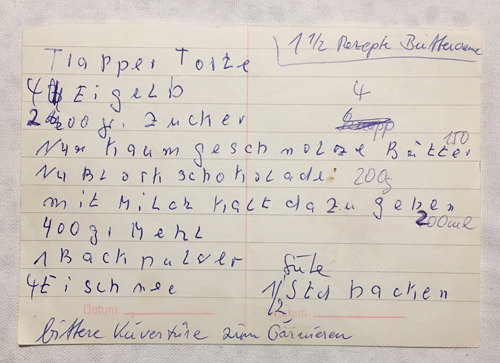
Ich habe keine Ahnung, was eine Trappertorte ist und Google weià es auch nicht. Ich werde das einfach mal backen.
—
PÞnktlicher Flug nach Hause. Wie auch auf dem Hinflug war der bewusst gebuchte Platz in der letzten Reihe eine gute Wahl, denn ich hatte beide Male zwei freie Sitze neben mir. Auf dem Weg nach Hannover war ich noch mit Philipp Bloms Der taumelnde Kontinent: Europa 1900â1914 beschÃĪftigt, seinem VorgÃĪngerwerk zu Die zerrissenen Jahre: 1918â1938
; letzteres habe ich im Blog schon mehrfach empfohlen und es wird euch auch im JahresrÞckblick wieder begegnen. Der Kontinent eher nicht, das war noch nicht so schÃķn geschlossen wie der Nachfolger. Es war mir zuviel Klein-Klein, jedes Kapitel franste vÃķllig aus, auch wenn Blom es auf der jeweils letzten Seite wieder zusammenfasste, aber ich habe mir weitaus weniger gemerkt oder merken wollen als bei Jahre. Trotzdem gern gelesen.
Auf dem RÞckflug las ich bereits mein Weihnachtsgeschenk an mich und an F.: Stefan Zweigs Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines EuropÃĪers, das 1942 posthum erschienen ist. Aus diesem Buch hatten wir bei der Diskussion im Burgtheater im November einen kleinen Ausschnitt gehÃķrt, und seitdem wollte ich es lesen. Schon das Vorwort beschreibt in wenigen SÃĪtzen sehr deutlich, worum es geht:
âIch bin aufgewachsen in Wien, der zweitausendjÃĪhrigen Þbernationalen Metropole, und habe sie wie ein Verbrecher verlassen mÞssen, ehe sie degradiert wurde zu einer deutschen Provinzstadt. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine BÞcher Millionen von Lesern sich zu Freunden gemacht. So gehÃķre ich nirgends mehr hin, Þberall Fremder und bestenfalls Gast; auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwÃĪhlt, Europa, ist mir verloren, seit es sich zum zweitenmal selbstmÃķrderisch zerfleischt im Bruderkrieg.â
(Hoch die Republik!)
Ich las also, bis ich mein GetrÃĪnk und meinen Snack hatte, dann stÃķpselte ich die geliebten Noise-Cancelling-KopfhÃķrer ein (totale Empfehlung â und gerade Þber 100 Euro gÞnstiger als im Februar, als ich sie gekauft habe, na danke auch) und hÃķrte Klassik, was mit normalen KopfhÃķrern im Flugzeug nie mÃķglich gewesen war, zu laut alles.
Seit ich im MÃĪrz Sol Gabetta ein Cellokonzert von Bohuslav MartinÅŊ habe spielen hÃķren, habe ich den Mann dauernd auf den Ohren. Den Namen kannte ich vorher nicht, aber er ist seit Monaten die Go-to-Playlist, wenn ich Klassik hÃķren will. So auch gestern. Ich guckte dem dramatischen Sonnenuntergang zu, den ich niemals vernÞnftig fotografieren kÃķnnte. Kurz vor MÞnchen ging das Flugzeug dann in eine satte Kurve, und genau in dem Moment, in dem die TragflÃĪche wieder parallel zum Horizont stand, erklang ein majestÃĪtischer Dur-Akkord im zweiten Satz und das war wieder einer dieser Momente, wo man total pathetisch denkt, wie groÃartig doch alles sein kann. (War’s halt.)

—
In der S-Bahn gab’s dieses Mal nichts zu gucken, aber dafÞr auf Instagram. Ich liebe solche Clashes. Die untere Welle ist bekanntlich die von Hokusai.

Ich hÃķrte Spotify, weil ich wieder Internet hatte, und freute mich auf zuhause. Dort packte ich meinen Koffer aus, brauchte gefÞhlt 20 Minuten, um das ganze Zuckerzeug wegzurÃĪumen, freute mich Þber Omas Bild und stellte es erstmal auf den FuÃboden im Flur, wo es bald neben Leo von Welden hÃĪngen wird. Dann kochte ich mir Tee in Omis Teekanne, dachte Þber Familie nach und wie nett die letzten Tage waren und wie froh ich bin, dass unser VerhÃĪltnis inzwischen gut ist und nicht nur irgendwie auszuhalten, wickelte mich in meine Kuscheldecke, vermisste F., las, trank Tee, klickte im Internet rum und war’s zufrieden.
—
Tagebuch Mittwoch, 12. Dezember 2018 â SchÃķner Alltag
Gemeinsam aufgewacht. Den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht und konzentriert gearbeitet. Mich dabei Þber guten Tee, die schÃķne Sternenlichterkette im Fenster, das winzige WeihnachtsbÃĪumchen auf dem Tisch (Gastgeschenk vom Samstag) und viele Ideen gefreut. Davon hÃĪtte ich heute gerne nochmal dasselbe. Das gemeinsame Aufwachen hat schon mal geklappt. Gib alles, Universum!
—
In der Mittagspause meine Alugrafie von Leo von Welden vom Rahmen abgeholt. Ich beschrieb letzte Woche das ausfÞhrliche und kenntnisreiche BeratungsgesprÃĪch, und jetzt wo ich den Welden gerahmt vor mir sehe, kann ich den Laden sehr weiterempfehlen: Das war die winzige Werkstatt Bild & Rahmen in der SchleiÃheimer StraÃe (keine Website, daher die eher unaussagekrÃĪftige Yelp-Seite).

Gestern war es schon zu dunkel, um es anstÃĪndig an der Wand zu fotografieren, an der es demnÃĪchst hÃĪngt, deswegen steht es hier auf einem Stuhl im Flur und kriegt kÞnstliches Licht ab. Das Hintergrundpapier ist dunkelgrau, nicht schwarz, was das Schwarz der Alugrafie noch dunkler wirken lÃĪsst, und ich bin wirklich froh Þber die Rahmenwahl. Der ist zwar brandneu, sieht aber nicht so aus, und das passt gut zum Stil des Bildes. Auch dass man die nicht gerade untere Kante sieht, weil die Rahmerin mir ein Passepartout ausgeredet hat, gefÃĪllt mir auÃerordentlich gut. Ich habe fÞr die Arbeit mit Material und allem 159 Euro bezahlt und finde das sehr gerechtfertigt.
—
Ich wartete den ganzen Tag auf ein DHL-Paket, das nicht in eine Packstation geliefert werden konnte. Erst als ich um 19 Uhr fettglÃĪnzend am Herd stand, klingelte es. DafÞr dass der Lieferant vermutlich schon sehr lange unterwegs war, hatte er bemerkenswert gute Laune. DankeschÃķn!
—
Abends hatte sich F. zum gemeinsamen Essen angekÞndigt. Inzwischen habe ich mich in Salz. Fett. SÃĪure. Hitze weiter vorgearbeitet â okay, und ein bisschen vorgeblÃĪttert â und halte mich seit einigen Tagen an die simple Regel: Vertrau deinen Kocherfahrungen mehr als Minutenangaben in Rezepten. AuÃerdem hatte ich von Samin Nosrat auch in ihrer Netflix-Serie gelernt: Fleisch ewig frÞh salzen.
Ich dachte gestern Þber bayerische KÞche nach und dann Þber spanische, weil mir F. das Kochbuch Basque von JosÃĐ Pizarro geschenkt hatte. Im bayerischen Kochbuch fand ich, dass man Fleisch auch mal fÞnf Minuten vor dem Braten salzen kÃķnne, wÃĪhrend Nosrat dafÞr plÃĪdiert, es einen Tag frÞher zu salzen als es in die Pfanne kommen soll. Ich kaufte zwei Rumpsteaks mit ordentlichem Fettrand und salzte sie, direkt nachdem ich wieder zuhause war, gut zwei Stunden, bevor ich sie braten wollte. So konnte ich beobachten, dass das Fleisch dunkler wurde bzw. sein Rotton ging ins Burgunderrot Þber, wo er vorher frisch rot, fleischigrot halt gewesen war. Die OberflÃĪche wurde glÃĪnzender und weniger definiert. Ich weià noch nicht genau, welche chemische Reaktion da stattgefunden hat, aber das Endergebnis Þberzeugte mich sehr vom frÞhen Salzen.
Das Rezept in Basque wollte T-Bone-Steak, aber daran traue ich mich noch nicht heran. Ãberhaupt habe ich mich ewig nicht mehr an kurzgebratenes Rindfleisch gewagt, weil ich in den letzten Jahren diverse StÞcke ruiniert hatte. Egal ob ich nach GefÞhl oder Minutenangaben kochte und briet, egal wie oft ich bei Masterchef sehen konnte, was KÃķche und KÃķchinnen mit Steaks machen, damit sie gut werden â ich selbst habe noch nie ein gutes hinbekommen. Meist waren sie zu durch und schmeckten nach nichts. Gut, letzteres kann am Fleisch selbst gelegen haben. Erst seit ich ein bisschen darauf achte, was ich so in mich hineinwerfe, gebe ich ordentliches Geld fÞr ordentliches Fleisch aus. Aber Steaks habe ich, wie gesagt, ewig nicht mehr gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, das Geld zum Fenster rauszuschmeiÃen, weil ich das Fleisch nicht vernÞnftig braten kann.
Ein Nebeneffekt des Buchs von Nosrat ist, mir selber wieder zu trauen, eher auf Erfahrungswerte zu setzen, auf Geruch und Optik, auf die gute alte Fingerprobe beim Steak und nicht auf meinen iPhone-Timer. Also gab ich anstÃĪndig Geld aus, salzte die dicken Steaks und lieà sie dann bei Raumtemperatur rumliegen, wÃĪhrend ich eine Salsa zubereitete, die Basque dazu vorschlug. Dazu eine Schalotte in richtig viel OlivenÃķl sanft anbraten, dann zwei gehackte Knoblauchzehen dazu, 300 g grob gehackte Cherrytomaten, 6 Anchovis (einfach so, wie sie sind) und die abgeriebene Schale einer Zitrone. Die Kochanweisung dazu lautete, ganz im Sinne von Nosrat: so lange braten, bis die Tomaten weich, aber noch nicht matschig sind und die Anchovis zerfallen. Ich wusste gar nicht, dass Anchovis in der Hitze zerfallen, aber Ãberraschung, genau das taten sie. Ich kostete brav mehrfach die Salsa und salzte nur wenig nach, weil das die Anchovis schon gut erledigt hatten, und freute mich Þber den irre frischen Kick durch die Zitrone. Erst abends am Tisch fiel mir auf, dass die Salsa von Pizarro alles verband, was Nosrat predigt: Salz, Fett, SÃĪure und Hitze.
Aus Nosrats Buch hatte ich auch gelernt: Wenn du keinen Profigrill zuhause hast, aber eine richtig heiÃe Pfanne brauchst â wie fÞr Steaks zum Beispiel â, dann stell sie doch einfach in den heiÃen Ofen, bevor du sie auf den Herd packst. Genau das tat ich. Ich habe immer noch keine gusseiserne Pfanne, weil ich ja immer dachte, die brauche ich nur fÞr Steaks und die kann ich ja nicht, aber die kommt jetzt sofort auf den Weihnachtswunschzettel. Gestern nutzte ich wie immer meine Edelstahlpfanne, Hauptsache, nichts Beschichtetes, soviel wusste ich auch schon. Der Ofen lief auf 200 Grad, die Pfanne blieb 15 Minuten drin, ich legte die Ofenhandschuhe sehr, sehr sichtbar in meine Augenlinie, um sie bloà nicht zu vergessen, wenn die Pfanne auf dem Herd stand, schloss die KÞchentÞr, Ãķffnete das KÞchenfenster sehr weit, warf die Abzugshaube an und betete zu den RauchmeldergÃķttern, mich zu verschonen. Ich salzte das Fleisch noch einmal, kein Pfeffer, SonnenblumenÃķl in die Pfanne, das quasi sofort zu rauchen begann, ich wartete trotzdem noch ein winziges bisschen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es echt in Millisekundenschnelle heià genug fÞr das Fleisch war, ich probierte es mit einem HolzstÃĪbchen, das sofort Blasen warf und ergab mich in mein Schicksal: Fleisch in die Pfanne! Ahoi!
Man konnte der Maillard-Reaktion quasi zugucken! Es roch von Anfang an deutlich anders als sonst: krÃĪftiger, fleischiger, wÞrziger, aber nicht verbrannt oder rauchig. Ich guckte nicht auf die Uhr, sondern auf die OberflÃĪche des Fleischs. Als ich der Meinung war, ich kÃķnnte es wenden, tat ich genau das, freute mich Þber eine herrliche Unterseite, guckte dem Fleisch weiter zu, wagte es irgendwann, den Finger aufs Fleisch zu drÞcken, um zu prÞfen, ob es medium war, meinte medium zu spÞren, und stellte die Pfanne in den weiterhin auf 200 Grad bullernden Ofen.
WÃĪhrenddessen schraubte ich einen Tempranillo auf und lieà F. schon mal das Salatdressing kosten. NatÞrlich hatte ich wieder eine Majo gemacht und das Caesar-Dressing, weil ich dachte, wenn in der Salsa Anchovis und Zitrone drin sind, dann passt das Dressing zum grÞnen Salat ja super. Tat es auch. Gestern brauchte ich allerdings vier Versuche fÞr die Majo; das erste Mal letzte Woche war anscheinend pures AnfÃĪngerglÞck. Gestern verbanden sich Eigelb und Ãl zunÃĪchst nicht, die Majo blieb viel zu flÞssig. Keine Ahnung, ob man das noch hÃĪtte retten kÃķnnen, aber ich stellte die SchÞssel weg, nahm eine neue, schlug ein neues Eigelb auf und gab Ãl dazu. Das klappte ganz gut, dann kippte ich zuviel Ãl auf einmal zur Masse und sofort geronn alles. Aber ich hatte ja schon gelernt: Das kriegt man wieder hin! Die dritte SchÞssel aus dem Schrank geholt, einen halben TeelÃķffel sehr heiÃes Wasser dazu, die kaputte Majo tropfenweise dazugeben und schlagen, bis der Arm abfÃĪllt! Das klappte so gut, dass ich auch hier plÃķtzlich zu viel Masse dazugab, worauf wieder alles geronn. Die vierte SchÞssel aus dem Schrank geholt, alles nochmal, mein rechter Arm ist inzwischen doppelt so dick wie mein linker, aber ich hatte endlich perfekt cremige Majo, die ich mit Zitrone, Essig, Anchovis, Parmesan, Knoblauch und Worcestersauce abschmeckte. Sie brauchte kein Extrasalz mehr, weil ich mich inzwischen traue, von allem anderen Salzigen genug in die Fett-Ei-Mischung zu werfen.
Das Steak war meiner Meinung nach fertig, keine Ahnung, wie lange es im Ofen gewesen war, darauf kÃķnnte ich vielleicht beim nÃĪchsten Mal achten; nun hob ich es aus der Pfanne und lieà es zehn Minuten lang rumliegen. Nach der Ruhezeit kam es mit Salat und Salsa auf den Teller, ich fotografierte, ohne wirklich auf Winkel und Bildausschnitt zu achten, denn OMG Hunger! und schnitt das Fleisch an. Eine herrliche Kruste, nicht zu fest, nicht zu nachgiebig. Das Fleisch war ein winziges bisschen Þber Medium drÞber, aber noch deutlich rosa, und es schmeckte herrlich. F. meinte, das sei das beste Steak, was er je auÃerhalb eines Restaurants aus einer Pfanne und nicht vom Grill gegessen habe und nein, das liegt nicht daran, dass der Mann mich toll findet! Glaube ich jedenfalls, ich wollte nicht nachfragen, sondern nur stumm mein Fleisch genieÃen. Die Salsa dazu war hervorragend, die kann ich hiermit auch locker weiterempfehlen. Stelle ich mir zu Fisch fast noch besser vor. Sogar der Fettrand, den ich vorher eingeschnitten hatte, war knusprig geworden, wie beim guten alten bayerischen Schweinebraten! Very happy Anke.

—
F. guckte noch das Bayernspiel auf meinem Laptop, ich rÃĪumte die KÞche wieder in einen menschenwÞrdigen Zustand und fiel dann sehr mÞde ins Bett. Eigentlich nur ein normaler Alltag, Arbeiten, Einkaufen, Kochen, aber er hatte sich sehr gut und rund und voll angefÞhlt.
+++
+++
Dir gefÃĪllt, was du hier liest oder du mÃķchtest mir eine gusseiserne Pfanne finanzieren? Dann bedanke ich mich fÞr deine kleine Spende.
—
Tagebuch Donnerstag, 6. Dezember 2018 â Krampus und Caesar Salad
Der Tag begann damit, dass ich Þberrascht und freudig feststellte, dass in meinen Sneakers an der EingangstÞr ein Schokonikolaus steckte, der seinen Kumpel Krampus aus Wien mitgebracht hatte. Also eigentlich hatte F. beide aus Wien mitgebracht, der kleine Racker, und von mir unbemerkt in meinen Schuhen deponiert. Das war ein schÃķner Tagesanfang.

—
Gearbeitet, rumgepuzzelt, in Salz. Fett. SÃĪure. Hitze. das Salz-Kapitel zuende gelesen, das ich vorgestern begonnen und in dem ich bereits mein Mittagessen fÞr gestern gefunden hatte.
—
Caesar Salad ist mein absoluter Lieblingssalat. Ich glaube, ich habe kein Essen, auch wenn es noch so unfotogen ist, so oft geinstragrammt wie diesen Salat, weil er einfach immer gut ist, egal wie huschig ich ihn zubereite. Okay, eigentlich ist er eine Entschuldigung, um einen Berg Knoblauchcroutons zu essen, aber das behalten wir einfach mal fÞr uns.
Im Salz-Kapitel tauchte nun genau dieser Salat als Lernvorlage auf: Man sollte an ihm bzw. seinem Dressing ausprobieren, wie man Salz schichtet, also wie man verschiedene salzige Zutaten zusammen verwendet und wie anders alles wird, je nachdem was man hinzufÞgt. An diesem Dressing sollte man auch Abschmecken Þben.
Ich koche jetzt seit fast zehn Jahren halbwegs regelmÃĪÃig â oft genug reicht auch ein Sandwich zum Abendessen, das ist nicht Kochen â, aber ich habe immer noch das GefÞhl, keine Intuition fÞr die Sache entwickelt zu haben. Ich befolge Rezepte ziemlich sklavisch, weil ich meist nicht wÞsste, was ich ÃĪndern sollte auÃer vielleicht Dinge wegzulassen, die ich nicht mag oder die ich gerade unnÃķtig finde (meistens Fleisch). Ich behaupte, ich habe mir gewisse Grundfertigkeiten beigebracht, aber ich koche sehr oft das Gleiche, weil ich weiÃ, dass es funktioniert. Mir fehlt (noch?) die FÃĪhigkeit, aus dem Gelernten etwas Neues zu machen. Also anders als an der Uni, wo einem auch niemand die Hausarbeiten schreibt, man aber die Grundfertigkeiten beigebracht bekommt (wo ist die Bibliothek, wie funktioniert sie, wie finde ich einen Aufsatz). Da habe ich recht schnell kapiert, wie ich aus BauklÃķtzen ein Haus bauen kann, vor allem, weil ich so viele andere AufsÃĪtze lesen musste, um selber welche zu schreiben.
Genauso habe ich eigentlich gewisse Grundlagen beim Kochen drauf, aber ich bekomme die Einzelteile noch nicht selbstÃĪndig zu etwas Neuem gepuzzelt. Deswegen gucke ich so gerne Kochshows wie Masterchef, wo die Kandidat*innen beispielsweise eine Grundzutat vorgegeben bekommen und daraus was zaubern mÞssen. Ich bin jedesmal wieder davon erstaunt, was man alles aus, keine Ahnung, Tomaten machen kann auÃer Suppe, Salat und dem Klassiker âzwei Scheiben davon aufs KÃĪsebrotâ. Deswegen habe ich mich gestern so Þber die verkohlten Zwiebeln gefreut: Ich wÃĪre nie auf die Idee gekommen, sie bewusst anzubrennen, weil ich die Grundfertigkeit âmit starken Aromen arbeitenâ schlicht noch nicht drauf habe.
Auch von Masterchef gelernt habe ich solche simplen Dinge, Þber die alle geÞbten KÃķch*innen vermutlich gutmÞtig mit den Augen rollen, wie: Jedes Gericht sollte verschiedene Texturen haben oder unterschiedliche AggregatzustÃĪnde, damit der Mund sich nicht langweilt. Also knackig plus schmelzig. Oder fest und weich. Oder auch mild und scharf sowie heià und kalt. Ich habe mal als Schreibtipp gelesen, sich seine LieblingsbÞcher analytisch vornzunehmen, um herauszufinden, warum genau sie die LieblingsbÞcher sind, damit man daran seine eigenen Geschichten orientieren kann. Das versuche ich seitdem auf meine Lieblingsgerichte anzuwenden: Warum schmecken mir manche Dinge besser als andere? Ich mag zwar die mummelige GleichfÃķrmigkeit von Spaghetti Carbonara (gleiche Temperatur und MundgefÞhl aller Zutaten, alles recht salzig), aber ich mag genauso die WundertÞte Salade niçoise (warm und kalt, weich und fest, GeschmÃĪcker von mild bis salzig). Generell war ich erstaunt darÞber, dass ich beim Nachdenken Þber Lieblingsgerichte doch eher an salzige als an sÞÃe dachte â vermutlich weil letztere einfach nur das sind: sÞÃ. (In diesem Zusammenhang: HÃĪnde weg von Schokolade, die ist perfekt so wie sie ist! Das Grauen von Chili-Schokolade!)
Zusammengefasst: Ich wÞrde gerne etwas strukturierter meine KochfÃĪhigkeiten ausbauen. Da ich kÃķrperlich keine Kochausbildung mehr hinkriege und ich auch keine Lust auf VHS-Kurse mehr habe, erhoffe ich mir von BÞchern wie Salz. Fett. SÃĪure. Hitze. ein bisschen mehr Grundwissen, das ich schlicht Þbersprungen habe beim Rezeptekochen, und damit verbunden mehr inneres Handwerkszeug, um nicht immer das Gleiche einzukaufen und daraus immer das Gleiche zu kochen.
Deswegen fand ich es reizvoll, einen Caesar Salad neu zu lernen, gerade weil ich den schon so oft gemacht habe â so konnte ich vergleichen. Es ging im Buch nicht darum, die RomamasalatblÃĪtter besonders schick zu schneiden oder wie man aus Brot Croutons macht, das habe ich so gemacht wie immer. Es ging stattdessen darum, das Dressing von Grund auf zu verstehen. Das Buch gibt keine Mengenangaben vor (wieviel Worcestersauce, wieviel Parmesan, wieviele Sardellen?), sondern sagt nur: Probier mal aus, davon was zur Majo zu geben. DafÞr gab es eine Mengenangabe, die mir auch noch nicht bekannt war: 175 ml Ãl auf ein Eigelb. Ich hatte gefÞhlt nur recht kleine Eier und benutzte daher erstmal 150 ml, aber das war zuwenig, wer hÃĪtte es gedacht. Mayonnaise habe ich bisher mit dem PÞrierstab gemacht und mich auch da an Rezepte gehalten. Dieses Mal griff ich zu SchÞssel und Schneebesen. Alleine das war toll, weil es sich danach angefÞhlt hat, Grundlagen zu erlernen. Erstmal die Basics verstehen, dann kannst du immer noch zum Zauberstab greifen.
Ich begann also mit dem Mise en Place (auch so eine schÃķne Grundfertigkeit), was auch im Buch beschrieben wird: Parmesan reiben, Sardellen zerdrÞcken, Knoblauch mit einer Prise Salz zerreiben, Salz in ein GefÃĪà schÞtten, aus dem man mit den Fingern salzen kann, Worcestersauce aufschrauben (das letzte fand ich besonders schnuffig). FÞr die Majo: eine Zitrone auspressen und Essig bereitstellen. Ich wunderte mich, dass kein Senf verlangt war und googelte erstmal nach: Nein, es muss kein Senf in eine Majo, aber der gibt von Anfang an etwas SÃĪure und SchÃĪrfe dazu. Genau das wollte ich ja aber selbst in der Hand haben. Also: Senf wieder in den KÞhlschrank stellen, aus dem ich ihn schon vor lÃĪngerer Zeit geholt hatte, denn immerhin wusste ich schon, dass alle Grundzutaten die gleiche Temperatur haben sollten. Und da ich Eier und Ãl nicht im KÞhlschrank aufbewahre uswusf.
Ein SalztÃķpfchen habe ich mir schon vor lÃĪngerer Zeit angewÃķhnt, die anderen Handgriffe kannte ich auch, wobei ich das Zerreiben des Knoblauchs mit meinem groÃen Kochmesser sehr genoss. Auch eine Sache, die bei mir ein bisschen gedauert hatte: mich an groÃe, scharfe (teure) Messer ranzutrauen und nicht immer das kleine Supermarktmesser fÞr alles zu benutzen.
Jetzt aber: ein Eigelb in eine breite SchÞssel aufschlagen, das SonnenblumenÃķl abmessen und in ein GefÃĪà umsiedeln, aus dem man kontrollierter gieÃen kann als aus der wabbeligen Plastikflasche. Aus einem feuchten Handtuch einen Ring basteln, auf dem die SchÞssel fest steht (schon was gelernt!). Und dann ganz langsam Ãl zum Ei geben und mit dem Schneebesen zÞgig verschlagen. Das ging besser und schneller als ich dachte! Als ich eine schÃķne Masse vor mir hatte, ging es ans Abschmecken. Zum ersten Mal schmeckte ich ungewÞrzte Majo, die quasi nur aus MundgefÞhl besteht (Fett halt). Ich gab vorsichtig Zitronensaft hinzu und wusste sofort: Da geht noch was. Noch ein bisschen Saft fÞr die Frische, dann ein bisschen Essig fÞr eine kleine saure SchÃĪrfe. Und jetzt das Salz.
ZunÃĪchst gab ich den Knoblauch dazu und schmeckte seine ziepende SchÃĪrfe sowie das Salz, mit dem ich die Zehe verrieben hatte. Dann die Sardellen, die deutlich weniger fischig waren als ich sie erwartet hatte. Sie gaben der Masse eine gewisse fleischige Tiefe. Vor der Worcestersauce hatte ich vermutlich zuviel Respekt, mit der koche ich nie, das war die einzige Zutat, fÞr die ich gestern einkaufen gehen musste, Rest war im Haus. Deswegen war ich bei ihr sehr memmig und habe sie auch nicht wirklich herausgeschmeckt. NÃĪchstes Mal. Der Parmesan kam extrem geschmeidig und mit winzigen Salzspitzen dazu, und erst zum Schluss gab ich reines Tafelsalz in die Masse. Ich wollte noch ein bisschen mehr Parmesan und dann war ich zufrieden und von dieser simplen TÃĪtigkeit schon sehr beeindruckt. Alleine bewusst zu merken, wie unterschiedlich salzig salzige Dinge schmecken, fand ich spannend und hoffentlich fÞr die Zukunft hilfreich.
Der letzte Test aus dem Buch: ein Salatblatt durchs Dressing ziehen und gucken, ob alles zusammenpasst. Das passte so gut, dass ich gleich den ganzen Romanakopf in die SchÞssel tunken wollte, aber ich beherrschte mich brav und zerschnitt den Kopf, wÃĪhrend die Croutons in der Pfanne rumknisterten. Der fertige Salat war dann wie immer ein Genuss, und damit verbanne ich mein bisheriges Dressing aus CrÃĻme fraÃŪche, OlivenÃķl und Zitronensaft nach Sibirien.

Die Mayonnaise steht da nur, damit ich mit ihrer perfekten Konsistenz angeben kann. In die habe ich abends einfach WeiÃbrot gestippt, so lecker war sie (die Majo, nicht die Konsistenz).
—
Tagebuch Samstag, 24. November 2018 â Fuppesfrust
Morgens bei F. konnten wir nicht so lange rumlungern, wie zumindest ich es gerne gehabt hÃĪtte, weil der Herr einen Termin hatte. Also ging ich einkaufen, dann erst nach Hause, kochte Tee und las auf dem Sofa vor mich hin, bevor ich mich in den Zwiebellook fÞrs Stadion zwÃĪngte. Unter Shirt und Pulli kam das Thermooberteil, in dem ich walke, denn das speichert WÃĪrme ganz ausgezeichnet, unter die Jeans kamen die Thermotights, bei denen âtightâ wirklich âtightâ meint. Falls ich jemals wieder eine lange Flugreise machen werde, gehen die bestimmt auch als Kompressionsstrumpf durch. Sind aber trotzdem top bequem. (Ich verlinke mal wieder Nike, die gute Sportbekleidung auch fÞr dicke Menschen anbieten und dafÞr auch etwas krÃĪftigere Damen als Models engagiert haben.)
Gestern fuhr ich ausnahmsweise ohne F. nach Augsburg ins Stadion, hatte also keinen GesprÃĪchspartner fÞr die 40-minÞtige Zugfahrt. In meine dicke Winterjacke passt zwar ein Taschenbuch in die Innentasche, ich lese aber nun mal gerade den dicken Feuchtwanger und hatte keine Lust auf alle meine eBooks, die ich auf dem Handy mit mir rumtrage. Also stopfte ich mir 800 Seiten groÃe Literatur in die Seitentasche und in die andere meinen eingerollten FCA-Schal. Der bleibt bis Augsburg in der Jacke, seit ihn mir in MÞnchen mal ein schlecht gelaunter Blauer wegreiÃen wollte. Ich war netterweise in breitschultriger Begleitung und habe daher meinen Schal noch. Aber ganz ehrlich: Wenn ich alleine gewesen wÃĪre, hÃĪtte ich ihn locker hergegeben. Wenn dem Idioten dabei einer abgeht, ein StÞck Textil zu klauen, dann bitte. Meine Verachtung fÞr sein armseliges Leben ist ihm sicher, und ich kaufe mir einfach einen neuen Schal. (FuÃballrituale kÃķnnen so erzdÃĪmlich sein.)
Auf der Fahrt selber saà ich dann quasi inkognito hinter einigen Herren, die sich teilweise als Eintracht-Frankfurt-Fans zu erkennen gaben (oder an ihren schwarzweiÃen Schals erkennbar waren), teilweise als Bayernfans, die die Karten fÞrs Spiel #FCASGE gewonnen hatten. Der Frankfurtfan meinte, sie hÃĪtten Augsburg in zehn Spielen nie schlagen kÃķnnen; wenn nicht heute, mit dieser Mannschaft, wann dann? Die Bayernfans beglÞckwÞnschten ihn bzw. seine Mannschaft nochmal zum Pokal, und alle waren nett zueinander. Ich kannte die Statistik der letzten zehn Spiele gar nicht und war von Augsburg beeindruckt.
Leider nicht sehr lange.

(Hinter meiner Hand oben links im Bild geht gerade die Sonne hinter dem Stadion unter. Ich habe die mal nicht weggeschnitten, damit ich mich selber daran erinnere, dass ich im Winter keine Sonnenbrille im Stadion brauche, weil die Sonne pÞnktlich zum Anpfiff nicht mehr blendet.)
Der Kids Club drehte vor dem Spiel seine Þbliche Ehrenrunde, wie immer auch mit Kindern der Gastmannschaft, was netterweise stets dazu fÞhrt, dass die sonst unerbittlich pfeifenden Gegnerfans mal drei Minuten Ruhe geben und kleinen Kindern winken, wie der Rest des Stadions auch. Ich mag das sehr.
Dann gab’s allerdings kaum noch was, was ich mochte. Der FCA kassierte nach 51 Sekunden das erste Gegentor, nach 46 Minuten das zweite, an das dritte kann ich mich nicht erinnern, und bis auf die zwei Minuten nach dem 1:3 in der 91. Minute hatte ich auch nie das GefÞhl, dass Augsburg Herr auf dem eigenen Platz war. In der ersten Halbzeit lieà ich mich ab und zu zum PÃķbeln hinreiÃen, weil ich so stinkig war, in der zweiten saà ich nur ergeben in unser Schicksal rum und wartete, bis endlich der Abpfiff kam. Nach dem 0:3 dachte ich ganz kurz darÞber nach, schon zu gehen und einen frÞheren Zug zu nehmen, aber das macht man ja bekanntlich nicht. (FuÃballrituale kÃķnnen so erzdÃĪmlich sein.) So sah ich immerhin noch ein Tor vom FCA, wollte aber nach dem Spiel wirklich dringend nach Hause. Das war extrem anstrengend beim Zugucken, weil der Mannschaft quasi alles fehlte, was sie beim Spiel gegen zum Beispiel Dortmund noch so aufregend gemacht hatte. GefÞhlt kam ein Pass von zehn an, alle wollten es wieder irre kompliziert machen, und wenn es jemals eine Vereinsgeschichte geben sollte, mÞsste ihr Titel âJETZT LASST DOCH MAL DIE SCHEISS QUERPÃSSE!â lauten. Die Statistik weist Augsburg leider als Kloppertruppe aus, aber nicht mal diese *hust* StÃĪrke konnten sie gestern aus*hust*spielen, weil Frankfurt cleverer foulte und der Schiedsrichter fÞr mein GefÞhl irre viel durchgehen lieà (aber fÞr beide Mannschaften â auch nur gefÞhlt).
Immerhin war ich schnell bei und in der Tram und schaffte es noch zum frÞhen Zug um 18.08 Uhr anstatt auf den um 18.42 warten zu mÞssen. Der Zug war leider ein kurzer und dementsprechend voll, aber netterweise bot mir ein FCA-Fan seinen Sitzplatz an. Sehe ich schwanger aus? Hat Dicksein ungeahnte Vorteile? Oder war der Kerl einfach nur nett? Egal, ich saÃ. Die ÃĪltere Dame neben mir meinte weise: âWenn die Fans so leise in den Zug kommen, ahnt man immer schon, wie das Spiel war. Verloren?â Ich berichtete und grinste innerlich darÞber, dass die Dame anscheinend die Horde grÃķlender Eintrachtfans zwei Wagen hinter uns nicht gehÃķrt hatte. Vor denen hatte ich auf dem Bahnsteig ein bisschen Angst gehabt. Ich mag grÃķÃere MÃĪnnergruppen generell nicht, noch weniger mag ich sie bei FuÃballspielen (sorry, Jungs) und am allerwenigsten, wenn sie auch noch Bier intus haben. Ich verstehe nicht, dass beim FCA nicht nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird. Klar tanken alle vorher schon, aber das wÃĪre immerhin eine kleine MÃķglichkeit, Dinge etwas besser im Griff zu haben.
Neben mir im Zweiersitz hatte es sich ein Frankfurtfan mit seinem kleinen Sohn bequem gemacht, der den umstehenden FCA-Fans begeistert erzÃĪhlte, dass er vier sei und heute zum ersten Mal im Stadion und wie toll alles gewesen wÃĪre und so weiter und so fort. Die FCAler klÃķnten gemÞtlich mit, und so fand dann doch eine kleine FanverbrÞderung statt und ich konnte einfach nicht mehr stinkig sein.
Das wurde ich dann in der U-Bahn vom Bahnhof nach Hause, als ernsthaft wieder jemand Þber den FCA-Schal lÃĪsterte, den ich vergessen hatte, wieder in die Tasche zu stecken. Irgendein Trottel textete erst mich und dann seine immerhin komplett unbeeindruckte Freundin voll, dass ich mich wohl verfahren hÃĪtte, Augsburg wÞrde hier nicht spielen, was fÞr eine ScheiÃstadt und er hÃĪtte mal einem FCA-Fan in MÞnchen den Schal geklaut und yadayadayada und dann ging ich einfach weg, weil ich gerade wieder gute Laune gehabt hatte. Vollpfosten. Kein Wunder, dass so viele Leute FuÃballfans scheiÃe finden. Ich finde uns manchmal auch scheiÃe.
—
Was irgendwie schÃķn war, auch wenn das Thema fies ist, Donnerstag, 22. November 2018 â Rumlesen und rumgucken
Nach den ein, zwei langen Wien-EintrÃĪgen hatte ich keine Lust mehr auf den dritten, der ebenfalls so lang geworden wÃĪre, weswegen euch leider die schÃķne, zweistÞndige Diskussion im Burgtheater entgangen ist, falls ihr vorletzte Woche nicht schon meinem Link auf Twitter gefolgt seid. Die Veranstaltung âAufbruch in die Zukunft. 1918 und heute â Matinee zum Ende des Ersten Weltkriegs und zur Ausrufung der Republikâ wurde nÃĪmlich live auf Ã1 Þbertragen und lieà sich auch eine Woche lang nachhÃķren. Jetzt ist der Link leider tot.
Ich fand es sehr spannend, das Ende des Weltkriegs aus Ãķsterreichischer Perspektive besprochen zu hÃķren. Zum einen musste ich danach erstmal Daten googeln, weil stÃĪndig vom 26. Oktober als Feiertag gesprochen wurde und ich schlicht nicht wusste, was da passiert war. (Jetzt weià ich’s.) Peinlicherweise wusste ich nicht, dass auch Ãsterreich von den Alliierten besetzt war, genau wie Deutschland. Ãberhaupt weià ich viel zu wenig Þber unser Nachbarland, weswegen ich das Buch von Philipp Blom ja so spannend fand. Ich weiÃ, ich verlinke neuerdings dauernd zu meinem Blogeintrag zum Buch, aber das lohnt sich wirklich; hier halt der Absatz Þber Ãsterreich bzw. das letzte eingerÞckte Zitat, in dem beschrieben wird, wie aus dem Riesenreich Ãsterreich-Ungarn das kleine Ding wird, was es heute noch ist und was es vorher nie war. WÃĪhrend der Veranstaltung fiel die Bemerkung, dass fÞr die 1918 ausgerufene Republik 22 Dynastien auf ihre Kronen verzichteten. Das ist doch mal schÃķner Partysmalltalk.
Zum anderen habe ich von dieser Veranstaltung auÃer dem gesprochenen Ohrwurm âHoch die Republikâ noch die WÞrdigung der unglÞcklicherweise so bezeichneten Zwischenkriegszeit mitgenommen. So geht es mir selbst auch, vor allem im Hinblick auf meine Diss: FÞr mich sind die 20er Jahre nur ein Zwischenspiel oder eine bÃķse OuvertÞre zum noch bÃķseren StÞck. Ich vergesse selbst gerne, wie unglaublich revolutionÃĪr (im wahrsten Sinne des Wortes) diese Zeit gewesen ist und welche UmwÃĪlzungen in sehr kurzer Zeit passierten. Errungenschaften wie die erste Republik (Volksgewalt statt Monarchie, kein Gott mehr in der Verfassung), die erste Demokratie auf deutschem Boden, das Frauenwahlrecht etc. werden auch in meinen inneren ZeitlÃĪuften verdrÃĪngt von Inflation, Wirtschaftskrise und drohendem Nationalsozialismus. Gleichzeitig ist mir bewusst, warum die 20er auch die Goldenen Zwanziger genannt werden: neue Musik, Film als Massenmedium, Bauhaus-Architektur, mehr FreizÞgigkeit, der Bubikopf (um mal ein Beispiel der neuen Mode zu nennen). Ich fand es spannend, diese Zeit gewÞrdigt zu sehen und versuche mich seitdem selbst immer wieder daran zu erinnern.
Die Diskussion drehte sich dann auch um die heutige Zeit; es wurde gefragt, warum nicht wieder der 12. November gefeiert werde, an dem 1918 die erste Republik Ãsterreich ausgerufen wurde. Es wurde mehr Verfassungspatriotismus gefordert, mehr Stolz auf demokratische Errungenschaften und mehr Ãchtung von Antidemokraten, von denen Ãsterreich leider auch genug hat (der Seitenhieb auf die AfD blieb nicht aus). Es wurde auch betont, dass manche Dinge schlicht nicht verhandelbar seien (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Individualrechte, die Versorgung SchwÃĪcherer), weswegen es auch nichts bringe, mit Rechten zu reden, die genau diese Dinge verhandeln wollten. GroÃer Applaus, auch von mir.
Neben der Diskussion gab es Ausschnitte aus Texten, die von Schauspieler*innen des Burgtheaters gelesen wurden. Einen der Herren sahen wir abends Þbrigens in der spannenden Inszenierung von Glaube Liebe Hoffnung von ÃdÃķn von HorvÃĄth wieder, und seitdem wir Karten fÞr dieses StÞck hatten, erzÃĪhlte mir F. von einem dreiminÞtigen Ausschnitt aus einem alten Programm von Josef Hader, der in Paris den Ast trifft, der 1938 HorvÃĄth erschlagen hatte.
—
Einige der Texte las ich gestern in der Stabi nach. Besonders beeindruckt hatte mich K. u. K. GeflÞster von Andrzej Stasiuk, eine Rede, die der Verfasser am Burgtheater 2008 (?) gehalten hatte und die in Lettre abgedruckt ist (leider online nicht vollstÃĪndig). Das Magazin gibt es seltsamerweise auch in Unibibliotheken nicht online, weswegen ich gestern mit dem dicken Jahresband im Lesesaal saÃ. Der ErzÃĪhler besucht an Allerheiligen einen Friedhof, auf dem Gefallene des Ersten Weltkriegs liegen, die miteinander sprechen. Ich hatte mir von der Lesung den Begriff der âmineralischen Knochenâ gemerkt, die der Regen zerfrisst, genau wie âdie Reste von Metall, die Schnallen, die KnÃķpfe mit den Regimentsnummern, die Plomben in den ZÃĪhnen, die NÃĪgel in den Stiefeln. Wenn sie in Stiefeln bestattet wurden. Da bin ich nicht sicher.â
ââWer spricht?â
âDer Gemeine Jussuf Kusturic, 4. Bosnisch-Herzegowinisches Infanterieregiment, Friedhof in Przyslup. Sammelgrab, das erste links vom Eingang.â
âWann bist du gefallen?â
âAm 2. Mai in der FrÞhâ. Am ersten Tag der Schlacht von Gorlice. Ich stieg aus dem Graben und war tot. Ich war aus der Gegend von Mostar. Ich bin hierhergekommen, um zu sterben.â
âAber du hast vier Monate lÃĪnger gelebt.â
âJa. Aber im Mai zu sterben, das tut weh. Ich weià nicht einmal, was es war. Ich war einfach plÃķtzlich tot. Die Buchen trieben kleine grÞne BlÃĪtter. Ich lag auf dem RÞcken, bis schlieÃlich alles still wurde und erlosch. Im Winter hÃķrt man hier keine GerÃĪusche. Dann rufe ich mir in Erinnerung, wie Mostar im Dezember duftete, wie Travnik duftete und Sarajevo. Sie dufteten nach Eichenrauch.â
âMein Dorf roch nach Kiefern- und Birkenrauch. Der Frost kam im Oktober, tausend Werst Ãķstlich von Moskau. Doch der Zar hatâs befohlen, deshalb kam ich hierher, um von einem Mannlicher Kaliber 8 zu sterben.â
âUnd unser Kaiser lieà uns rote Feze tragen, darin gingen wir zum Angriff. Wir trugen rote Feze und waren durch die BÃĪume meilenweit zu erkennen, denn der Kaiser wollte in seinem Reich kaiserliche TÞrken haben, deshalb liefen wir mit diesem Rot auf den KÃķpfen herum wie die HÃĪhne, wir brachen aus Mostar, Tuzla und Sarajevo auf, um auf den HÃĪngen von Magura zu fallen. Wir trugen hellblaue Uniformen, und man sah sofort, wer sich in die Hosen geschissen hatte.â
âSÞà und ehrenvoll ist es, sich fÞr den Kaiser in die Hosen zu scheiÃen.â
âWer spricht denn da?
âSchÞtze Mendel Brod. 4. FeldschÞtzenbataillon. Friedhof in Magura. Grab 51. Auch am 2. Mai, so wie der muslimische Kollege. Vermutlich ein Schrapnell.â
âWoher?â
âBircza bei Przemysl.â
âGarnison?â
âBraunau am Inn.â
âMach keine Witze.â
(Andrzej Stasiuk (Olaf KÞhl, Ãbers.): âK. u. K. GeflÞsterâ, in: Lettre International 88 (2010), S. 94â97, hier S. 94.)
—
Ich hatte mir auÃerdem das Buch Menschen im Krieg (1918) von Andreas Latzko herauslegen lassen, das in der Stabi nur in alter deutscher Schrift zu finden war; ein Exemplar stammt von der Ordensburg Sonthofen, was mich etwas erstaunte, denn der kurze Ausschnitt, den wir hÃķrten, beschrieb die Heimkehr eines kriegsversehrten Soldaten. Ich las die Geschichte gestern zuende und mÃķchte nun das ganze Buch lesen, worauf ich gestern im Lesesaal aber keine Lust hatte.
Ausgeliehen habe ich mir den Sammelband Hungern â Hamstern â Heimkehren: Erinnerungen an die Jahre 1918 bis 1921 (Inhaltsverzeichnis), aus dem wir einen kleinen Ausschnitt von Lotte Pirker gehÃķrt hatten.
—
Mein Nachhauseweg fÞhrte mich am Bayerischen Hauptstaatsarchiv vorbei, wo ich ein Plakat fÞr die Ausstellung Getroffen. Gerettet. Gezeichnet â SanitÃĪtswesen im Ersten Weltkrieg sah, die thematisch natÞrlich hervorragend passte, weswegen ich gleich hineinging. Das kÃķnnt ihr auch noch bis zum 30. November tun, und ich empfehle das sehr. Ist nur ein Raum plus ein Vorraum. In dem steht als zentrales AusstellungsstÞck ein durchschossener Stahlhelm, was ÃĪuÃerst plakativ klarmacht, worum es geht.
Ich fand es bemerkenswert, wieviele originale StÞcke aus der Zeit ausgestellt waren: Verbandsmaterial, medizinisches Werkzeug, wobei mich ein dreistÃķckiger Koffer mit Operationsbesteck sehr beeindruckte; ein Morphium-Spritzbesteck, dessen Leihgeber âPrivatbesitzâ mich auch kurz stutzen lieà â die meisten StÞcke kamen aus militÃĪrhistorischen oder medizinischen Sammlungen. Wie im verlinkten Flyer zu sehen ist, ging es auch um die Nachkriegszeit und wie mit Versehrten umgegangen wurde. Ich lernte, dass die Deutschen als erste Giftgas einsetzten, dass es Gasmasken fÞr Pferde gab und Hunde zur Rettung von Verwundeten genutzt wurden. Es gab Prothesen zu sehen und zerschossene Knochen, was alles nicht wirklich Spaà macht, aber ich fand es sehr eindringlich, ohne sensationsheischend zu sein.
Und seit den Fotos weià ich auch, dass die Soldaten in ihren Stiefeln bestattet wurden.
—
Tagebuch Freitag, 16. November 2018 â Lesetag
Gestern war ein bisschen Urlaub-vom-Urlaub-Tag. Seit unserer RÞckkehr hatte ich lauter Kleinkram zu erledigen, aber gestern war mal nichts. Niemand wollte was, ich wollte auch nichts, also las ich viel. Zum Beispiel den Newsletter von Austin Kleon, der mich auf einen alten Artikel (2014) von Rob Walker aufmerksam machte: How To Pay Attention: 20 Ways To Win The War Against Seeing.
Walker beschreibt eine Aufgabe, die er seinen Design-Student*innen stellte: Sie sollten in der Woche bis zur nÃĪchsten Sitzung Þben, aufmerksam zu sein. Das war’s. Teil der Ãbung war zu sehen, wie genau nun Menschen versuchen, aufmerksam zu sein bzw. mit welchen Methoden sie Dinge fanden, die man normalerweise Þbersieht. Der Artikel fasst 20 Tipps zusammen, die ich alle spannend fand fÞr einen neuen Blickwinkel fÞr die eigene Umgebung oder als Ausgangspunkt fÞr einen neuen Blogeintrag, ein Kunstprojekt, gegen die Langeweile auf dem Weg zur Arbeit usw.
Ein paar Tipps darunter bezogen sich auf Kunstbetrachtung. Der Slow Art Day (kannte ich auch noch nicht) findet jedes Jahr im April statt: Dabei trifft man sich in Museen, schaut sich fÞnf Werke fÞr jeweils zehn Minuten an und spricht danach darÞber. Es mÞssen anscheinend nicht die gleichen Werke sein, es geht, glaube ich, gar nicht darum zu vergleichen, wer jetzt was gesehen hat, sondern es geht darum, sich aufmerksam einem Werk zu widmen und wahrzunehmen, was man sieht, was man dabei vielleicht fÞhlt, welche Assoziationen man hat.
So ÃĪhnlich ist Þbrigens unser Podcast entstanden: Wir wollten alle den Cremaster-Cycle von Matthew Barney sehen, der 2014 netterweise umsonst an drei Abenden in der Hochschule fÞr Film und Fernsehen gezeigt wurde. Nachdem alle fÞnf Filme durch waren, wollten wir natÞrlich dringend darÞber sprechen, wobei wir spaÃeshalber ein Smartphone mitlaufen lieÃen. Als wir uns unsere Diskussion â die alleine durch das offene Mikro etwas strukturierter und wohlformulierter ablief als die Þblichen KlÃķnabende â noch mal anhÃķrten, fanden wir das gut genug, es auch anderen vorspielen zu wollen, und schon hatten wir einen Kulturpodcast. Aber auch ohne einen Podcast kann man sich mal im Museum verabreden und danach bewusst darÞber reden. Wer das lieber alleine macht, kann sich nach fÞnf Werken ins MuseumscafÃĐ setzen und aufschreiben, was er oder sie gesehen und gefÞhlt hat. (Zack, Blogeintrag fertig! Merke ich mir fÞr Tage, an denen ich auf nichts Lust habe.)
Eine weitere Art des Kunstguckens ist das richtig lange Kunstgucken. Ich zitiere aus dem Artikel:
âEducator Jennifer L. Roberts has described an assignment sheâs used in art history classes as making students regard a single work for âa painfully long time.â This seems to mean three hours, which does sound like a challenge (…). The taskâââânoting down his or her evolving observations as well as the questions and speculations that arise from those observationsââââis meant to be the first step in a research process. But Roberts argues, persuasively, that itâs a highly useful step. Students resist, but eventually find that looking really slowly forces them to notice things they had initially missed. âWhat this exercise shows students,â Roberts writes, âis that just because you have looked at something doesnât mean that you have seen it.â
Ich habe noch nie so lange vor einem Werk gesessen, aber es erschlieÃt sich mir sofort, dass man immer mehr sieht, je lÃĪnger man hinguckt. Das merke ich bei jedem Werk, Þber das ich bisher eine Hausarbeit geschrieben habe â man denkt immer, man hat es gesehen, aber es verÃĪndert sich bei jedem erneuten Draufschauen, erÃķffnet neue Perspektiven oder zwingt zu neuen Fragestellungen. Das merkte ich besonders bei meiner Masterarbeit, bei der sich meine ursprÞngliche Forschungsfrage nicht mehr halten lieÃ, je lÃĪnger ich auf LÞpertz guckte â aber gerade dieses Mehrfachschauen lieà mich dann andere Dinge fragen.
Was mich zur dritten Art des Sehens fÞhrt, die auch im Artikel beschrieben wird: mehrfach gucken. Walker verlinkt einen Artikel aus der New York Times, in dem der Autor Randy Kennedy beschreibt, dass er sich nun schon seit Jahren den selben Caravaggio im Met anschaut. Schon seinen Weg zum Bild fand ich lesenswert (vermutlich weil ich genau die gleichen Bilder mag oder nicht):
âCurators have long lamented how little time museum patrons spend in front of works; a 2001 study by the Met found the median viewing time to be only 17 seconds. And so I would love to say that I formed a conviction to make the Caravaggio my pilgrimage site in order to nobly embody the pre-Internet virtues of long looking, of allowing meaning to accrue over time. The truth is that my job as an art reporter takes me to the Met with great (and pleasing) regularity, and every time I make my way through the European galleries, I seem to end up passing the painting and stopping short in front of its pile of shadows.
Eventually I came to remember exactly where the painting was, and after an interview, before heading to the subway, I got into the habit of making a beeline for it, almost sheepishly, like somebody at a party snubbing all the guests except the one he really wants to talk to. Iâd shoot painfully past Hans Memling, one of my favorites, past Bosch and past Bruegelâs stout harvesters, eternally eating their lunchtime porridge. Iâd hang a left at van Dyckâs foppish blond duke, ignore Rubens altogether, and by the time I got to Guercinoâs Samson and his gloriously torqued back, Iâd know I was almost there.â
Der Bruegel hÃĪngt da Þbrigens immer noch, der ist leider gerade nicht in Wien bei seinen Kumpels vom Jahreszeiten-Zyklus, nur so nebenbei. Kennedy verweist auch auf das wunderbare Buch Alte Meister von Thomas Bernard, das ich euch ebenfalls empfehlen kann.
—
Ich begann den Artikel mit dem Hinweis auf Austin Kleons Newsletter. Daraus mÃķchte ich noch schnell einen Eintrag vom Verfasser selbst zitieren: We are verbs, not nouns. Er beschreibt ein Interview mit Stephen Fry, in dem dieser die folgenden schlauen SÃĪtze sagte:
âOscar Wilde said that if you know what you want to be, then you inevitably become it â that is your punishment, but if you never know, then you can be anything. There is a truth to that. We are not nouns, we are verbs. I am not a thing â an actor, a writer â I am a person who does things â I write, I act â and I never know what I am going to do next. I think you can be imprisoned if you think of yourself as a noun.â
Das hat mich seltsam berÞhrt, weil ich mich sofort Þber mein Schreiben definieren konnte, aber auch sofort wusste, wie oft sich dieses Schreiben geÃĪndert hat. Mir ist erst Mitte meiner DreiÃiger aufgefallen, dass ich schon immer geschrieben habe. Ich habe als Kind bereits Tagebuch gefÞhrt, ohne es so zu nennen, ich habe halt immer irgendwo irgendwas hingeschrieben, bis ich mit 12 mein erstes BÞchlein bekam, in das ich schrieb. Eine meiner deutlichsten Kindheitserinnerungen ist eine Szene, wie ich mit dem Fahrrad von Oma zurÞck nach Hause fahre und dabei Þber die Blumen am Weg nachdenke. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich Þber sie nachdachte, weil ich wusste, dass ich genau diese Gedanken danach aufschreiben wollte â was ich auch tat.
Ich habe mir den Eintrag gerade durchgelesen, weil ich aus ihm zitieren wollte, aber den verschweige ich der Nachwelt besser. Ãhem. Immerhin kommt direkt nach dem arg simplen Vergleich von schÃķnen Blumen und schlichten Menschen noch eine knallharte Analyse zu Ingeborg Bachmanns Gedicht HerbstmanÃķver: âEs ist einfach irre!â
Mir ist beim Tagebuchlesen eben auch bewusst aufgefallen, dass ich recht frÞh damit begonnen habe, mir Þber Dinge klar zu werden, indem ich sie aufschreibe â so wie ich das heute noch mache. Ich erwÃĪhnte das im Blog vermutlich schon mal: Ich habe Schreiben nie als ein Talent oder sogar als eine Grundlage fÞr einen Beruf gesehen, einfach weil ich es schon immer gemacht habe. Ich war also schon immer ein Verb â âschreibendâ statt âSchriftstellerinâ, als was ich mich nie bezeichnet habe â , bevor ich eine Journalistin wurde, eine Bloggerin, eine Werbetexterin, eine Buchautorin, eine Kunsthistorikerin (wenigstens fÞr zwei Kataloge).
—
Nachtrag: Tagebuch Samstag, 10. November 2018 â Vier Ausstellungen und ein Todesfall (meine FÞÃe)
Im mumok waren wir noch nie, daher suchten wir uns im Vorfeld eine Ausstellung raus, die wir anschauen wollten â und lungerten dann ungefÃĪhr fÞnf Stunden im Haus rum und besahen uns im Endeffekt jedes Stockwerk. So kann’s gehen, wenn Ausstellungen Spaà machen. (Oder man sie einfach recht schnell durchschreitet. Ãhem.)
Eigentlich wollten wir zu Doppelleben, begannen aber einfach mal im Untergeschoss bei 55 Dates, denn das klang fÞr mich spannend: âDie Ausstellung prÃĪsentiert eine Mischung aus Bekanntem und weniger Bekanntem, zeigt KÞnstler_innen, die in die Kunstgeschichte eingegangen sind, sowie andere, die es noch zu entdecken gilt. In der unkonventionellen Ausstellungsgestaltung des Ãķsterreichischen KÞnstler Hans Schabus ermÃķglicht 55 Dates Lesarten jenseits konventioneller Erwartungshaltungen an eine lexikalische Ãberblickssammlung zum 20. und 21. Jahrhundert.â Oder anders: Das mumok hat einfach mal 55 seiner Werke auf BauzÃĪune anstatt an edle StellwÃĪnde gehÃĪngt bzw. mitten in den Raum gestellt und lÃĪsst uns als Publikum ohne Absperrseile durchlaufen. Das hÃĪtte genauso beliebig werden kÃķnnen wie die olle Spitzmausmumie von Wes Anderson, Þber die ich gestern nÃķrgelte, war aber stattdessen meiner Meinung nach eine schÃķne Punktlandung.
An den ersten Werken schlenderte ich noch etwas zweifelnd vorbei: Cosima von Bonins Stofftiere mochte ich zwar gerne, konnte aber nicht so recht etwas mit ihnen anfangen. Die Bilderserie Wiener Spaziergang von GÞnter Brus kannte ich teilweise schon, aber eigentlich guckte ich gar nicht so richtig hin, sondern im ganzen Raum herum, denn auch das fand ich spannend: Man konnte durch die GitterwÃĪnde eben fast die ganze Austellung sehen und schlÃĪngelte sich nicht unwissend von Raum zu Raum. Eine groÃe Halle mit einer einzigen festen Stellwand in der Mitte, die von beiden Seiten behÃĪngt war, ansonsten nur GitterzÃĪune und halt viel Kunst. Ich mochte das sehr.
Nach den Stofftieren und den Fotos stand ich vor einem groben Podest aus Holzpaletten und Metall, auf dem vier Skulpturen, unter anderem von Dieter Roth standen. Am Bauzaun nebenan lehnte eine verkohlte HolztÞr von Beuys, auf der anderen Seite hingen lÃĪssig ein paar Warhols. Auf meiner jetzigen Seite hing allerdings eine Fotocollage von jemandem, den ich bisher noch nicht kannte. Bzw. die ich bisher noch nicht kannte, was mir aber auch erst F. in der Wikipedia vorlas. Friedl Dicker-Brandeis‘ Collage So sieht sie aus, mein Kind, diese Welt von 1933 ruiniert einem ziemlich den Tag, weckt aber auch gut auf. Der Text Þber der Collage ist auch auf der mumok-Seite (neben weiteren Beschreibungen) lesbar:
âSo sieht sie aus, mein Kind, diese Welt,
Da wirst du hineingeboren,
Da gibt es welche, zum Scheren bestellt
Und welche, die werden geschoren.
So sieht es aus, mein Kind, in der Welt
In unsern und andern LÃĪndern,
Und wenn dir, mein Kind, diese Welt nicht gefÃĪllt,
Dann musst du sie eben ÃĪndern.â
Das klingt jetzt vielleicht arg zusammenhangslos, obwohl beim Entstehungsdatum 1933 klar ist, worum’s geht, und die Bildbeschriftung auch schlicht erwÃĪhnt, dass Dicker-Brandeis 1944 in Auschwitz starb (ich Þbersetze mal: ermordet wurde), was dann endgÞltig jede gute Laune vertreibt. Ich erwÃĪhne das Werk nur deshalb so explizit, weil es gut in den restlichen Wien-Aufenthalt passte. Am Sonntag hÃķrten F. und ich eine Lesung mit Texten zum Ende des Ersten Weltkriegs und was wir heute noch davon mitnehmen kÃķnnen. Seitdem trage ich den Satz âHoch die Republikâ mit mir herum, und das mag man total albern finden, aber ich habe mich selten so in meinem bÞrgerlichen Verfassungspatriotismus bestÃĪtigt gefÞhlt wie in den letzten Tagen (und Monaten), in denen ich geistig stÃĪndig in irgendwelchen Nachkriegs- oder NS-Zeiten rumgehangen habe. Sich ab und zu mal zu vergewissern, wie groÃartig Demokratie und eine Republik sind, tat ganz gut. Ich kartoffeldrucke mir den Satz jetzt auf ein Shirt, ich kriege den echt nicht mehr aus dem Kopf.
(Kleiner Einschub: der New Yorker erklÃĪrt unter anderem Herrn Trump den Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus.)
Der Bogen zur Kunst zurÞck: Ich fand es ÃĪuÃerst spannend, diese politische Kunst fast direkt neben Roths Quick-Wurst oder Geschichte zu sehen. Zu sehen, welche Art politische Kunst mÃķglich ist oder mÃķglich sein musste oder irgendwann aus politischen GrÞnden eben nicht mehr mÃķglich war. Diese wenigen Meter Luftlinie zwischen einem Werk von 1933 und zweien von 1968 haben meinen Kopf schÃķn aufgeschraubt.
Dann schlenderte ich an der mittigen Stellwand entlang, die im Bild 1 zum Ausstellungslink gut zu sehen ist, wobei bei unserem Besuch ein Bild fehlte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch so: Was fÞr eine Kombi! Ed Paschkes schrille Jeanine (1973) hÃĪngt neben Maria Lassnigs introspektivem PfingstselbstportrÃĪt (1969), dann kommt ein Picasso, an dem ich einfach vorbeigegangen bin, kennste einen, kennste alle (ich Þbertreibe, sorry, Pablo), dann kam der abstrakte Rote Turm von Johannes Itten (1917/18), dazu passte ein futuristischer Balla von 1914, und schlieÃlich hatte mich die Ausstellung total im Sack mit den beiden letzten Werken der Wand: zunÃĪchst Kupkas Nocturne (1910/11), das aus blauen FarbflÃĪchen besteht â und dann das Bild Tina im Kupkakleid und ich mit Pinsel (2017) von Ashley Hans Scheirl. Das Kupkakleid ist genau das, wonach es sich anhÃķrt: ein Kleid, das mit ÃĪhnlichen blauen FarbflÃĪchen gestaltet ist wie das Bild, das direkt neben diesem Bild hÃĪngt. So simpel, so toll.
Einschub: Freut ihr euch eigentlich auch so darÞber, dass ihr die ganzen Bilder sehen kÃķnnt, weil das mumok sie tollerweise auf seiner Website hat? Ansonsten lege ich euch den kleinen Katalog ans Herz, der kostet nur 15 Euro und wiegt auch nix. Das freut den Touri. Einschub Ende.
Nach der langen Wand schlenderte ich an Konzeptkunst vorbei und freute mich Þber alles, weil einfach alles Spaà machte. Die Kombinationen lieÃen jedes Werk fÞr sich leuchten, keins Þberstrahlte ein anderes, und alle ergÃĪnzten sich lustigerweise, auch wenn sie in ihrer Entstehungszeit 50 Jahre auseinanderlagen. Das fiel mir besonders auf der RÞckseite der eben angesprochenen Wand auf. Dort hatte ich vorher nicht die ganze Seite Þberblickt, sondern brav mit dem ersten Bild links angefangen (Bild 3 zeigt die Raumsituation gut). Ich sah also einen Delaunay von 1936, den ich aber in seiner grafischen Schlichtheit im Kopf in die 60er Jahre packte, dann kam Niki de Saint-Phalle von 1961, passte, aber dann ein Bild, das mich an die klassische Moderne erinnerte, und mein Kopf fragte sich, ob da ein KÞnstler aus den 60ern einen bewussten RÞckgriff gemacht hatte, wie lustig, oh, direkt daneben hÃĪngt ein Jasper Johns, Ende 60er, wer war denn der schlaue RÞckgreifer? War natÞrlich keiner: Gerstls PortrÃĪt der Familie SchÃķnberg ist von 1908, und ich bin fett in die kleine kunsthistorische Falle gelaufen, die ich mir selber aufgestellt hatte.
Das meinte ich gestern beim Meckern Þber Anderson: Er stellte in seinen groÃen SetzkÃĪsten nirgends solche Fallen auf, er brachte nie zum Stolpern oder Innehalten. Hier war ich dauernd damit beschÃĪftigt, mein eigenes Wissen zu ÞberprÞfen oder neu zusammenzusetzen oder einfach beglÞckt festzustellen, dass man die ganze Kunstgeschichte auch anders prÃĪsentieren kann als nach Schulen, LÃĪndern, Stilen oder Zeiten geordnet. Spontan mÃķchte ich jetzt eine Ausstellung haben von KÞnstlerinnen, die mit F anfangen, denn ich ahne, dass selbst so eine komplett sinnfreie Katalogisierung Ãberraschungen bereithÃĪlt bzw. Kunstgeschichte aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Wobei die HÃĪngung hier alles andere als sinnlos war. Die Depotsituation nimmt der Kunst nichts von ihrer Aura und sie erzeugt Kontext auf kleinstem Raum â man kapiert kunsthistorische Positionen, ohne durch 70 Ausstellungen rennen zu mÞssen. Tolles Ding.
Ich erspare euch den weiteren Rundgang, der Blogeintrag wird eh schon wieder zu lang, aber das wÃĪre fÞr meine Wiener Timeline ein dringender Ausstellungstipp. Man kann in einer Stunde durchhuschen, hat viel zu gucken, und das Ganze lÃĪuft netterweise noch bis Februar.
PS: Louise Lawler <3
—
Ein Stockwerk hÃķher hÃĪngt ebenfalls bis Februar die Fotoausstellung Photo/Politics/Austria, deren Plakat uns schon drauÃen am modernen GebÃĪude angefixt hatte. Simple Idee: FÞr jedes Jahr von 1918 bis 2018 ein Foto aus der Nationalbibliothek oder einem der Archive, ein kurzer Text, vielleicht noch ein bisschen Kontext in Form von Plakaten, BÞchern oder Zeug dazu, und das war’s. Die Bilder waren thematisch sehr breit gefÃĪchert, nicht nur politische Ereignisse, sondern auch kulturelle von Sissi bis Falco waren dabei, es gab Werbung oder Aufregung, und F. und ich mussten einiges aus der Ãķsterreichischen Geschichte nachgoogeln, denn so bewandert waren wir dann doch nicht, wie wir etwas nÃķlig feststellen. (Ich freute mich, dass ich mir aus Philipp Bloms Buch den Justizpalastbrand von 1927 gemerkt hatte.) Beim Googeln merkten wir immerhin, dass es im mumok WLAN gab, wie es sich gehÃķrt und wie sich das deutsche Museen bitte bitte bitte endlich auch einmal anschaffen mÃķgen.
Ich mache diese Ausstellungsbesprechung ganz kurz und gehe nur auf ein Foto ein: Heimkehrer (1947) von Ernst Haas, auf dessen Site gleich das erste Bild der Vienna-Reihe. Wenn man im mumok die Bilderreihe chronologisch abschreitet, geht man logischerweise durch das ganze beknackte Jahrhundert, man gleitet so eklig in die NS-Zeit rein, plÃķtzlich sind da die Hakenkreuze, ich sah einige Bilder, die mich an meine Dissertation erinnern, und dann ist es auf einmal 1947 und aus der groÃen Politik werden wieder kleine Menschen wie diese Mutter auf dem Bild, die einem vermutlich vÃķllig Fremden das Bild ihres Sohnes (?) vor die Nase hÃĪlt, ob er ihn vielleicht kennen wÞrde. Ich habe eine leise Ahnung, warum dieses Bild mich komplett geschmissen hat; mir stiegen im Museum ernsthaft die TrÃĪnen in die Augen, und auch jetzt beim Bloggen, wofÞr ich mir das Bild nochmal angeschaut habe, muss ich mal kurz zum Taschentuch greifen. Ich spare mir jetzt jede brave kunsthistorisch sinnvolle Bildbeschreibung. Guckt euch einfach das Bild mit seinen vielen Ebenen an.
(Hoch die Republik.)
Das Bild von 2018 war Þbrigens ein iPhone, auf dem Instagram zu sehen war, das fand ich einen cleveren RausschmeiÃer, so nach dem Motto, jetzt macht ihr doch mal Bilder. Kennengelernt: die Pressofotografin Barbara Pflaum, die quasi die halbe Fotoleiste von den 50ern bis in die 70er bestritt.
—
Nach den zwei intensiven Ausstellungen brauchten wir ein bisschen Pause und setzten uns ins winzige MuseumscafÃĐ, wo ich, wie immer in den Tagen in Wien, Sachertorte aÃ. Danach versuchte ich ein zweites Mal nach dem Stockwerk mit den SchlieÃfÃĪchern, ins Damenklo zu kommen, aber auch auf diesem Stockwerk gab es gerade eine Kabine und die war besetzt. Auf dem Schild am Fahrstuhl hatte ich aber gesehen, dass im Stockwerk bei der Ausstellung von Ute MÞller ein Kloschild war, weswegen wir uns dorthin tragen lieÃen. Im glÃĪsernen Aufzug, bei dem ich mich die ganze Zeit festhielt und mir einen Katalog vor die Augen hielt. Dazu passen auch die ÃbergÃĪnge vom mittig platzierten Fahrstuhl nach rechts und links in die AusstellungsrÃĪume bzw. die TreppenhÃĪuser: ein milchig-halbtransparenter Gitterboden, auf dem ich meine Schritte sehr beschleunigte, um wieder von ihm runterzukommen. Architektur, die Menschen hasst. Jedenfalls die mit wackeligen FÞÃen oder HÃķhenangst.
Im MÞller-Stockwerk (das zweite von unten) scheint das Hauptklo zu sein (Tipp fÞr alle Touris), da war Platz und Ruhe und ich konnte die Melange loswerden, die ich zur Sachertorte genossen hatte. Und wenn man schon mal da ist, guckt man sich halt auch an, was Frau MÞller so gemacht hat. Gefiel mir gut. Ich habe nicht wirklich Þber ihre raumfÞllende Installation nachgedacht, fand sie aber schÃķn. Kopf war noch in der Pause. Sachertorteundmelange-Speicher gingen schon wieder zur Neige.
—
In den beiden obersten Stockwerken blieben wir ÃĪhnlich kurz, denn in der Ausstellung Klassentreffen standen und hingen diverse Werke aus einer Privatsammlung herum, die uns nicht ganz so begeistern konnten. Ich entdeckte allerdings Silke Otto-Knapp fÞr mich und lachte sehr Þber das Real Painting (for Aunt Cora), 2013, von John Baldessari und Meg Cranston.
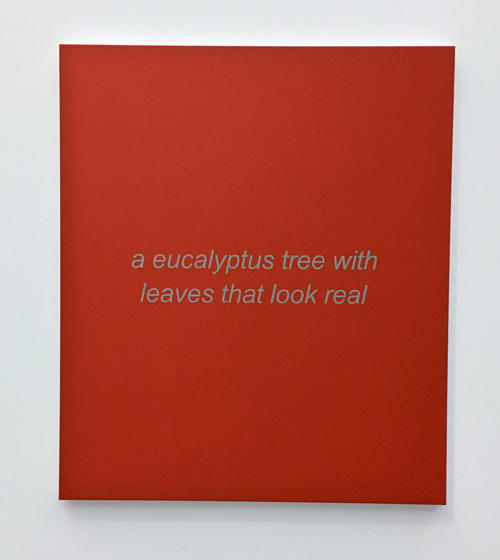
—
Und dann kam die Ausstellung, wegen der wir eigentlich hier waren: Doppelleben. Ich zitiere von der Website: âDie Ausstellung Doppelleben rÞckt bildende KÞnstler_innen in den Fokus, die Musik geschrieben, produziert oder Ãķffentlich aufgefÞhrt haben beziehungsweise Mitglieder von KÞnstler_innenbands waren oder sind.â Das sah dann so aus:

In insgesamt drei groÃen RÃĪumen auf zwei Stockwerken hingen in verschiedener HÃķhe LeinwÃĪnde, auf die Videos projiziert wurden. Vor jedem Video hingen zwei KopfhÃķrer von der Decke, netterweise mit einem Pfeil auf dem FuÃboden, der in die Richtung des jeweiligen Videos zeigte. Das war manchmal wirklich nÃķtig, weil alles kreuz und quer ausgerichtet war, was aber fÞr ein spannendes RaumgefÞhl sorgte. Es fÞhlte sich schlicht nicht ganz so kreuzbrav museal an. Ich hÃĪtte allerdings gerne ein paar kreuzbrave BÃĪnke oder Sitzgelegenheiten gehabt (die FaltstÞhle an der Wand entdeckte ich deutlich zu spÃĪt). Ich hatte kein Programm oder ein bestimmtes Video, was ich sehen wollte, ich guckte einfach das, was da war. Vielleicht war Laibach nicht unbedingt der beste Einstieg, gerade wenn man an mein Geheule beim Foto denkt, aber nun gut. Laibach halt.
Als ich vor Laibach stand, musste ich immer auf eine Leinwand gucken, die weiter weg war, weil mir die Laibach-Bilder so auf den Zeiger gingen. Deswegen hÃķrte ich danach auch das lustige Lied von Trabant gerne an, dessen Bilder ich durch den ganzen Raum gesehen hatte. Link geht zur Ausstellungswebsite, die auch auf den gefÞhlt hundertfach ausliegenden iPads voreingestellt war.
Viele lÃĪngere Videos guckte ich nur in Ausschnitten, klassische Musik, Jazz, Die tÃķdliche Doris, Laurie Anderson, und bei dem 47-minÞtigen von Alva Noto notierte ich mir beim ZuhÃķren den KÞnstlernamen und hÃķrte dessen faszinierende, elektronische Musik im Zug auf der RÞckfahrt nach MÞnchen.
Bei den 80 Minuten von Hanne Darboven hÃĪtte ich wirklich gerne eine Sitzgelegenheit gehabt, denn das Ding war total hypnotisch. Ich glaube, ich hÃķrte zehn Minuten zu, aber dann musste ich mich dringend bewegen. (File under: warum StehplÃĪtze in der Oper nix fÞr mich sind und wie ich Leute bewundere, die Wagner stehend gucken.) Was ich faszinierend fand: Die Komposition hÃķrt sich wirklich an wie das Bildwerk von Darboven. Toll. Und seltsam. Toll seltsam.
Mein persÃķnlicher RausschmeiÃer war John Cage, mit dessen Water Walk (1960) das Publikum anscheinend noch nicht so recht etwas anzufangen wusste. Die Quietscheente!
Ich schaffte es so gerade noch ins Hotel zurÞck, wo ich dringend meine MuseumsfÞÃchen ausruhen musste. Abends rafften wir uns noch zu einem Schnitzel auf (was sonst) und bestaunten dann beim Verdauungsspaziergang die Ankeruhr, von der ich vorher noch nie gehÃķrt hatte, nun aber dringend stehenbleiben musste (schon wieder stehen!), um den Figuren beim WeiterrÞcken zuzugucken.
Die Uhr ist Þbrigens direkt am VermÃĪhlungsbrunnen, den gerade ein interessantes Graffiti ziert.
+++
+++
Dir gefÃĪllt, was du hier liest oder du mÃķchtest mir festes Schuhwerk finanzieren? Dann bedanke ich mich fÞr deine kleine Spende.
—
Nachtrag: Tagebuch Freitag, 9. November 2018 â Bruegel, Spitzmaus, Merchandise
Wir logierten in Wien fÞr ein paar Tage im gleichen Hotel wie vor gut zwei Jahren, als die Albertina mich eingeladen hatte. Ich hatte mir gemerkt, dass es recht zentral lag, man zu Fuà zu den wichtigen Museen kommt und dass das FrÞhstÞcksbuffett keinen Wunsch offen lieÃ. Ich hatte allerdings vergessen, wie warm die Bettdecken sind und dass es in einem sehr alten Bauwerk nie Steckdosen am Nachttisch gibt. Da ich Matschbirne aber mein iPhone-Ladedings eh vergessen hatte, brauchten wir nur die eine (!) Steckdose, die am Schreibtisch frei war. FÞr weitere Stecker wie zum Beispiel fÞrs Macbook stÃķpselte ich die Schreibtisch- oder die Stehlampe am anderen Ende des Zimmers aus. F. bestaunte die DeckenhÃķhe und bedauerte, sein LasermessgerÃĪt nicht mitgebracht zu haben. So mussten wir schÃĪtzen und einigten uns auf âauf jeden Fall hÃķher als vier Meterâ.
—
Im Kunsthistorischen Museum lÃĪuft noch bis Januar eine Bruegel-Ausstellung, die anscheinend eine kleine Sensation ist, ich zitiere aus dem Link:
âBecause Bruegel was only in his forties at the time of his death, there are only about 40 paintings, 60 drawings, and 80 prints known to be by his hand. His works on panel are the most rare and the most celebrated, so museums lucky enough to own one are loathe to part with them. […]
Believe it or not, this is the first time a museum has managed to organize a monographic exhibition of the Dutch artistâand the show also marks the 450th anniversary of the Old Masterâs death! Itâs not that no one has tried, either: A half century ago, a planned exhibition marking 400 years since Bruegelâs death was cancelled when the necessary loans could not be secured. […]
Remarkably, the Kunsthistorisches has brought together almost three quarters of the artistâs extant works, with about 90 in total spanning the full length of his career. Some of the pieces on loan for the occasion have never left their home institutions, so itâs easy to understand why no one has been able to pull off a major Bruegel show before.â
Ich hatte beim letzten Besuch die drei Bruegels bestaunt, die an den WÃĪnden hingen, durfte aber am vergangenen Freitag feststellen, dass das KHM noch deutlich mehr als die drei in seinem Besitz hat; der zitierte Artikel nennt zwÃķlf Bilder von Pieter Bruegel dem Ãlteren, womit das KHM die meisten Ãlbilder dieses Malers weltweit besitzt. Vor einem stand ich ewig, nachdem ich ebenso ewig warten musste, bis ich endlich in der ersten Reihe angekommen war. Die Ausstellung hat festgelegte Einlasszeiten, damit es nicht so irre Þberlaufen ist, aber es ist natÞrlich trotzdem sehr voll. Und es passiert das, was bei allen Blockbustern passiert: Man steht hinter Leuten, die gleichzeitig dem Audioguide zuhÃķren und versuchen, ein sinnloses Foto vom Bild zu machen. Ich mÃķchte ihnen immer zuraunen, dass die Dinger 400 Jahre alt und damit total gemeinfrei sind und dass man alle Werke per Google vermutlich in deutlich besserer QualitÃĪt findet als sie das wackelige Digifoto hergibt, das sie gerade versuchen zu machen. Mein liebster Hasskunde, der sich auch genau vor dem Bild befand, das ich so lange bestaunte, guckte sich das Werk nicht mal an, sondern hÃķrte dem Audioguide zu, wÃĪhrend er sich im ganzen Raum umschaute und in der ersten Reihe mit dem RÞcken zum Bild stand.
Aber irgendwann war der Typ dann weg und auch der alte Rollstuhlfahrer, der einem einfach Þber die FÞÃe fuhr, um nach vorne zu kommen, war weitergezogen, und ich stand endlich mittig vor der Kreuztragung Christi (1564), die ich seit Minuten von der rechten Seite aus schrÃĪg bewundert hatte. Dort war mir die trauernde Maria als erstes aufgefallen, ich bestaunte die Kleidermassen der Dame im roten Umhang, wunderte mich Þber den TierschÃĪdel, dachte dann aber, ach, beim Bruegel liegt ja immer viel rum, und guckte dann erst weiter. Als nÃĪchstes fiel mir die WindmÞhle in der Bildmitte auf, die sinnlos auf einer schmalen Felsnadel hockte, und zu der mein Blick immer wieder zurÞckging, weil es so irrwitzig aussah. Erst dann fiel mir der kreuztragende Christus inmitten einer Menschenmenge auf. Ich hatte den Bildtitel nicht lesen kÃķnnen und kannte das Bild auch nicht, daher wusste ich Þberhaupt nicht, auf was ich schaue, aber jetzt ahnte ich, worum es ging, nachdem ich zunÃĪchst davon ausgegangen war, dass ich eine Szene betrachte, die nach der Kreuzigung stattfand, daher die trauernde Maria. Wie ich nachher aus dem Katalog erfuhr, trauerte die Mutter aber schon wÃĪhrend des Kreuzwegs: â[A]uÃerbiblische Quellenâ berichten, dass Maria âbeim Anblick ihres Sohnens bewusstlos gewordenâ sei. (Quelle: Bruegel â Die Hand des Meisters. Kunsthistorisches Museum Wien, Oktober 2018 bis Januar 2019, BrÞgge 2018, S. 197.)
Ich begann den Rest des Bildes nach Hinweisen abzusuchen: Ah, da rechts sind die aufgerichteten Kreuze, ganz hinten im Bild steht auch noch ein Galgen, und was sind diese RÃĪder auf Stangen? Sind das auch Folterinstrumente? (NatÞrlich.) Ich verlor mich wie immer bei Bruegel in den vielen Details, der dunstigen Stadt, den Menschen, die Jesus begleiten, verspotten oder ihm helfen, bewunderte die Pflanzen im Vordergrund und die Wolken im Hintergrund und konnte mich Þberhaupt nicht von diesem Bild trennen. Das KHM instagrammte eine Raumansicht und die vermittelt ganz gut, warum ich mich nicht davon trennen konnte. Das dunkle Raumlicht lieà das Bild geradezu strahlen.
Neben mir war Þbrigens der einzige Mensch in der ganzen Ausstellung, der genauso still vor dem Bild stand wie ich. Keine Ahnung, ob der Herr vom Fach war oder einfach ein Riesen-Bruegel-Fan, aber er schaute einfach nur, minutenlang, konzentriert, ging vermutlich wie ich das Bild mit den Augen in Abschnitten ab, beugte sich leicht vor, um genauer hinschauen zu kÃķnnen. So ungefÃĪhr gucke ich auch, wenn mir ein Bild gefÃĪllt bzw. es mich interessiert. Wenn ich auch vermutlich in den nÃĪchsten Jahren alles vergessen werde, was ich im Studium gelernt habe â wie man guckt, merke ich mir, denn das mache ich inzwischen automatisch. Das hÃķrt sich vielleicht blÃķd an, aber manchmal ist man ja gerne Þberfordert, gerade bei so detailreichen Bildern wie die von Bruegel.
Ich freue mich sehr darÞber, dass das Wort âWimmelbildâ Einzug in die kunsthistorische Literatur findet. (AusstellungsfÞhrer Bruegel im @KhmWien) pic.twitter.com/9a1vKQg4Nh
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 9. November 2018
Also fÃĪngt man einfach in einer Ecke an zu gucken und beschreibt sich ganz simpel selbst, was man sieht. So wie ich hier eben mit der trauernden Frau in der unteren Ecke angefangen habe. Das weià ich inzwischen, dass das Maria ist, aber selbst wenn man das nicht weiÃ, kann man damit weiterstÃķbern: Warum weint die Frau? Was kÃķnnte passiert sein? Sehe ich das irgendwo im Bild? So kann man Þbrigens auch abstrakte Bilder anschauen: einfach in irgendeiner Ecke anfangen. Linien folgen, Formen oder Farben suchen, was auch immer. Ich brauche immer irgendetwas zum Festhalten; bei gegenstÃĪndlicher Darstellung sind das gerne Personen, bei abstrakten Bildern ein Detail, von dem ich mich weiter vorwage.
ZurÞck zum Bruegel. Ich kann euch gar nicht alle Bilder aufzÃĪhlen, die mich so begeistert haben. Es war groÃartig, beide Darstellungen des Turmbau zu Babel in einem Raum zu sehen; den Wiener Turm kannte ich ja bereits vom letzten Besuch, den Rotterdamer nur von Bildern. Alleine fÞr den lohnt sich die Ausstellung. Er ist im Original deutlich bedrohlicher und dÞsterer als in den lustig-bunten Abbildungen. Und wie einem der Katalog verrÃĪt und was mir wirklich nicht aufgefallen ist: Er ist komplett von Menschenhand gebaut, wÃĪhrend der Wiener Turm aus einem riesigen Felsen herausgeschlagen wird. So oberflÃĪchlich kann ich nÃĪmlich auch gucken, dass mir ein derartig wichtiges und eigentlich offensichtliches Detail entgeht.
Bei einigen Bildern konnte ich an Dinge anlegen, die ich im Lieblingsmuseum, dem Prado, gelernt hatte. Bei der Anbetung der KÃķnige (1564) entdeckte ich nÃĪmlich Kleidungsdetails am schwarzen KÃķnig, die ich schon bei einer Bosch-Darstellung in Madrid gesehen hatte. Auch bei der Dulle Griet findet man diverse Bosch-Zitate. Die Anbetung der KÃķnige fand ich auch noch aus anderen GrÞnden spannend: Die KÃķnige sehen alle ziemlich runtergerockt aus anstatt majestÃĪtisch, und im Hintergrund stehen nicht die Þblichen Bauern oder Hirten, sondern Soldaten mit Lanzen und Hellebarden. Der Katalog fasst das GefÞhl gut zusammen, was man vor diesem Bild hat: âIn ihrer Gesamtheit verleihen all diese Details dem Werk etwas zutiefst VerstÃķrendes, ein bis dato in der niederlÃĪndischen Kunst bei der Darstellung der Anbetung der KÃķnige nicht gekanntes GefÞhl von Bedrohung.â (Kat. Ausst. Wien 2018, S. 191.)
Direkt neben dieser Darstellung hing Þbrigens eine weitere, Die Anbetung der drei KÃķnige im Schnee (1563, nicht 1567, wie die Wikipedia behauptet; das Bild wurde von Bruegel datiert, was aber, laut Katalog, erst vor Kurzem entziffert wurde). Wieder war die Szene nach Flandern verlegt worden, und auch hier musste man die titelgebenden Menschen erstmal suchen. Sie kauern sich links unten an den Bildrand und sind kaum zu sehen durch die dicken Schneeflocken. Der kleine AusstellungsfÞhrer, den ich im obenstehenden Tweet erwÃĪhnte, meint, dieses Bild kÃķnne eine der ersten Darstellungen von fallendem Schnee gewesen sein.
Etwas ganz Besonderes waren die vier Tafeln zu den Jahreszeiten. Der einzige gesicherte GemÃĪldezyklus Bruegels entstand 1565 und besteht aus sechs Bildern (darunter VorfrÞhling, FrÞhling, FrÞhsommer und Hochsommer). Der FrÞhling ist seit lÃĪngerer Zeit verschollen und wir wissen nicht, was abgebildet war. Im Katalog lernte ich, dass dieser Zyklus vermutlich mal ein grÃķÃeres Zimmer geziert hatte â allerdings nur fÞr fÞnf Jahre, dann wurde er schon wieder auseinandergerissen. Wir sehen diese Bilder zum ersten Mal seit 350 Jahren im Zusammenhang, wie die Website erklÃĪrt.
Ein bisschen stinkig bin ich auf die Alte Pinakothek, denn die hat das bekannte Schlaraffenland nicht fÞr die Ausstellung rausgerÞckt, dabei hÃĪtte es so schÃķn in den letzten Saal gepasst, wo auch die Bauernhochzeit hÃĪngt. Und: der Bauerntanz, den ich noch nicht kannte und den ich groÃartig fand. Die Bewegungungen des Paares vorne rechts, das flatternde Kleid der Frau, der Gesichtsausdruck der beiden! Die Kinder vorne links, die trinkenden Menschen. Es sieht auf den ersten Blick â gerade im viel zu dunklen Link â alles sehr grobschlÃĪchtig aus, aber wenn man lÃĪnger hinschaut, fÃĪllt einem die schlichte Freude auf, die das Bild trÃĪgt. Ich fand es generell spannend, dass Bruegel diesen einfachen Darstellungen ein ordentliches GroÃformat gÃķnnte; der Bauerntanz ist 114 x 164 cm groÃ. Dass ein einfaches VolksvergnÞgen im gleichen Format dargestellt wird wie die Anbetung des Jesuskinds, fand ich bemerkenswert.
An den Grafiken und Stichen bin ich eher vorbeigegangen, ich wollte nur die GemÃĪlde sehen, Druckgrafik ist so gar nicht meins. Ja, ich habe bestimmt was versÃĪumt, aber ich kann eh nie alles gucken, also gucke ich das, was ich wirklich anschauen mÃķchte und nicht das, was ich irgendwie anschauen sollte, weil es halt da ist. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Man kommt mit einem sehr satten, zufriedenen GefÞhl wieder aus den vielen RÃĪumen â und landet natÞrlich sofort im Museumsshop, den ich dort noch eilig durchschritt. Unten im regulÃĪren Shop war ich lÃĪnger, ich komme gleich darauf zurÞck.
—

Denn wir hatten ja noch eine Ausstellung vor uns. Die war eher ein Goodie, weil die Eintrittskarte fÞrs ganze Haus galt und nicht nur fÞr den Blockbuster. Nach Bruegel gingen wir relativ zÞgig durch den Rest des Museums, das ich ja schon kannte, aber hey, gerade Lorenzo Lotto kann man sich ja immer angucken. Dann schritten wir die breite Prachttreppe hinab zu Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures, eine kleine Ausstellung, die von Wes Anderson und seiner Partnerin, der Autorin und Illustratorin Juman Malouf, kuratiert wurde.
Mir war das Ding von Anfang an egal, weil mir auch die meisten Filme Andersons egal sind â der einzige, den ich durchgehalten habe, war Grand Budapest Hotel. Das Publikum war ein sehr anderes als das bei Bruegel â deutlich jÞnger, mehr WollmÞtzen â und ich ahne, dass auch das ein Grund dafÞr gewesen war, den beiden die SchlÞssel fÞr die Depots in die HÃĪnde zu drÞcken. Das macht das Endergebnis aber nicht besser.
Anderson und Malouf haben meiner Meinung nach rein auf Ãsthetik hin kuratiert. Sie werfen wild Objekte aus allen Sammlungen des KHM sowie des Naturhistorischen Museum durcheinander und nichts ist beschriftet. Die acht RÃĪume haben meist ein leicht erkennbares Thema (Kinder als Erwachsene; Tierdarstellungen; Menschenfiguren; die Farbe GrÞn usw.), sind aber in sich eine sinnlose Wunderkammer. Nein, nicht mal das: Die Wunderkammern des Barock â mit einem Bild einer solchen beginnt die Ausstellung â hatten als Ziel einen Erkenntnisgewinn und waren zudem meist thematisch geordnet bzw. beschrÃĪnkten sich in Bereichen auf Exponate eines Typs; sie warfen nicht wild bildende Kunst, Kunsthandwerk, ausgestopfte Tiere und KleidungsstÞcke durcheinander. Genau das machen Anderson und Malouf und verlieren damit jeden Kontext, den die ausgestellten Dinge haben. Die Ausstellung wird dadurch total beliebig und verkommt zur reinen OberflÃĪche. Das ist alles hÞbsch, was da rumsteht und das ist auch ebenso hÞbsch kombiniert und ergibt ein schÃķnes Gesamtbild, aber eben nichts weiter als das. Es kommt keinerlei Spannung auf, es gibt keine BrÞche, es macht nichts neugierig. Man lÃĪuft mit einem Folder durch die Gegend, auf dem die einzelnen Exponate immerhin namentlich genannt werden (plus Herkunft und Alter), aber nach dreimaligem Nachschauen hatte ich schon keine Lust mehr. Man konnte nirgends weiterdenken, weil alles so hÞbsch zusammengesetzt wurde und irgendwie fertig aussah. Man konnte sich an nichts reiben, nichts hinterfragen, man stand rum und fand’s niedlich, aber den Effekt kriegt man auch mit einem TeddybÃĪr und einem warmen Kakao hin. Die Ausstellung kÃķnnt ihr euch meiner Meinung nach getrost schenken.
Die NYT fand’s auch doof, aber im Artikel kÃķnnt ihr ein paar Bilder sehen. Und wenn ihr euch bis morgen geduldet, wo (hoffentlich) ein Blogeintrag zu einer anderen Ausstellung kommt, die ebenso wild durcheinanderwÞrfelt, aber so, dass man was davon hat, werdet ihr Andersons und Maloufs Versuch noch alberner finden.
—
Eher unbeeindruckt verlieÃen wir die Ausstellung, die keine war, und gingen zum Museumsshop. Nach lÃĪngerem Nachdenken wollte ich nÃĪmlich doch den Bruegel-Katalog erstehen, den ich oben nicht gekauft hatte. Im Shop stellte ich fest, dass die Merchandise-Menschen wirklich ganze Arbeit geleistet und so ziemlich alles mit Wimmelbildern oder ÃĪhnlichem bedruckt oder ausgestattet hatten, was nicht weglaufen konnte. Manchmal war das ziemlich klasse: So gab es Servietten, auf denen der Bildausschnitt aus der Bauernhochzeit abgedruckt war, in dem zwei MÃĪnner die vielen SuppenschÞsseln tragen. Leider zu klein, sonst hÃĪtte ich sie gekauft, einfach weil es so clever war: eine Schneekugel, in der ein Bilddetail aus JÃĪger im Schnee den Unter- und Hintergrund bildete. Die Þblichen Bleistifte, Taschen, Tassen, KissenhÞllen. Und dann etwas, bei dem mir fast ein Entsetzensschrei entfuhr: zwei Bruegel-BÃĪren, die mit Motiven JÃĪger im Schnee und Kinderspiele bedruckt waren.


Mal abgesehen davon, dass die BÃĪren bescheuert aussehen, weil es scheint, als hÃĪtte man einfach eine Farbwalze Þber sie rollen lassen, ohne darauf zu achten, wo jetzt Farbe oder Motiv landen â der BÃĪr ist der gleiche, den ich als Van-Gogh-BÃĪr im Schlafzimmer sitzen habe! (Hier das zweite Bild von oben.) Mein toller MandelblÞtenbÃĪr ist nur ein variables Massenprodukt! Waaaahh!
Ich musste mich einen halben Tag lang beruhigen und viel Backhendl essen und Bier trinken, aber jetzt im Nachhinein bedauere ich es, nicht doch einen BÃĪren mitgenommen zu haben. Ich kÃķnnte eine Sammlung von MuseumsbÃĪrchen starten, die mit vÃķllig beliebigen Werken bedruckt sind. Und dann kommt irgendwann ein lustiger Regisseur und stellt sie in neue ZusammenhÃĪnge. Okay, vielleicht nicht.
+++
+++
Dir gefÃĪllt, was du hier liest oder du mÃķchtest mir einen Bruegel-BÃĪr finanzieren? Dann bedanke ich mich fÞr deine kleine Spende.
—
Tagebuch Sonntag, 28. Oktober 2018 â âEx Librisâ
Gestern war fÞr mich seit ewigen Zeiten mal wieder Kinotag. Um kurz nach 11 Uhr saà ich in den City-Kinos und schaute mir Ex Libris an, einen Dokumentarfilm Þber die New York Public Library (Trailer). Das Ding dauert fiese dreieinhalb Stunden, aber ich fand, das war gut verbrachte Zeit.
Bei mir hatte der Film von vornherein gewonnen, weil ich ein Fan von Bibliotheken bin. Ich kenne allerdings nur die alte Gemeindebibliothek, die ich als Kind leergelesen habe, und seit ein paar Jahren die vielen Unibibliotheken bzw. die Stabi, in denen ich zu wissenschaftlichen Zwecken sitze. Was die NYPL leistet, hat mich sehr oft Þberrascht. Ich wusste nicht, dass es dort Jobmessen gibt, Tanzstunden, Lesezirkel, Poetry Slams und Konzerte. Der Film kommt ohne jeden Kommentar aus, er zeigt einfach nur die Þberbordende Vielfalt, die die Bibliothek und ihre vielen Zweigstellen anbieten â und vor allem die Menschen, die all das benutzen. Im Trailer wird es angesprochen: âViele Menschen glauben, Bibliotheken seien nur LagerrÃĪume fÞr BÞcher.â Das sind sie anscheinend nicht, obwohl ich schon sehr darÞber gestolpert bin, dass man extrem selten Menschen BÞcher lesen sieht, womit ich gerechnet hatte. Stattdessen sitzen Menschen vor Laptops, Tablets und Smartphones, vor Mikrofiche-GerÃĪten, in Archiven, blÃĪttern Bilderberge durch oder digitalisieren Landkarten.
Ich gebe zu, beim fÞnften Schnitt zu einem der gefÞhlt dauernd stattfindenden Staff Meetings wurde ich ein bisschen ungeduldig, aber selbst die hatten natÞrlich immer eine Art Pointe fÞr mich als Zuschauerin. Mal ging es schlicht um Budgetfragen, dann um den Umgang mit Obdachlosen, die schlieÃlich auch zur community gehÃķren und fÞr die sei eine Bibliothek nun mal da, es ging um Lizenzen fÞr eBooks, weil dort die Nachfrage viel hÃķher sei als nach PapierbÞchern und generell um die Digitalisierung. Es wurden auch einige Projekte angesprochen, die sich intern dafÞr einsetzten, Frauen oder Minderheiten zu fÃķrdern, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Das Fiese: Der Film wurde bereits 2015 gedreht, bevor er ab 2017 auf Festivals und ab 2018 auch in den Kinos gezeigt wurde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es dem Budget, das teilweise auch aus Bundesmitteln kommt, und diesen speziellen Projekten jetzt wohl geht, seitdem jemand PrÃĪsident ist, der gefÞhlt nicht mal den Teleprompter lesen kann â oder will. Einmal wurde ein Projekt der First Lady erwÃĪhnt, das sich mit mental health befasste â das dÞrfte jetzt vermutlich auch Geschichte sein.
FÞr mich spannend war die Kooperation mit der Gemeinde, um die ich mir noch nie Gedanken gemacht hatte. Es wurden Pakete fÞr Lehrer*innen erwÃĪhnt, die von den Bibliotheken auf den Unterricht zugeschnitten wurden, so dass Kinder und Eltern damit arbeiten kÃķnnen (die Lehrer*innen sowieso). In einem Stadtteil wurden auf einmal viel mehr MathebÞcher ausgeliehen als in anderen Teilen, weswegen jetzt Þberlegt wurde, aktiv auf Schulen zuzugehen, um zusammenzuarbeiten.
Generell fand ich es interessant zu sehen, welche Angebote da waren, die eher Lebenshilfe waren als Hilfe bei der Suche nach einem bestimmten Medium oder einer Information. Die Jobmesse hatte ich angesprochen, aber es gab auch Ausschnitte von VortrÃĪgen Þber Hilfe fÞr behinderte Menschen, besonders bei der Wohnungssuche. Es wurde Unterricht in Braille-Schreiben und -Lesen gezeigt. Menschen, die sich um fremdsprachige Besucher*innen kÞmmerten und teilweise Dinge wie USB-Sticks erklÃĪrten, wÃĪhrend nebenan jemand einer Ahnenforscherin AnknÞpfungspunkte zur Datenbank von Ellis Island vorschlÃĪgt. Es war schÃķn zu sehen, wie nah hochspezialisiertes, akademisches Arbeiten am kindlichen Lesen- und Schreibenlernen ist, wo ein MÃĪdchen mit einer Betreuerin an einem LÞckentext Þberlegt, ob man nun Steine oder Fische in einer Tierhandlung kauft; beides findet in der gleichen Institution statt.
Im Abspann versuchte ich noch Namen zu entziffern, aber es gelang mir nicht bei allen. Einige Prominente bei Podiumsdiskussionen hatte ich erkannt, zum Beispiel Elvis Costello oder Te-Nehisi Coates, aber auch Patti Smith, die Þber Jean Genet sprach, bei dem ich sofort an Anselm Kiefer denken musste, der sich in einigen seiner Werke auf Genet bezieht, und schon fiel Kiefers Name, und nach dem Film musste ich dringend googeln, was Patti Smith 2015 fÞr ein Buch geschrieben hat (M Train). AuÃerdem stellten zwei Akademiker Thesen oder BÞcher vor, deren Namen ich in der IMDB nicht finden konnte, deren BÞcher ich aber sofort lesen wollte. In einem GesprÃĪch ging es um den Sklavenhandel im Senegal, in den auch der Klerus verwickelt wurde, der bisher von SklavenhÃĪndlern verschont geblieben war. Google findet zwar nicht direkt ein Buch dazu, aber, noch besser, die Aufzeichnung des GesprÃĪchs in der NYPL mit dem Historiker Rudolph Ware. Toll. Ein weiterer ungenannter Herr stellte ein Buch vor, in dem die Geschichte von Delis aufgearbeitet wurde und was diese fÞr die jÞdische Gemeinde von New York bedeutet haben. Immerhin das konnte ich herausfinden: Pastrami on Rye: An Overstuffed History of the Jewish Deli von Ted Merwin.
Das Rumgoogeln war zwar lehrreich, aber das wÃĪre mein einziger Kritikpunkt am Film: Manchmal hÃĪtten ein paar Einblendungen ganz gut getan. An der LÃĪnge des Films kann ich leider nicht rummeckern, denn mir fÃĪllt keine einzige Szene ein, die ich hÃĪtte weglassen wollen. Ex Libris ist ein Hauch education porn und man klopft sich als BildungsbÞrger vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Schulter, aber ich fand den Film wirklich sehenswert. Vielleicht gerade fÞr Leute, die sonst nicht in Bibliotheken rumsitzen. Guckt mal, was die alles kÃķnnen!
—
Wer keine Zeit fÞr den Film hat, liest vielleicht einfach diesen Artikel: To Restore Civil Society, Start With the Library.
âLibraries are being disparaged and neglected at precisely the moment when they are most valued and necessary. Why the disconnect? In part itâs because the founding principle of the public library â that all people deserve free, open access to our shared culture and heritage â is out of sync with the market logic that dominates our world. But itâs also because so few influential people understand the expansive role that libraries play in modern communities.
Libraries are an example of what I call âsocial infrastructureâ: the physical spaces and organizations that shape the way people interact. Libraries donât just provide free access to books and other cultural materials, they also offer things like companionship for older adults, de facto child care for busy parents, language instruction for immigrants and welcoming public spaces for the poor, the homeless and young people.
I recently spent a year doing ethnographic research in libraries in New York City. Again and again, I was reminded how essential libraries are, not only for a neighborhoodâs vitality but also for helping to address all manner of personal problems.â
(via Bingereader)
—
Was schÃķn war, Samstag/Sonntag, 20./21. Oktober 2018 â Wochenende
Den Vormittag verbrachte ich dankbar im Internet, denn das erzÃĪhlte mir, wie man ein BÞgeleisen entkalkt. Meins ist mindestens zwanzig Jahre alt und ich ahne, dass es auch so lange schon Kalk ansetzen kann. Da ich aber Mittags einen wichtigen Termin hatte, wollte ich endlich mal wieder BÞgelwÃĪsche ohne weiÃe KrÞmelchen darauf produzieren und fÞllte deshalb mein BÞgeleisen mit einem Wasser-Essig-Gemisch (ich innerlich so: âDER GUTE WEISSWEINESSIG VON GÃLLES!â), lieà es rumdampfen und einwirken und dann nochmal rumdampfen und bÞgelte erst nach gefÞhlt zwei Stunden die erste dunkle Bluse â aber ohne weiÃe KrÞmel, ha! Danke, Internet.
Vor dem Mittagstermin war ich etwas nervÃķs, denn ich war erstmals auf einer Feier von F.s Familie. Solche Veranstaltungen sind nie meins â zu viele Leute, zu viel Small Talk â, aber das war entspannter als ich dachte. Wir aÃen und tranken sehr gut im Aumeister (ich Apfelschorle, ich war noch nicht in Stimmung fÞr Helles oder Wein), dann gingen wir im Englischen Garten spazieren, und zum Abschluss gab es natÞrlich noch Kaffee und Kuchen, wie sich das halt gehÃķrt. Beim Spaziergang war ich vom Herbstlaub sehr fasziniert (#nofilter) und hÃĪtte dieses Motiv jetzt gerne als BettwÃĪsche.
Ich fand die GegensÃĪtze zwischen den Feiern meiner Familie und dieser hier sehr spannend, traf nette Menschen und fÞhlte mich auch rundum wohl. Als ich aber zuhause ankam, wurde ich von einer Sekunde auf die andere bleiern mÞde; nach gut sechs Stunden bestem Benehmen in Kundenklamotten wollte ich nur in Schlumpfklamotten bierrÞlpsend auf der Couch wegdÃĪmmern. Aber ich guckte stattdessen die Sportschau, weil ich das Heimspiel von Augsburg gegen Leipzig leider versÃĪumen musste; die SMS von einer unserer MitstadiongÃĪngerinnen an F: âHabt nix verpasstâ half aber bei der Trauerarbeit. Direkt nach der Sportschau kam F. vorbei, und ich schloss fÞr zehn Minuten die Ãuglein, bevor ich mich aufraffte, um vielleicht noch ein kleines GetrÃĪnk am KÞchentisch zu mir zu nehmen, bevor wir um zehn ins Bett wollten.
Ãhem.
Die drittletzte Flasche Le 7 ðĒððĒ
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 20. Oktober 2018
Die vorletzte Flasche Le 7 ðĒððĒ
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 20. Oktober 2018
Davor gab’s schon ein FlÃĪschchen FrÃĪulein Hu von meinem neuen Lieblingsweingut Wechsler, die ich inzwischen sogar lieber trinke als den Le 7, aber trotzdem werde ich mir fÞr die letzte Flasche einen besonderen Anlass Þberlegen. Silvester oder so. Was richtig Ausgefallenes!
Das war sehr schÃķn, mal wieder stundenlang gemeinsam rumzusitzen und einfach zu reden, keine Termine, nichts, was wirklich dringend besprochen werden muss, einfach nur in der Gegend rumreden. (Und trinken.) Ich mag solche Abende so gerne!
Gemeinsam sehr spÃĪt eingeschlafen.
—
Sonntag blieb der Wecker aus, wir waren trotzdem halbwegs frÞh wach, und F. musste auch kurz nach Hause fÞr einen Winztermin. Ich holte mir derweil Croissants und bereitete Cappuccino fÞr mich zu.
Breakfast of Stormtroopers. pic.twitter.com/scwI5mLkz4
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 21. Oktober 2018
Gegen Mittag kam F. wieder rum und wir machten uns auf den Weg fÞr einen kleinen Spaziergang: Wir wollten uns die Kirche St. Sebastian anschauen. Wir schlenderten dazu die HiltenspergerstraÃe entlang, blieben kurz staunend am Glockenturm der Kreuzkirche stehen, entdeckten schÃķn gestaltete Hausnummern und Fassadenreliefs und bewunderten dann schlieÃlich St. Sebastian von innen und auÃen. Ich stellte fest, dass ich doch nicht bei allen biblischen Bilddarstellungen sattelfest war â die Geschichte bzw. den Psalm vom guten Hirten habe ich lieber mal kurz nachgeschlagen â, freute mich aber Þber eine ungewohnt ungeschmÞckte katholische Kirche.
Danach bummelten wir durch den Luitpoldpark, schauten Menschen beim Sport, beim Lesen und beim Pokemonfangen zu und lieÃen uns dann von der Tram (TRAMFAHREN!) in die NÃĪhe des Ballabeni chauffieren, wo wir das vermutlich letzte Eis der Saison genossen, denn der Laden schlieÃt nÃĪchstes Wochenende fÞr den Winter. In einer Galerie daneben entdeckten wir Kunstwerke mit BÞchern, die uns beiden gefielen; die werden wir uns nochmal anschauen mÞssen, wenn die Galerie geÃķffnet ist. Satt und zufrieden gingen wir zu St. Markus, wo eine Ausstellung lief, deren Plakat wir auf dem Weg zu St. Sebastian an einer LitfasssÃĪule gesehen hatten, Das Prinzip Apfelbaum, wo Menschen Þber ihre Lebensphilosophie und ihren Nachlass sinnieren und fotografisch portrÃĪtiert wurden. Die Fotos von Bettina Flitner gefielen mir erwartungsgemÃĪà sehr gut, die von den Abgebildeten selbst erdachten Ideen dahinter fand ich aber meist sehr blass. Spannend fand ich, dass sich ausgerechnet die zwei Berufspolitiker Richard von WeizsÃĪcker und Egon Bahr am uneitelsten in Szene gesetzt hatten. (Bei Reinhold Messner musste ich arg mit den Augen rollen.)
F. wollte ein Nickerchen machen, ich Serien gucken, das taten wir dann auch, bis wir uns um 17 Uhr nochmal auf ein StÞck Kuchen mit Nilgiritee trafen, natÞrlich von Omis Teegeschirr, Þber das ich mich immer, immer, immer freue. Dann musste F. leider gehen, Termine, Termine, immer beschÃĪftigt der Mann, wÃĪhrend ich Pizzateig ansetzte, die GeschirrspÞlmaschine einrÃĪumte, noch ein bisschen in der Wohnung grundpuschelte, damit sie irgendwann mal fertiggepuschelt ist, bevor ich recht zeitig mit einem Buch im Bett verschwand.
Das war, auch durch die nach gefÞhlt lÃĪngerer Pause viele gemeinsame Zeit mit F., ein sehr schÃķnes Wochenende. Gerne wieder.
—
Was schÃķn war, Montag, 8. Oktober 2018 â Eulen
âHÃķr auf, mir so niedliche Schokolade zu schenken, die kann ich nicht essen!â
âWas kann ich dafÞr, dass bei Lindt wieder Eulenwochen sind?â

Diese Eule ist vom letzten Jahr, und ich habe sie dummerweise aufgehoben. Das hat sich F. anscheinend gemerkt, der Racker. Sie sitzt vor einem Notizbuch, das der Herr mir auch mal geschenkt hat, auf dem das einzige Kunstwerk abgebildet ist, das ich von Jeff Koons mag.

Die hier ist neu und sitzt neben dem besten Museumsshop-Souvenir aller Zeiten: einem TeddybÃĪr aus dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam, dessen Fell den MandelbÞten nachgebildet ist. Kunstgeschichte zum Kuscheln! Ich will den Balloon Dog aus PlÞsch!

Teddy kennt ihr natÞrlich alle aus der TeddybÃĪrenwoche.

âDie in Lavendel habe ich dir zum Essen gekauft, die passt nirgends in dein Farbkonzept.â (Falsch!)
(File under: warum ich F. immer so verknallt angucke.)
—
Tagebuch Dienstag, 2. Oktober 2018 â Familienausflug, zweiter Teil
F. und ich fÞhrten vorgestern die Familie auf meiner Seite durch Augsburg, gestern war dann natÞrlich MÞnchen dran, wenn man schon mal in der Gegend ist. Ich hatte eigentlich einen kleinen Stadtspaziergang geplant, eventuell ein Museum (die Damen waren daran sehr interessiert), aber die Gang wollte etwas lÃĪnger ausschlafen und kam daher erst um 11 in der Landeshauptstadt an. Deswegen zogen wir den eigentlich zweiten Tagesordnungspunkt vor: die Mittagswiesn. Bei unserem Seniorentempo hÃĪtte der Spaziergang zu lange gedauert, um noch ein halbwegs entspanntes Oktoberfesterlebnis zu genieÃen, denn der Ãbergang von der schnuffigen Mittagswiesn zum Þblichen Trubel geht recht schnell. Meine SchwiegerschwÃĪgerin (oder wie immer das korrekte VerwandschaftsverhÃĪltnis lautet) freute sich total: âAlle meine Freundinnen kriegen immer Postkarten von mir von SchlÃķssern und Museen und Kunst â und jetzt bekommen sie eine vom Oktoberfest! Das hÃĪtten die mir nie zugetraut!â
Beim letzten Elternbesuch hatte ich festgestellt, dass man mit manchen Senioren etwas anders durch die Stadt gehen muss, daher war ich ein bisschen nervÃķs vor der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese, weil die in den 16 Tagen Festzeit immer und dauernd und gnadenlos ÞberfÞllt ist. Die Damen und Herren meisterten das aber alles prima, und so konnten wir fast durch den Haupteingang gehen, den ich natÞrlich wie immer verfehlte, weil ich sonst von der U-Bahn-Station GoethestraÃe komme, um eben nicht durch den Haupteingang zu mÞssen. Wir erwischten den Eingang, der 100 Meter vom groÃen Torbogen und dem Denkmal fÞr das Attentat entfernt ist, aber ich konnte ihn immerhin noch zeigen, als wir von der SchaustellerstraÃe in die WirtsbudenstraÃe wechselten. Alleine dass es mehrere StraÃen gibt, war schon beeindruckend fÞr die Gang, genau wie die GrÃķÃe der Zelte sowie die Dauer des Aufbaus. Wir fanden auch sofort einen Andenkenstand, der Postkarten und Briefmarken hatte â darauf hatte ich noch nie geachtet, kann jetzt aber sagen: Gibt es.
Eigentlich wollten wir einmal Þber das ganze GelÃĪnde bummeln, um dann zur Oidn Wiesn zu gehen, wo ich es etwas ruhiger finde, aber ich hatte wohl einmal zu oft das Augustinerzelt erwÃĪhnt, denn da wollten jetzt alle rein. Wir verteilten uns auf zwei Tische, hatten auch nur ein ausgesprochenes Arschloch am Tisch, Þber das ich mich den ganzen Tag sinnlos ÃĪrgerte, aber der Rest der Oktifestneulinge fand das alles ÃĪuÃerst spannend, guckte sozialforschend in der Gegend rum, orderte Brezn und WeiÃwurst und war anscheinend zufrieden. Die ÃĪlteren Herrschaften kamen mit einem bayerischen Ehepaar ins GesprÃĪch und tranken auch brav eine Maà (also zwei zu viert, glaube ich), meine Schwester blieb alkoholfrei, wÃĪhrend ihr Mann, F. und ich jeder eine Maà genossen. Sanft angebiert schlenderten wir nach zwei Stunden Þber den Rest des GelÃĪndes, zeigten Brauereipferde, sprachen Þber die sechs MÞnchner Brauereien, die auf der Festwiese ausschenken dÞrfen und brachten auch sonst noch diverse Oktoberfesttrivia an.
Meine Eltern wollten gerne meine neue Wohnung sehen, ich protestierte sinnlos, dass ich gerade erst eingezogen sei, noch nicht eine Lampe hinge und es auch Þberhaupt nicht aufgerÃĪumt sei, aber das war natÞrlich allen egal. F. holte Kuchen bei Hildegard (die Dame ist, glaube ich, inzwischen verstorben, aber mindestens pensioniert, aber man geht halt immer noch zu Hildegard), wÃĪhrend ich Kaffee in der French Press zubereitete und Tee in Omis Teekanne. Ich wusste, wo alles war! Ich hatte Kaffee und Tee im Haus! Aber nur sechs StÞhle, weswegen ich meinen BÞrodrehstuhl in die KÞche schob und F. sich einen Thron aus Spezikisten bastelte. F. so: âDas sind die meisten Menschen in deiner Wohnung, seit du in MÞnchen lebst.â Und damit hatte der Mann sogar recht, ich Einsiedlerkrebs.
Entspannt und gestÃĪrkt brachen wir dann endlich zum Stadtbummel auf, der im Prinzip der gleiche war, den ich Papa, Schwesterherz und ihrem Mann vor anderthalb Jahren schon einmal erzÃĪhlt hatte. Dieses Mal blieben wir etwas lÃĪnger in der Abgusssammlung, die wir uns letztes Mal geschenkt hatten; durch das Ding renne ich immer durch, wenn ich in die Bibliothek im ZI will. Mein Schwager konnte sich noch an den Sitz des israelischen Konsulats erinnern, Þber den ich mich ja bekanntlich dauernd und anscheinend auch im Beisein von Verwandten freue, denn das Konsulat liegt souverÃĪn in Sichtweite des ehemaligen FÞhrerbaus. Wir gingen auch kurz in die Alte Pinakothek, in der ich das herrliche Treppenhaus von Hans DÃķllgast vorzeigen konnte, was letztes Jahr noch Baustelle war bzw. wegen der Sanierung nur zur HÃĪlfte geÃķffnet.
Und dann war es schon wieder Zeit zum Essen, wie das nur immer passiert. Wir kehrten natÞrlich in den Georgenhof ein, denn auch an den konnte sich die Familie noch als âÃĪuÃerst wohlschmeckendâ erinnern. Die ÃĪlteren Herren fochten kurz das Bezahlen aus, wie das halt so ist, dann machte sich F. auf den Weg in die Allianz-Arena, wo Bayern Champions League spielte, wÃĪhrend ich die Bande wieder zum Bahnhof begleitete und sie mit Hilfe des Schwagers auch in den richtigen Zug bekam. Die Herrschaften fanden alles ganz toll, wie sie uns mehrfach versicherten, was mich sehr freute, weil es mir alles total improvisiert und zerstÞckelt vorgekommen war, aber wenn man Gast ist, nimmt man ja eh alles anders auf als als Gastgeber*in.
Ich lieà den Abwasch fÞr heute stehen, schlief beim Stream des FuÃballspiels schon auf dem Sofa ein und wechselte in der Halbzeit ins Bett.
—
Tagebuch Montag, 1. Oktober 2018 â Familienausflug
Morgens vom LieblingsgerÃĪusch aufgewacht: Dauerregen. Es gibt nichts Entspannenderes als Dauerregen. Also wenn man im Bett oder auf dem Sofa bleiben kann und genug Schokolade im Haus hat. Gestern stand aber der Familienausflug nach Augsburg an, und so googelte ich spaÃeshalber morgens noch nach âAugsburg bei Regenâ, um vielleicht tolle AktivitÃĪten oder SehenwÞrdigkeiten zu finden, die auch bei Dauerregen Spaà machen. Museen sind ja leider Montags fast alle geschlossen, daher fielen die schon mal weg. Weswegen ich es ziemlich klasse finde, dass es in Hamburg bewusst Museen gibt, die eben gerade Montags geÃķffnet sind. Hier in MÞnchen fÃĪllt mir nur die Neue Pinakothek ein, von der selbst einige unser Dozenten sagen, dass man in die ja nur aus PflichtgefÞhl reingeht.
Beim Googeln kamen nur fÞr unsere Gruppe ÃĪuÃerst ungeeignete Dinge wie Lasertag oder Bouldern raus, daher kletterten F. und ich ohne Alternative in den Regionalzug nach Augsburg und begannen planmÃĪÃig mit dem Rathaus und dem Goldenen Saal. Bis dahin hatte es auch aufgehÃķrt zu regnen, es war allerdings fies kalt geworden. Wir erzÃĪhlten trotzdem auf dem zugigen Rathausvorplatz Dinge Þber die Stadtgeschichte und das kommunale Selbstbewusstsein der freien Reichsstadt, das sich extrem unÞbersehbar in diesem monstergroÃen herrlichen Bau niedergeschlagen hatte.
Ich weià noch, als ich das erste Mal auf dem Augsburger Christkindlesmarkt war und kaum glauben konnte, dass dieser Wolkenkratzer da ein Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert sein sollte. Er beeindruckt mich jedes Mal, und gestern war ich auch endlich mal drinnen und konnte den Goldenen Saal bestaunen, der nicht weniger beeindruckend ist.
Im Erdgeschoss fasst eine winzige Ausstellung (ein Raum) die 2000-jÃĪhrige Stadtgeschichte vom RÃķmerlager bis heute zusammen und das ziemlich gut. Danach schlenderten wir zum Perlachturm nebenan, der aber nicht ganz so eindrucksvoll war (zumindest von innen). AuÃen wurde gerade noch die Blumendekoration abgenommen, die fÞr das Turamichele am Wochenende angebracht worden war.
Da der Dom in fuÃlÃĪufiger Entfernung â auch fÞr unsere in Teilen ÃĪuÃerst fuÃlahme Gruppe â lag, nahmen wir den auch gleich mit. Ich war vom BaukÃķrper verwirrt, der innen so schÃķn ordentlich aussieht, aber von auÃen irgendwie krumm und schief â jedenfalls von meiner Sichtposition. AuÃerdem freute ich mich darÞber, dass meine lange verschÞtteten Lateinkenntnisse ausreichten, um eine Gedenktafel fÞr Papst Pius VI. zu entziffern, der hier anscheinend mal eine Messe abgehalten hatte. Vielleicht habe ich aber auch Quatsch entziffert.
Es war Zeit fÞr eine Kaffeepause, die wir im CafÃĐ Dichtl abhielten, wo ich auch endlich mal eine heiÃe Schokolade bekam, die ich am Sonntag schmerzlich vermisst hatte. Dazu gab’s fÞr mich gnadenlos Toast Hawaii, weil ich keine Lust auf Torte hatte und so ohne FrÞhstÞck (auÃer Bialetti-Milchkaffee) um 12 dann doch allmÃĪhlich hungrig war.

Den Nachmittag verbrachten wir in der Fuggerei, Þber deren Besuch ich mich sehr gefreut habe. Ich hatte als Kind mal einen Bericht Þber die Fugger im Fernsehen angeschaut und war seitdem fasziniert von dieser Familiengeschichte. Auch die Idee einer Sozialsiedlung, die seit 500 Jahren besteht und fÞr die die bedÞrftigen Bewohner bis heute eine Jahresmiete im Gegenwert eines Rheinischen Gulden zahlen mÞssen, finde ich spannend (das sind zurzeit 88 Cent. Plus drei Gebete tÃĪglich). Auf der RÞckfahrt unterhielten F. und ich uns darÞber, dass Reichtum eine moralische Verpflichtung sein sollte, ob sie nun aus Angst vor der HÃķlle entsteht oder einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass man selbst so viel mehr besitzt als der Þberwiegende Teil der BevÃķlkerung. Den Ansatz von Bill Gates mag ich gerne (seine Kinder bekommen einen eher kleinen Teil seines groÃen VermÃķgens, der Rest geht in die Stiftung), wÃĪhrend ich bei Interviews mit Jeff Bezos manchmal verzweifele (âWas soll ich mit meinem ganzen Geld machen? Klar, in den Weltraum fliegen.â Bezahl doch erstmal die Amazon-Angestellten besser, du Nase).
Als letzter Tagespunkt stand noch St. Anna mit der Lutherstiege auf dem Programm, aber unsere zwei ÃĪlteren Herren wollten bitte nicht mehr rumlaufen. Da ich auch nichts gegen ein kleines KaltgetrÃĪnk hatte, setzten wir uns gemeinsam in den Bauerntanz und tranken uns warm, bis die anderen gegen 17 Uhr aufliefen und wir entspannt zu Abend aÃen.
Ereignislose RÞckfahrt, kaum Wiesnirre in der U-Bahn. Noch schnell die Saturday-Night-Live-Folge vom Samstag nachgeholt und frÞh ins Bett gegangen.
—
Nachtrag: Tagebuch Mittwoch, 26. September 2018 â Bye-bye, Studibutze
Vormittags ging ich ein weiteres Mal durch die alte Wohnung und guckte, ob ich auch nichts vergessen hatte. Ich meinte nicht und nahm den letzten Teil des Abschieds vor: den Umzug meines Kellerinhalts. Dort fand ich noch eine Kiste T-Shirts, von denen ich dachte, ich hÃĪtte sie schon lÃĪngst in die Altkleidersammlung getan. Hatte ich anscheinend nicht. (To do: wegbringen. Oder noch drei Jahre im neuen Keller liegen lassen und dann einfach wegschmeiÃen.)
—
In der neuen Wohnung stand dann das Arbeitszimmer an. Die MÃķbel hatten die Umzugshelferlein schon dorthin getragen, wo sie sein sollten. Nun rÃĪumte ich BÞromaterial aus Kisten aus und in meinen Container wieder ein, ordnete Aktenordner nach Datum, stellte meine aktuellen âJobsâ- und âDissâ-Ordner in meine NÃĪhe und begann, das kleine Kallax mit KunstbÞchern zu fÞllen. Bisher hatten alle meine BÞcher in den sechs Billys gestanden; nun wollte ich aber die KunstbÞcher im Arbeitszimmer haben, denn die Diss ist Arbeit. Ein Teil der BÞcher lag in den Kisten hier im Arbeitszimmer, die anderen vermutlich in den Kisten in der Bibliothek. (Ich habe hier kein Wohnzimmer, ich habe hier eine Bibliothek. Ja genau.)
Im Arbeitszimmer steht auÃerdem mein altes Schlafsofa gegenÞber vom Schreibtisch. Vom Schreibtisch aus gucke ich nach rechts in den Innenhof bzw. auf lauter grÞne Balkons und ansonsten auf meine leere dunkelblaue Wand, was ich sehr beruhigend finde. Davor knallt das weiÃe Sofa natÞrlich richtig. Es hat sich schon in den ersten Tagen in dieser Wohnung eingebÞrgert, dass ich meinen Morgenkaffee genau dort trinke. Nicht wie sonst mit dem Rechner auf dem Schoà auf dem Sofa, das nun in der Bibliothek steht, sondern hÃķchstens mit dem Handy, meist nicht mal damit, nur mit meinem Kaffee auf dem Schlafsofa. Das ist Þbrigens das hier, und obwohl ich es eher unbequem finde, kann ich mich nicht von ihm trennen, weil es so hÞbsch ist! Das tragen mir arme Menschen seit 1999 von Wohnung zu Wohnung. Auf ihm gucke ich frisch geduscht und halbwegs wach einfach Þber den Balkon in den Innenhof bzw. darÞber hinaus und bin selbst erstaunt darÞber, wie schÃķn und entspannend das ist.
Nach links gucke ich vom Schreibtisch Þbrigens auf Luise, und das ist ebenfalls schÃķn und entspannend. Das Arbeitszimmer ist genau so geworden, wie ich es erhofft habe, und das freut mich sehr. (To do: Lampen aussuchen. Lampen andÞbeln. Oder demnÃĪchst bei Kerzenlicht arbeiten.)
—
Nachmittags war dann WohnungsÞbergabe. Die Verwaltung hatte das vereinfacht: Anstatt zuerst mit mir durch das Ãbergabeprotokoll zu gehen und dann nochmal mit dem Nachmieter, waren wir einfach alle gleichzeitig vor Ort. Das ging auch problemlos, aber ich merkte, dass mein Kloà im Hals immer dicker wurde. Total beknackt, ich habe ja jetzt eine viel tollere Wohnung! Aber ich hing wohl doch mehr an der Studibutze auf Zeit, dem Zweitwohnsitz, dem Provisorium, der Ãbergangswohnung, als ich dachte.
—
Abends briet ich mir Frikadellen, weil comfort food. Mein Metzger wolft Hackfleisch frisch durch, da liegt keine Wanne stundenlang in der Theke. Vermutlich schmeckt’s auch deshalb so gut. Bye-bye, Wohnung, ein Klops auf dich! Du warst sehr gut zu mir.
Und jetzt fangen wir ein neues Kapitel an. Keine Ãbergangswohnung mehr oder irgendeine, in die ich rein muss, weil ich sonst noch Monate auf dem Sofa des ehemaligen Mitbewohners hÃĪtte zubringen mÞssen, sondern eine, die ich mir ausgesucht habe, weil es ging. Eine, in die wieder alle meine Habseligkeiten reinpassen. Eine, in der ich wieder mehr als Texterin wohne denn als Studentin. Eine, in der ich noch eine Weile in Ruhe ÃĪlter werden mÃķchte.
—
Nachtrag: Tagebuch Samstag 22. September 2018 â Umzugstag
FÞr den Umzug ab 10 Uhr morgens hatten sich insgesamt sechs Helferlein angeboten, mit F. und mir tummelten sich acht motivierte Leute in der WhatsApp-Gruppe, die Þber die genaue Adresse informierte und darÞber, bitte am leeren Klingelschild zu lÃĪuten, denn ich war natÞrlich oben im fÞnften Stock und hibbelte vor mich hin.
Alle Billy-Regale waren von EinlegebÃķden befreit, die Nupsis, die sie hielten, lagen in einer kleinen TÞte schon unten auf der Fensterbank des betreffenden Raums. In meinem einzigen Zimmer oben stapelten sich Umzugskartons, IkeakÃķrbe und Einkaufskisten aus Plastik, dazu der Þbliche Quatsch, den man nicht einpacken kann: meine riesigen Sofakissen zum Beispiel. Beim letzten Umzug aus Hamburg hatte ich bei den Profis zugeguckt: Sie schlugen die Kissen in meterlange Folie ein und brachten sie so sauber und sicher nach MÞnchen. Das machte ich fÞr ein Stockwerk auch und war danach versucht, ALLES in Folie einzuschlagen, weil das groÃen Spaà machte. Ich wickelte meine hohe Kommode im Flur mit Folie ein und die zwei groÃen Ikearegale (Bonde â gibt’s schon ewig nicht mehr), die jeweils zwei GlastÞren haben. Auch die sollten schlieÃlich heile nach unten und mÃķglichst nicht mitten im Treppenhaus aufgehen.
In der WhatsApp-Gruppe wurde gefragt, ob noch Werkzeug benÃķtigt wÞrde; nein, meinte ich, alles da, alles auseinandergebaut, was geht, alles eingepackt, ihr mÞsst nur schleppen. Eine Dame meldete sich mit zu spÃĪt gestelltem Wecker, sie kÃĪme erst gegen halb 11. Und ich meinte launig: Um halb 11 sind wir schon fertig.
âSchaff es erst um halb elf.â
'Haha, bis dahin ist der Umzug durch.'Sie hatte recht. Frau @ankegroener hat eventuell ihre Berufung als Umzugs-Magierin verfehlt.
— Isabella Donnerhall (@DonnerBella) 22. September 2018
Zur ErlÃĪuterung: Frau Donnerhall hatte im Vorfeld erwÃĪhnt, dass sie bitte nur Kisten tragen mÃķchte, keine MÃķbel. Kann ich verstehen, will ich auch nicht. Und als sie um halb 11 kam, waren halt wirklich schon alle Kisten unten und auch diverse MÃķbel. Die schleppenden Jungs und meine Nachbarin, die spontan Hilfe angeboten hatte, waren ernsthaft in einer Stunde mit allem durch. Ich fiepste nur noch vor Dankbarkeit, bekam fÞnfmal gesagt, dass aber auch alles tiptop vorbereitet gewesen war und das Treppenhaus irre breit und umzugsfreundlich sei und Þberhaupt, alles kein Ding.
Ich begann darÞber nachzudenken, vielleicht doch noch den Zug um 13 Uhr nach Augsburg zu nehmen, wo der FCA ein Heimspiel gegen Bremen hatte, andere dachten Þber die heute zu erÃķffnende Wiesn nach, wir machten die ersten Biere auf und lungerten auf dem Balkon rum. Bis auf zwei von uns, F. und sein bester Freund C., denn die hatten sich fÞr die Waschmaschine zustÃĪndig erklÃĪrt, die oben abgenommen und unten wieder angeschlossen werden sollte. Aber das hatte C. schon tausendmal gemacht, hier unten war ein Anschluss vorhanden, alles super.
Haha.
Um es kurz zu machen: ZunÃĪchst gingen F. und C. zu SuckfÞll, einem âWir haben allesâ-Laden in UninÃĪhe, weil irgendein Verbindungsschlauch schon arg schrottig aussah. Dann fuhren F. und ich zu einem Baumarkt, weil wir eine Weiche brauchten, vielleicht noch einen Winkel, noch ein paar Ventile und Zeug, von dem ich nicht weiÃ, was es macht. Ein paar Tage vor dem Umzug hatte mir die Verwaltung schon einen Klempner vorbeigeschickt, denn meine charmante Vormieterin hatte ernsthaft einen Schlauch, der zur GeschirrspÞlmaschine fÞhrte, mit Panzerband geklebt anstatt ein neues Ventil einzusetzen. Ich wunderte mich bei meinen Renovierungsarbeiten Þber die groÃe Plastikunterlage vor der SpÞle, die ich in einer anderen Funktion kannte: als Parkettschutz bei SchreibtischstÞhlen. Die lag halt in der KÞche und unter der SpÞle stand ein kleiner blauer Eimer, den ich als MÞlleimer fehlinterpretierte. Als ich das erste Mal meine Pinsel und Farbrollen auswusch, erkannte ich, was der wahre Zweck der beiden GegenstÃĪnde war: Das bunte Wasser lief am Panzerband vorbei in den Eimer, und aus irgendeiner anderen Ecke tropfte Zeug auf die Plastikunterlage. Das meldete ich natÞrlich sofort der Verwaltung, es kam jemand vorbei, der brachte einen neuen Schlauch an, meinte aber, der wÃĪre gar nicht nÃķtig, lieà mir ein Blindventil da, das wir anschrauben sollten, wenn die Waschmaschine dran sei â und dann guckte er noch auf den Wasserhahn, der lustig von unten vor sich hinrostete. Der mÞsste auch mal ersetzt werden, er wÞrde sich wieder melden.
Das tat er aber nicht, und so kaufte ich am Samstag im Baumarkt gleich mal einen anstÃĪndigen Wasserhahn, mit dem ich arbeiten kann. Die HÃĪhne hier im Haus sind so flach Þber der SpÞle angebracht, dass ich nicht mal meinen Wasserkocher aufrecht darunterkriege geschweige denn einen groÃen Topf fÞr Pasta. In meiner oberen Wohnung ging das bis vor Kurzem noch, bis ich neue Armaturen bekam, und ich ahnte, dass ich auch hier unten wieder so einen flachen Quatschhahn kriegen wÞrde. Also kaufte ich selbst ein und habe jetzt einen Hahn, unter dem Philipp Lahm stepptanzen kÃķnnte, so hoch ist er. (Diese Art, nur billiger.)
Aber erstmal musste er eingebaut werden. Als C. den alten Hahn entfernte, sah ich, dass die Dichtungsringe quasi weggerottet waren; kein Wunder, dass da alles lustig rumtropfte. Interessanter LÃķsungsansatz mit Eimer und Matte, aber COME ON! Egal. Jetzt nur noch die Waschmaschine anschlieÃen. Ein Helfer und meine Nachbarin hatten sich schon verabschiedet, die anderen lagerten auf dem Balkon, nachdem sie vom GetrÃĪnkemarkt gegenÞber eine Runde Oktoberfestbier besorgt hatten. C. verschwand unter der SpÞle, ich saà mit den anderen auf dem Balkon, als es hieÃ, ich solle doch mal kurz kommen.
Ich mach’s wieder kurz: Es fehlte immer noch irgendwas, weil sich beim Einbau immer neue Hindernisse auftaten. Wir mussten das Loch in der Holzverkleidung fÞr den Schlauch vergrÃķÃern, was lustig mit Holzbohrern und Schmirgelpapier passierte, weil niemand eine SÃĪge oder eine Feile besaÃ. (Ich hatte mal zwei SÃĪgen. Ich ahne, dass die beim letzten Umzug in der alten Wohnung verblieben und nun Hamburger SperrmÞll sind.) Dann mussten wir die Trennwand zum KÞhlschrank entfernen, die eh nur Deko war, weil die Maschine ernsthaft zu breit fÞr die Ãffnung war (ich hatte nicht nachgemessen â wenn mir die Verwaltung sagt, dass da ne Maschine hinpasst, dann gehe ich davon aus, dass das stimmt). Und schlieÃlich musste noch der Deckel der Maschine weichen, weil sie sonst nicht unter die Arbeitsplatte gepasst hÃĪtte. Mir war alles recht, Hauptsache, ich konnte irgendwann wieder waschen.
In der oberen Wohnung stand dann allerdings doch noch etwas, das runtermusste: Luise. Eigentlich wollten F. und ich das alleine machen, wenn alle anderen wegwaren und niemand in das Bild stolpern konnte. Aber da F. mit C. unter der SpÞle hing, boten sich zwei Herren an, die zwar schon fÞnf Bier intus hatten, aber absolut der Meinung waren, noch ein arschteures ÃlgemÃĪlde an die Wand zimmern zu kÃķnnen. Konnten sie. BÞndig mit dem TÞrrahmen, mittig zwischen Fenster und TÞr und perfekt ausgerichtet. Ich war beeindruckt.
Der @tobi_vega u d @alex_muc86 haben Luise platziert ððð pic.twitter.com/4Z7TpcNTIZ
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 22. September 2018
WorÞber ich mich freute: dass irgendwie keiner gehen wollte, weil’s grad so nett war. Ich hatte inzwischen den vorbestellten LeberkÃĪse besorgt, wir mampften vor uns hin und lieÃen es uns gut gehen. Und: Ich mochte die kurze andÃĪchtige Stille, als Luise an der Wand hing und alle einfach aufs Bild guckten. Ich weià nicht, ob es das freundliche Motiv ist oder die Faszination eines groÃen GemÃĪldes im schweren Goldrahmen, aber ich fand das sehr schÃķn, dass ich anscheinend nicht die einzige bin, die es mag.
Irgendwann gegen 16 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, war dann auch die Waschmaschine angeschlossen, fÞr die F. noch ein zweites Mal zum Baumarkt fahren musste. Die KÞche sah aus wie ein Schlachtfeld, ich hatte kein sauberes Handtuch mehr, Þberall lag Werkzeug und es standen dazu natÞrlich auch noch Kisten rum. Aber: Wir waren fertig und obwohl unter der SpÞle alles anders aussah als vorher, saà das kleine Blindventil auch irgendwo rum. Nach und nach gingen alle bis auf F. und Alex, denn wir Þberlegten kurz, ob wir noch ein Absackerbierchen auf der Wiesn nehmen sollten. F. hatte eine Reservierung fÞr 17 Uhr auf der Oidn Wiesn und den Tisch eigentlich an einige seiner Freunde aus England und den USA abgegeben, aber es waren noch zwei PlÃĪtzchen am Tisch frei, und die schnappten Alex und ich uns jetzt. Verschwitzt, aber glÞcklich schnatterten wir mit wildfremden Menschen, aÃen RostbratwÞrstchen und tranken ein winziges bisschen Alkohol.
Auf dem RÞckweg erstand ich die traditionellen gebrannten Mandeln, schwankte mit F. zu mir in die neue Wohnung, manÃķvrierte uns an allen Kisten vorbei und konnte endlich mal wieder eine Nacht durchschlafen. Bester Umzug ever!
—
Tagebuch, Sonntag, 16. September 2018 â Open Art
Gestern klapperten F. und ich einige der Galerien ab, die sich an der diesjÃĪhrigen Open Art beteiligten. Wir starteten bei Karin Sachs, die gerade Arbeiten der iranischen KÞnstlerin Parastou Forouhar zeigt. Mir gefielen die Fotografien aus der Reihe âThe Grass is Green, the Sky is Blue, and She is Blackâ sehr (die fÞr mich aber nicht bezahlbar waren) und genoss den von der KÞnstlerin selbst gestalteten Galerieraum, in den sie sinnlose Schriftzeichen gesetzt hatte, die an die arabische Schrift erinnerten. Wir kannten die Dame aus einer Ausstellung in der Villa Stuck, wo wir sie bei Common Grounds gesehen hatten (Fehlfarben-Podcast von 2015 dazu).
Danach kamen ein paar AusfÃĪlle; weder bei Barbara Gross noch bei Jo van de Loo konnte mich irgendetwas so richtig Þberzeugen. Und auch nicht bei den beiden LÃĪden nebenan, die nicht auf dem Plan verzeichnet sind. Dann aber schauten wir in der Micheko-Galerie vorbei â und verliebten uns beide in das gleiche grafische Blatt von Katsumi Hayakawa. AuÃerdem staunte ich sehr lange Þber die filigranen Gebilde an der Wand, die eine Mischung aus BauplÃĪnen und MiniaturhochhÃĪusern aus Blade Runner waren. Auch sie hÃĪtte ich sofort mitnehmen wollen, aber: jetzt gerade nicht, geldmÃĪÃig. Leider. Aber dieses grafische Blatt â ich dachte Þber meinen Kontostand nach und Þberlegte.
Wir gingen weiter und besuchten beide Locations der Galerie KlÞser, wo ich auch gerne mehrere Werke eingepackt hÃĪtte. In der ersten Location hingen sogar bezahlbare Picassos (und unbezahlbare Cy Twomblys), aber ich verknallte mich in die Fotografien von Jitka HanzlovÃĄ, die Teile ihrer Serie âFlowersâ ausstellte, die mich an den GroÃmeister Karl Blossfeldt erinnerten. Ich mochte ihre zarte, fast irreale Farbigkeit und die Strenge der Darstellung.
In der zweiten Location passierte dann das, wovor ich mich gefÞrchtet hatte: Ich sah ein Werk, das ich sofort hÃĪtte mitnehmen wollen. Nicht mehr Þber den Kontostand nachdenken, nein, gleich einpacken und aufhÃĪngen, denn jetzt habe ich ja irre viele freie WÃĪnde! Aber ich beherrschte mich, werde brav darÞber schlafen und diese Woche noch mehrmals vorbeikommen, um zu gucken, ob das kleine bunte Blatt von Alex Katz immer noch die gleiche Faszination auf mich ausÞbt wie gestern.
F. zu mir: âDruckgrafik ist die Einstiegsdroge.â JA DANKE AUCH. Ich wollte gerade einwenden, dass ich noch nie Kunst gekauft hatte, bis mir einfiel, dass ich mehrere Katia Kelms besitze sowie die irre groÃe Luise. Und mit drei Leo von Weldens bin ich quasi Sammlerin, auch wenn ich fÞr die BlÃĪtter und Bilder nichts bezahlt habe, sondern sie von der KÞnstlertochter geschenkt bekommen habe. Jetzt dÞrfen auch sie endlich an die Wand.
Wir kehrten in den Georgenhof ein, um uns nach dem FuÃmarsch zu stÃĪrken, KÃĪsebrot fÞr mich, Leberwurstbrot fÞr den Herrn, und dann ab in die letzte Galerie. Sabine Knust zeigt gerade afro-amerikanische und afrikanische KÞnstler*innen, und auch dort hing ein Blatt, bei dem ich sofort die GeldbÃķrse zÞcken wollte. Aber auch hier schlafe ich drÞber, gehe noch fÞnfmal gucken, ob mir Alison Saar weiterhin gefÃĪllt und dann Þberlege ich, welches Blatt ich mir selbst zur neuen Wohnung schenke.
Auf dem RÞckweg schauten wir ein weiteres Mal bei der Micheko-Galerie vorbei und schon da merkte ich, dass ich das Blatt zwar immer noch toll fand, aber die anderen beiden besser. Mal sehen, ob F. sich das Ding gÃķnnt. Dann kann ich es auch immer anschauen. Praktisch!
—
Und wo wir gerade bei Anschauen sind: Vor Kurzem entdeckte ich den franzÃķsischen Fotografen Nicolas Krief auf Instagram. Der Herr fotografiert gerne Menschen beim Kunstgucken, aber, noch toller, Menschen beim Kunstaufbauen. Ich verlinke mal seine Website, wo ihr euch bitte durch Accrochages 1 und Accrochages 2 klickt. Leider steht bei den Fotos nicht, welche Kunstwerke gerade abgebildet sind; in seinem Instagramstream macht er das manchmal. Hier ein paar Kostproben.
—
Leserinnenpost
Ich verlinkte gestern den Zeit-Artikel Þber Sigmund JÃĪhn und erwÃĪhnte, dass die DDR ein fremdes Land fÞr mich war und vielleicht geblieben ist. Daraufhin bekam ich eine lange Mail, die ich mit Zustimmung der Verfasserin verÃķffentlichen darf. Wir kennen uns ein wenig â die Dame hat ein PortrÃĪt Þber mich geschrieben â und wir telefonierten noch, nachdem ich per Mail fragte, ob ich ihre Zeilen bloggen durfte. Danach glaube ich: Wir sollten mehr miteinander reden. Nicht die AfD-AnhÃĪnger mit ihren Gegnern, das halte ich inzwischen fÞr rausgeschmissene Zeit, aber: BRD-BÞrger*innen mit DDR-BÞrger*innen. Schreibt DDR-Blogs! ErzÃĪhlt mir von eurem Land und von euren Biografien!
Mir ist auÃerdem aufgefallen, dass ich, wenn ich die DDR als Ausland zÃĪhle, was sie ja war, sie Ãķfter besucht habe als jedes andere Land auÃerhalb meines eigenen. Ich war Ãķfter in der DDR als in Frankreich, den USA oder DÃĪnemark. Ich verlinke mal einen Uralt-Blogpost, der das etwas illustriert.
Aber jetzt zur Leserpost, die ich sehr spannend fand. Darin wird auch die Landflucht beschrieben, die mir in diesem Ausmaà nicht klar war. Im letzten Spiegel stand dazu ein aufschlussreicher Artikel, leider momentan nur als Spiegel-Plus lesbar.
—
Liebe Frau GrÃķner,
ich habe wie Sie den Text von Jana Hensel in der ZEIT gelesen. Sigmund JÃĪhn: das war ein Begriff in meiner Schulzeit. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er quasi aus der Region stammt. (Meine Schule trug den Namen âJuri Gagarinâ. Der Musiklehrer hatte ihm zu Ehren ein Lied komponiert, das zu den Appellen gesungen wurde. Es begann so: â13. April des Jahres â61, die ganze Erde schaut aufâĶ) ZurÞck zu MorgenrÃķthe-Rautenkranz (JÃĪhns Geburtsort) â damit verbinden viele Ostdeutsche Raumfahrt, Weltall, unerreichte Weiten. (Dass das Dorf ein KÃĪlteloch ist und in the middle of nowhere liegt, ist unerheblich.)
Sie schreiben, die DDR war ein fremdes Land fÞr Sie. Vielleicht ist es das auch geblieben. Mir war die Bundesrepublik nicht ganz so fremd â hatte ich doch Westverwandtschaft und eine Brieffreundin. Eine Zahnarzttochter, deren Eltern Schweden waren. Schon allein diese Kombi war etwas ganz Besonderes. Leute, die sich einfach so in einem anderen Land ihre Existenz aufbauen konnten, gut Geld verdienten, in der Welt umher reisten und interessehalber uns besuchten. Der erste Besuch fiel genau mit dem UnglÞck in Tschernobyl zusammen. Irre, wie unterschiedlich die Angst vor Verstrahlung war. Lundbergs waren informiert; wir nicht. (Wir waren recht unbekÞmmert. SchlieÃlich holte mein Vater tÃĪglich Uran aus dem Berg. Ihm fielen weder die ZÃĪhne noch die Haare aus, noch hatte er LeukÃĪmie oder Lungenkrankheiten. Damals zumindest.)
Was mir von diesen Stippvisiten in Erinnerung blieb, ist der Minderwertigkeitskomplex. Wir konnten nix vorweisen â weder Haus, Auto noch Reisen. Ich habe mich manchmal geschÃĪmt. Drei Jahre spÃĪter kam alles anders. Der Mauerfall ist nach wie vor eines der grÃķÃten Ereignisse meines Lebens. Dass das alles friedlich und ohne BlutvergieÃen ablief â das halte ich persÃķnlich fÞr ein Wunder. Selbst nach fast dreiÃig Jahren zieht es mir die GÃĪnsehaut auf.
Allerdings hat keiner mit dem Affentempo der Wiedervereinigung und ihren Folgen gerechnet. Vom Herbst 1989 bis 1991 fÞhlte sich das Leben wie ein Schleudergang an. Nix war mehr sicher. Unsere Generation wurde blitzartig erwachsen. Wir regelten teilweise das Leben unserer Eltern: manchen Leuten fehlte einfach der Schneid (weil Arbeit weg etc.). Woher sollten sie den so fix herhaben? Der GroÃteil lief in der Masse mit. Alles war vorherbestimmt: Schulabschluss, Lehre, wenn es hoch kam Studium, Heirat mit 18,19,20 wegen Wohnung und Familienkredit, Arbeitsplatz ohne groÃartige Pendelei.) Um die Basics hat sich der Staat gekÞmmert; wollte man mehr, musste man Mittel und Wege finden. Vieles ging Þber Dritte; Menschen, die Beziehungen hatten oder wieder Leute an entscheidender Stelle kannten.
Die Kommunikation Þber Dritte, die Hoffnung, dass jemand von oben das regelt â das eitert einfach nicht heraus. (Die Generation unserer Eltern versucht das immer noch.) Vielleicht kann das helfen, sich der Ostdeutschen Denke anzunÃĪhern.
Seit den ersten Pegida-Demos in Dresden (das geht schon seit 2015), frage ich mich, warum hier solche Gedanken Humus finden. Die Masse hat Arbeit. Haben beide Eltern Jobs, ist ein Urlaub im Jahr mindestens drin. Die Bildung stimmt â auch wenn uns hinten und vorn die Lehrer fehlen. Der Spagat Familie-Beruf ist â zumindest auf dem Land â machbar. Auf dem Land: da leben die, die da geblieben sind. Leute, die ziemlich gebrochene Erwerbsbiografien haben, die nicht weggehen wollten, die keinen Schneid hatten, die ihre Wurzeln nicht kappen wollten oder konnten. Die jungen, gut ausgebildeten haben die Flucht ergriffen und tun es noch. Ich weiÃ, das ist kein typisch ostdeutsches Problem. Die Dimension der Landflucht allerding schon. Was nahezu komplett fehlt, ist meine Generation. Dreiviertel meiner ehemaligen Klasse (Oberschule) weg, dreiviertel meiner Seminargruppe (Fachschule) arbeitet in westdeutschen Kliniken, mehr als die HÃĪlfte meines Abiturjahrgangs weg. Diese LÞcke fÞhlen wir tagtÃĪglich. Umgeben von Senior*innen in beigefarbenen Westen, die auf ihre Jugend zurÞck blicken, den Wert von Heimat ganz anders definieren als wir und sich nicht als Teil der Gesellschaft sehen, braucht man ein breites Kreuz. Ein sehr breites.
Blitzgescheite, reflektierte Menschen haben es mitunter sehr schwer. Dinge zu hinterfragen, dass das eigene Tun Folgen hat, jeder fÞr sich verantwortlich ist oder Demokratie auszuhalten â das zÃĪhlt nicht unseren Kernkompetenzen. Die Generation unserer Eltern tut sich damit sehr schwer. Wir, die Mitte der 1970er geborenen, Þben uns darin. TÃĪglich.
Vielleicht ist das der Vorsprung, den man in den alten BundeslÃĪndern uns gegenÞber hat. Nach dem zweiten Weltkrieg zogen in den drei westlichen Besatzungszonen demokratische VerhÃĪltnisse ein. Die russischen Besatzer kannten nichts anderes als Diktatur. WÃĪhrend man in der BRD vierzig Jahre Demokratie ausprobieren durfte, sie erlernen konnten, stolperten wir â gewollt â hinein. Ruhiggestellt von DM-Mark und Reisefreiheit hat sich keiner so richtig fÞr die Demokratie interessiert. Abgelenkt von Massenarbeitslosigkeit kÞmmerte man sich um sich. Nur um sich.
Jetzt, wo wir nahezu VollbeschÃĪftigung haben, ist das immer noch so. Viele sind sich selbst der NÃĪchste. Gesellschaftliches Engagement findet im FuÃballverein, der Feuerwehr oder im SchulfÃķrderverein aber kaum in der FlÞchtlingshilfe statt. Hauptsache, uns geht es gut und wir kÃķnnen den Wohlstand halten. Globales Denken oder gar Verantwortung â Fehlanzeige.
Dass etwas im groÃen Ganzen nicht stimmt, merken die Leute seit der FlÞchtlingskrise. Auseinandersetzen will man sich damit nicht. âDas sollen die da oben regeln.â Merken Sie, da ist er wieder der Ruf nach einer dritten Person. Wie sich aber die Ereignisse Þberschlugen, die Kommunen mit der Unterbringung Þberfordert waren, auf einmal Leute da waren, die eine geballte Ladung Testosteron mitbrachten bzw. manche deutsche Verhaltensregeln nicht kannten oder ignorierten, wuchs der Frust. âWarum soll ich im Bus bezahlen und der AuslÃĪnder nicht?â FÞnf Euro fÞr ein Ticket sind fÞr mich kein Thema; fÞr manch ÃĪltere Dame mit Mindestrente schon. Das sei nur als Beispiel genannt. Aber das Aussitzen unserer SÃĪchsischen Staatsregierung trug dazu wesentlich bei. Es entschuldigt nicht das Verhalten der Sachsen/ SÃĪchsinnen, die wieder mitlaufen und simple LÃķsungen fÞr ein komplexes Problem haben wollen.
Ich persÃķnlich ziehe vor dem jetzigen MinisterprÃĪsidenten Kretschmer den Hut. Er soll binnen eines reichlichen Jahres die Kohlen aus dem Feuer holen, die Tillich, Milbradt und Konsorten verursacht haben. Er ist authentisch; logisch, dass ihm Fehler passieren. Die Beharrlichkeit des Dialogs ist anerkennenswert. Es muss aber sein. Ohne diesen Draht erfahren wir nichts voneinander.
Was mich immer wieder den Kopf schÞtteln lÃĪsst, ist die Tatsache, dass dreiÃig Jahre fÞr zur Ausbildung eines demokratischen SelbstverstÃĪndnisses nicht ausreichen. Eine letzte Ãberlegung dazu: Mit dem Abriss von Kirchen (siehe Paulinum Leipzig; StÃĪdtebaupolitik Walther Ulbricht) fielen auch die christlichen Werte. Was den Leuten heilig ist, wissen sie oft selbst nicht. Trotzdem rennen sie den VerkÞndern solcher Werte nach. Klingt an den Haaren herbeigezogen; sollte aber mitbedacht werden.
Die WÞrde des Menschen unantastbar. Das schmierâ ich den Leuten aufs Brot â ob sie es hÃķren wollen oder nicht. Denn ÃĪndern lÃĪsst sich die Misere nur, wenn wir miteinander und nicht Þbereinander reden.
Herzlichst!
Beatrix
—
Was schÃķn war, Samstag/Sonntag, 25./26 August 2018 â Politische Goldene Hochzeit
Samstag frÞh um kurz vor acht trug ein schnuffiger IC F. und mich ins SchwÃĪbische, wo mein Patenonkel und seine Frau ihre Goldene Hochzeit feierten. Normalerweise sitzen wir lesend oder dÃķsend im GroÃraumwagen nebeneinander, wenn wir lÃĪnger Zug fahren, aber hier gab es nur Abteile, wir hatten netterweise eins fÞr uns, und so klÃķnten wir entspannt bis Ulm. Das fehlende DÃķsen rÃĪchte sich ein bisschen in einem Nachmittagstief, aber das konnten wir mit Kaffee und frischer Luft bekÃĪmpfen.
Wir hatten in Ulm zwar bewusst eine gute halbe Stunde Aufenthalt zum Umsteigen gewÃĪhlt anstatt der auch mÃķglichen sieben Minuten, aber die Zeit reichte natÞrlich nicht, um kurz zum MÞnster rÞberzuhÞpfen. Ich bewunderte es beglÞckt aus der Ferne.
Am Zielort angekommen, wurden wir mit dem Auto abgeholt und zur ungefÃĪhr 800 Meter entfernten Kirche chauffiert, da hatte sich Frau GrÃķner in Maps arg bei der Entfernung verguckt. So waren wir etwas zu frÞh da, konnte dafÞr aber dem Posaunenensemble mehrfach dabei zuhÃķren, ein Motiv aus einem der spÃĪter zu singenden Lieder zu spielen. Ãberhaupt war es schÃķn, mal wieder laut zu singen, vor allem âBewahre uns Gottâ, das mag ich sehr gerne. (Memo to me: endlich in MÞnchen eine Gesangslehrerin suchen.)
Dann ging’s mit der ganzen Festgesellschaft in einen nahegelegenen Gasthof, wo die Þblichen Familienfeierportionen auf uns warteten. Ich glaube allmÃĪhlich, fÞr derartige Feste trainiert man sich im Laufe seines Lebens einen eigenen Magen an. Wir hatten eine ÃĪuÃerst angenehme Tischgesellschaft, darunter auch den Sohn des Ehepaars und seine Frau, die schon bei der Goldenen Hochzeit meiner Eltern an meinem Tisch gesessen hatten. So konnten wir quasi nahtlos an unsere GesprÃĪche Þber Kunst und Religion â die beiden sind Pastor*innen â anknÞpfen.
Was mir an der Feier besonders gefallen hat, war das Rahmenprogramm, wenn man es so nennen kann. Das Ehepaar selbst hatte sich die Þblichen Bilder ausgesucht, die nach dem Mittag und vor Kaffee und Kuchen gezeigt wurden â also im kleinen Zeitfenster von gefÞhlt 20 Minuten. Wir sahen Dias von der Hochzeit (Dias = gescannte Fotos Þber Beamer und Laptops der SÃķhne), einige Menschen wurden besonders erwÃĪhnt, weil sie nicht mehr am Leben waren und man an sie erinnern wollte. Und dann erwartete ich den Þblichen RÞckblick auf 50 Jahre Familienleben, aber: Die SÃķhne hatten sich etwas leicht anderes ausgedacht. Sie erinnerten daran, dass die Eltern ja ausgerechnet 1968 geheiratet hatten â ein Jahr, das fÞr die Gesellschaft der Bundesrepublik eine gewisse historische ZÃĪsur war. Praktischerweise waren viele der GÃĪste im Saal damals auch schon dabeigewesen, man habe also eine Menge Zeitzeugen versammelt, die der nachfolgenden Generation vielleicht etwas erzÃĪhlen konnten. Und so starteten sie die Fragerunde gnadenlos mit einem Bild des Prager FrÞhlings und fragten ihre Eltern, wie sie die Ereignisse damals erlebt hÃĪtten. Was ich spannend fand â und womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte: Nicht nur das Ehepaar erzÃĪhlte kurz, sondern es schilderten auch sofort einige GÃĪste ihre Sicht. So meinte die Frau meines Patenonkels, dass sie die Ereignisse zwar mitbekommen hÃĪtte, aber keine Angst gehabt habe, woraufhin sich eine ÃĪltere Frau mit erkennbar sÃĪchsischem Akzent meldete, deren Freunde damals bei der NVA gewesen waren, um die hÃĪtte sie schon Angst gehabt. Ein Herr meinte, er wÃĪre damals gerade frisch bei der Bundeswehr gewesen und auch dort sei diskutiert worden. Alleine fÞr diese fÞnf Minuten hatte sich die ganze Feier gelohnt. (Ich erwischte mich wie in guten Vorlesungen dabei, mit offenem Mund zuzuhÃķren.)
Es kamen natÞrlich auch entspannendere Fragen dran; wir hÃķrten Heintje und sahen das Plakat von âZur Sache, SchÃĪtzchenâ, verbunden mit Fragen zu eigenen Lieblingssongs oder ob man gemeinsam im Kino war. War man interessanterweise eher selten, woraufhin ich meine Eltern, die auch da waren, gleich mal fragte, wie das bei ihnen war; ich wusste ja, dass Mama Autogramme der gesamten deutschen Filmbranche der 50er Jahre gesammelt hatte und dass Papa stapelweise Filmprogramme von Western im Keller hortete, aber auch die beiden waren kaum gemeinsam im Kino gewesen. Wieder was gelernt. Auch lustig: Bei der Frage, ob es die Hippiebewegung auch in die schwÃĪbische Kleinstadt geschafft hÃĪtte, gingen die Meinungen sehr auseinander, von âDavon habe ich nichts mitbekommenâ bis zu einem verschmitzten âAber halloâ.
Das Ehepaar ist bis heute ehrenamtlich sehr engagiert, was bereits damals begonnen hatte. So erzÃĪhlte die Frau meines Patenonkels von der Umbenennung der mÃĪnnlichen und weiblichen PfadfinderverbÃĪnde bzw. der neuen Logoentwicklung. Kurz zuvor war aus dem Christlichen Verein junger MÃĪnner der Christliche Verein junger Menschen geworden. Bei den Pfadfindern wollte sie diese âVereinnahmungâ der Frauen nicht einfach so hinnehmen und sie erklÃĪrte uns das Logo des 1973 entstandenen, gemeinsames Vereins : Die Lilie entstamme den christlichen Pfadfindern, das Kleeblatt drumrum den Pfadfinderinnen; beide bleiben sichtbar. Und ich saà wieder mit offenem Mund rum.
Ich fand es spannend, bei Menschen, die man seit fast 50 Jahren kennt, noch neue Facetten zu entdecken. Gerade meine âTanteâ hatte ich jetzt gar nicht als eine so dezidierte Streiterin fÞr Frauenrechte wahrgenommen, obwohl mir die menschenfreundlichen und fortschrittlichen Ansichten der beiden natÞrlich klar gewesen war. Das war mit dem Effekt vergleichbar, wenn man alte Fotos der eigenen Eltern anschaut, die vor der Zeit entstanden sind, bevor man selbst auf der Welt war; es ist immer seltsam sich daran zu erinnern, dass die eigenen Eltern mal in dem Alter waren, in dem man selbst ist, mit ÃĪhnlichem Quatsch im Kopf, mit einem Lebensentwurf, mit Zielen und PlÃĪnen. Sie waren Einzelpersonen, bevor sie ein Paar und Eltern wurden, aber ich kenne sie halt nur im Doppelpack und vergesse manchmal, dass auch sie sich finden und zusammenraufen mussten.
—
Wir fuhren abends wieder nach MÞnchen zurÞck, und nach dem langen Tag schlief ich recht schnell ein und erholte mich den Sonntag Þber alleine von den vielen Menschen am Samstag. Ich machte einen langen Spaziergang zu einer bewusst gewÃĪhlten weiter entfernten Packstation und holte frischen Espresso ab, fÞr den ich netterweise einen Gutschein geschenkt bekommen hatte. Dann schlief ich wie immer bei der Bundesliga auf dem Sofa ein, las ein bisschen die FAS, die ich gerade als vierwÃķchiges Geschenk der FAZ kriege, daddelte Candy Crush, plante im Kopf am Umzug weiter, bereitete mir abends herrliche FrÞhlingszwiebelpfannkuchen zu und schlief ebenso entspannt ein wie am Samstag.
—
Was schÃķn war, Montag, 21. August 2018 â Der SchlÞssel zum Luftschloss
Seit fast sechs Jahren wohne ich jetzt in MÞnchen in meiner Einzimmerwohnung mit WohnkÞche aka Wohnschlafzimmer plus KÞche mit Arbeitsecke. Als ich hierherzog, sollte das nur eine Zweitwohnung sein; ich kaufte bei Ikea ein Bett, einen Sessel, ein Regal, einen KÞchentisch, einen BÞrocontainer und eine Art halbe KÞchenzeile aus Edelstahl, um ein bisschen mehr ArbeitsflÃĪche zu haben (die von Anfang an eher AbstellflÃĪche wurde). Meine eigentlichen Habseligkeiten lagen schÃķn in Hamburg in unserer Riesenwohnung.
Als Kai und ich uns 2015 trennten, wurde aus dem Zweitwohnsitz der einzige Wohnsitz, und ich musste meinen Krempel, der sich bequem in 120 qm Altbau breitgemacht hatte, auf 44 qm Neubau quetschen. Was natÞrlich nicht funktionierte; bis heute steht Zeug bei meinen Eltern und noch ein winziges bisschen bei Kai. In MÞnchen wurde das Ikeabett auseinandergebaut und in den Keller gezerrt, damit mein Monstersofa (bestes Sofa ever, ich will nie wieder ein anderes) und eine Schlafcouch als Bettersatz Platz hatten. Das eine Regal wanderte in den kleinen Flur und wurde AbstellflÃĪche, und im Wohnzimmer fanden stattdessen sechs Billys mit AufsÃĪtzen ihre neue Heimat. Seitdem schaue ich verliebt auf diese BÞcherwand, denn das war ein Punkt auf meiner Bucket List: irgendwann eine Wohnung zu haben, in der ich eine komplette Wand mit BÞchern vollstelle, von Wand zu Wand, vom Boden bis zur Decke.
Auch deswegen mag ich meine kleine Wohnung; zudem hat man sie sehr schnell durchgeputzt, und ich verlege in ihr nie irgendwas, weil ich schlicht keinen Platz habe, um es zu verlegen. Aber so nach und nach gingen mir immer mehr Dinge auf den Zeiger. Solange ich ganz alleine hier war bzw. nur ab und zu mal der ehemalige Mitbewohner (auf dessen Sofa ich die ersten zwei Monate in MÞnchen gewohnt hatte) auf ein Bier vorbeischaute, war der Tisch in der KÞche immer ein Schreibtisch und halt ab und zu ein Esstisch. Ich esse seit Jahren am liebsten auf dem Sofa, den Teller irgendwie auf den Knien, auÃer wenn ich mir Spargel mache, den esse ich brav am Tisch. Aber das hat schon seinen Grund, warum ich gerne Dinge zubereite, die man in einen und aus einem tiefen Teller schaufeln kann. Neuerdings (jetzt auch schon drei Jahre, hui) habe ich aber nun F. an meiner Seite, der sehr gerne an meinem Tisch sitzt und sich bekochen lÃĪsst bzw. mit dem ich hier gerne eine Flasche Wein kÃķpfe. Deswegen muss ich dauernd meine BÞcher fÞr die Uni oder meine Unterlagen fÞr die Werbung oder meinen Steuerkram oder ÃĪhnliches wegrÃĪumen. Und weil ich keinen Platz habe, liegt das Zeug dann auf dem Drucker, der auf dem BÞrocontainer steht, oder auf der Heizung, oder hinter mir in einem der zwei Bonde-Regale, die auch aus Hamburg hierhergewandert sind. Nie hat irgendwas, mit dem ich arbeite, einen festen Platz, und das nervt. Ich bin keine Strickmutti, die nebenbei was fÞr Etsy bastelt, ich arbeite hier, wenn’s gut lÃĪuft, 40 Stunden die Woche wie an einem Agenturschreibtisch. Daher hÃĪtte ich gerne einen anstÃĪndigen Arbeitsplatz, an dem alles da liegt, wo ich es haben will und wo sich Arbeit nach etwas WertzuschÃĪtzendem anfÞhlt und nicht wie irgendwas, was ich halbherzig runterhusche, bevor ich den Tisch fÞr MÃĪnne decke.
Dann: das Schlafsofa. Ich hasse es, das Ding aufzubauen, und nach fast 20 Jahren ist die Matratze auch echt nicht mehr die beste. Deswegen werfen wir immer zwei normale Matratzen oben drauf, die tagsÞber hochkant hinter dem zusammengeklappten Schlafsofa an der Wand lehnen. Ich sehe das schon gar nicht mehr, aber es nervt trotzdem. Ich hÃĪtte gerne mal wieder ein Bett, in das ich abends einfach reinfallen kann anstatt es erst herstellen zu mÞssen.
Kurz: Ich quengele seit Monaten, dass ich wirklich gerne mal wieder ein Schlaf- und ein Arbeitszimmer hÃĪtte. Und weil meine TextertÃĪtigkeit in diesem Jahr richtig gut lÃĪuft, so als ob ich nie studiert hÃĪtte, begann ich vor einiger Zeit, spaÃeshalber in den Immobilienportalen nach einer neuen Wohnung zu schauen. Das lieà ich aber meist sofort wieder bleiben. Wenn Sie mÃķgen, kÃķnnen Sie ja mal nach drei Zimmern auf mindestens 60 qm in der Maxvorstadt schauen, dann wissen Sie, warum ich das wieder lieÃ. Da werden Summen abgerufen, die wirklich nicht mehr feierlich sind. Ich guckte also kurz, lieà es wieder, quengelte, guckte wieder, lieà es wieder, quengelte. AuÃerdem wollte ich nicht aus diesem Viertel raus, am liebsten wollte ich gar nicht aus diesem Haus raus, und einer meiner StandardsÃĪtze in den letzten Monaten zu F. war: âWenn hier irgendwas im Haus frei wird, zieh ich da rein.â
Und so ging ich vor zwei Wochen auf meinen Þblichen Samstagseinkauf und sah, dass direkt im Stockwerk unter mir jemand auszog. Ich wollte nicht so dreist in die Wohnung schauen und auch den armen schleppenden Kerlen nicht im Weg stehen, aber ich konnte mir natÞrlich ausrechnen, dass das mindestens zwei, vermutlich sogar drei Zimmer waren, die da schrÃĪg unter mir frei wurden.
Den Rest des Wochenendes schickte ich StoÃgebete zum Himmel, dass das bitte drei Zimmer sein mÃķgen und rief montags um eine Minute nach neun Uhr den Verwalter an, dem man deutlich anhÃķrte, dass er gerne erstmal reingekommen wÃĪre und einen Kaffee getrunken hÃĪtte. Trotzdem beantwortete er mir brav meine hektischen Fragen: âJa, die Wohnung ist frei, noch nicht wieder vermietet. … Drei Zimmer. … 82 Quadratmeter.â Und dann kam die Miete, und wenn Sie brav in den Immoportalen geguckt haben, dann hÃĪtten Sie jetzt genauso nach Luft geschnappt wie ich, nÃĪmlich: SO WENIG? Also natÞrlich immer noch eine irrwitzig hohe Zahl, aber fÞr diese Lage in MÞnchen … geschenkt will ich nicht sagen, aber ich hatte mit 300 mehr gerechnet. Und so bat ich dringendst um einen Besichtigungstermin und stellte im Kopf schon die MÃķbel um.
Die Besichtigung war dann eine Woche spÃĪter und ich war … ein winziges bisschen enttÃĪuscht. Muss ich leider zugeben. Bis jetzt wusste ich bei jeder Wohnung, in die ich zur Besichtigung reinkam, sofort, ja, die isses oder nee, die isses nicht. Bei dieser sagte mein Bauch: Hase, ich weià nicht so recht.
Das lieà ich mir natÞrlich nicht anmerken, fand alles pflichtschuldig toll und sagte, dass ich die Wohnung haben mÃķchte, denn hey, drei Zimmer in meinem Haus und bezahlbar? Was ist daran nicht super?
Genau das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, warum mein Kopf brav sagte, natÞrlich nimmst du die, bist du irre, die ist genau das, was du gesucht hast. Aber mein Bauch nÃķckelte rum und kam mit solchen Sachen wie âAber die hat keine Abstellkammer, alle meine Wohnungen hatten Abstellkammernâ oder âAch, Balkon brauch ich gar nicht so dringend, hatte ich noch nie, vermisse ich gar nichtâ oder âMeine geliebte BÞcherregalwand â das Balkonzimmer ist so doof geschnitten, dass ich keine ganze BÞcherwand mehr habe, und die liebe ich doch soâ oder âDas Bad hat so komische hellblaue Dekofliesenâ und wenn ich meinem Bauch nicht irgendwann gesagt hÃĪtte, er solle die Klappe halten, hÃĪtte er sich noch darÞber beschwert, dass der Briefkasten nicht so schÃķn hÃĪngt wie mein jetziger und der Kellerraum vermutlich weiter weg ist.
F. diskutierte mit mir alles brav aus und hatte hervorragende GegenvorschlÃĪge, der gute Mann. âDa waren zwei WandschrÃĪnke und der eine ist auf jeden Fall tief genug fÞr Staubsauger und WÃĪschestÃĪnderâ und âAber auf dem Balkon kannst du endlich KrÃĪuter zÞchten!â und âDann mach doch das Balkonzimmer zum Arbeitszimmer und das Zimmer nach vorne raus zur Bibliothek, dann hast du wieder die schÃķne BÞcherwandâ und âScheià auf das Bad, echt jetzt mal, da ist man nicht lange genug drin, um sich Þber Dekofliesen aufzuregenâ. Ich sollte erwÃĪhnen, dass ich in Hamburg einem Tischler 1400 Euro in die Hand gedrÞckt habe, damit er mir eine Badeinrichtung maÃschneidert, weil ich die Ikea-SchrÃĪnke nicht mehr sehen konnte.
Und so war der Bauch noch nicht Þberzeugt, und F. meinte schlieÃlich, ich mÃķge doch bitte die Hamburger Damen anrufen, vielleicht hÃĪtten die noch was Schlaues zu sagen. Das tat ich dann auch, und eine von beiden meinte, dass ich vielleicht deshalb mit dem Umzug hadere, weil ich gar nicht auf ihn vorbereitet war. Eigentlich hatte ich mich in meiner kleinen Quengelwohnung eingerichtet, weil es eben nicht anders geht. Und zudem lief seit Jahren endlich mal alles ruhig vor sich hin. Studium ist durch, Diss holpert zwar, lÃĪuft aber auch, Beziehung passt, Werbung passt, die wilden fÞnf Jahre sind rum. Endlich wieder langer ruhiger Fluss. Und dann kommt da auf einmal so ein Umzug!
Dann meinte sie noch etwas, bei dem mir erst in diesem Moment klar wurde, dass sie damit recht hatte: âDu trauerst immer noch den 120 qm in Hamburg hinterher, aber die wirst du in MÞnchen nicht wiederfinden (und nicht bezahlen kÃķnnen). Und du kannst noch 50 andere Wohnungen angucken wie Kerle bei Tinder und immer wieder wegswipen, weil keine so ist wie die in Hamburg, aber die ist halt durch. HÃķr auf die neue Wohnung: âIch bin nicht perfekt â aber ich bin da. Und du kannst entspannt in mich reinziehen und mich total hÞbsch machen.ââ
Das klang sehr schlau. Am nÃĪchsten Morgen rief ich wieder beim Verwalter an und erwartete, dass jetzt die Þbliche Leier kÃĪme von wegen âWir haben noch andere Interessenten, wir gucken malâ, aber stattdessen kam: âWir kennen uns ja schon gut. Dann kommen Sie doch nÃĪchste Woche rum, um den Mietvertrag zu unterschreiben.â Und das war dann das. Auf Wiedersehen, Zweitwohnsitz, Studibutze und âGeht halt nicht andersâ-Wohnung.
Passenderweise zog Kai ausgerechnet an diesem Tag auch endlich aus unserer ehemals gemeinsamen Wohnung aus. Er postete sie in leerem Zustand, ich verabschiedete mich ein weiteres Mal, und jetzt ist dieser Lebensabschnitt wirklich endgÞltig vorbei.
Seit letzter Woche fiepse ich panisch, dann freue ich mich, dann denke ich an den Kontostand â meine neue Miete ist mehr als doppelt so hoch als meine jetzige â, aber dann denke ich an ARBEITSZIMMER UND SCHLAFZIMMER UND BIBLIOTHEK UND WOHNKÃCHE SCHEISS AUF DAS BAD und freue mich endlich richtig. Gestern unterschrieb ich den Mietvertrag, worÞber ich spontan gar nicht jubeln konnte, weil ich direkt danach noch einen Kundentermin hatte (yay, Geld fÞr die neue Miete verdienen), aber abends kÃķpfte ich dann alleine ein FlÃĪschchen Le 7 und stieà auf mein GlÞck an. Das wird der kÞrzeste Umzug ever, und ich ignoriere einfach noch ein bisschen, dass ich hier mit 42 BÞcherkisten angerÞckt kam, die jetzt alle wieder gepackt werden wollen.
Als ich vor knapp sechs Jahren in diese Wohnung zog, bestellte ich drei ZwÃķlferkisten Le 7, meinen geliebten roten Blubberschaumwein. Gestern leerte ich die fÞnftletzte Flasche. Bis zum Umzug trinke ich noch drei, und mit der allerletzten taufe ich dann die neue Wohnung. Ich mag solche AbschlÞsse gern.
Andererseits hÃĪtte ich in meiner neuen KÞche endlich Platz fÞr meine Weinregale, die noch im Keller stehen. Vielleicht trage ich auch noch drei Flaschen die eine Treppe runter.
—
Fehlfarben 16: WiedererÃķffnung der Alten Pinakothek
Nach vier Jahren Bauzeit ist die Alte Pinakothek in MÞnchen wieder (fast) komplett begehbar, im Erdgeschoss wird noch gewerkelt, aber der erste Stock ist baustellenfrei und alles hÃĪngt da, wo es hingehÃķrt und nicht, wie in den letzten vier Jahren, irgendwo in der Gegend rum. Grund genug fÞr uns, das Museum neu fÞr uns zu entdecken, alte Lieblinge erneut zu begrÞÃen und vielleicht andere zu finden.
Unsere gestrige Aufnahme war daher etwas anders als sonst, wo wir Þber aktuelle Ausstellungen sprechen. Dieses Mal stellt jeder von uns drei Werke vor, die sich auch die anderen im Vorfeld angeschaut haben. Und weil in der Alten Pinakothek nur gemeinfreie Bilder hÃĪngen, kÃķnnt ihr dieses Mal sogar quasi mit uns bummeln; die jeweiligen Bilder sind unten verlinkt und ihr kÃķnnt sie euch anschauen, wÃĪhrend ihr uns zuhÃķrt.
Nebenbei gab’s auch bei 30 Grad Wein, ja, so ernst nehmen wir unsere Aufgabe, und wenn dann gleich richtig: Es gab Rotwein aus der Pfalz, Jahrgang 2014, als im Museum die Bauarbeiten begonnen hatten.

Ich habe vergessen, vor der Aufnahme ein Bild zu machen und das nach der Aufnahme nervt mich heute, daher gibt’s hier eine Ansicht des schÃķnsten Museumstreppenhauses ever, das nach den Bauarbeiten auch wieder in beiden AufgÃĪngen begehbar ist. Es stammt aus der Nachkriegszeit, wurde von Hans DÃķllgast entworfen und gilt, mit dem Rest des von einer Bombe getroffenen Hauses, heute als Musterbeispiel eines Wiederaufbaus, der alte Wunden nicht einfach Þberdeckt.
Podcast herunterladen (MP3-Direktlink, 79 MB, 100 min), abonnieren (RSS-Feed fÞr den Podcatcher eurer Wahl), via iTunes anhÃķren.
00.00:00. BegrÞÃung und Vorstellung.
00.04:45. Der erste Rotwein. Nur echt mit Klagen Þber die Temperaturen.
00.05:50. Bevor wir Þber das erste Bild sprechen, weise ich auf die Online-Sammlung der Pinakotheken hin; ich hatte mal darÞber gebloggt. Aber dann:
00.08:20. Ich beginne mit einem Diptychon von Hans Memling: links Maria im Rosenhag, recht Der hl. Georg mit Stifter. Ich erwÃĪhne meine Hausarbeit aus dem ersten Semester, die ich netterweise nicht online gestellt hatte (puh), aber ich habe meine Referatsnotizen zu einem weiteren Diptychon von Memling wiedergefunden, das ich auch erwÃĪhne. Die kann man auch noch rumzeigen, die sind nicht so peinlich wie die Hausarbeit. (WIR MUSSTEN ALLE MAL IRGENDWO ANFANGEN!) Ich erwÃĪhne auÃerdem des Ãfteren den Paumgartner-Altar von Albrecht DÞrer. (Links, Mitte, rechts.) Ich hatte allerdings keine Zeit, auf das SÃĪureattentat auf dieses Werk hinzuweisen, das daher erst seit 2010 nach 21 Jahren Restauration wieder gezeigt wird.
00.18:15. Felix spricht Þber einen der Greatest Hits des Museums, den Columba-Altar von Rogier van der Weyden. (Links, Mitte, rechts.) Ich erzÃĪhle Þbrigens Quatsch Þber die Architektur im Bild, was mir beim NachhÃķren sehr peinlich war. DafÞr erwÃĪhnt Felix ein Begleitheft zur Ausstellung âDas Alte Testament â Geschichten und Gestaltenâ, das heute noch erhÃĪltlich und sehr hilfreich ist. Das Heft sowie andere kleine EinfÞhrungsbÞcher in die christliche Ikonografie gibt’s praktischerweise im Museumsshop.
00.28:50. Albrecht DÞrer hatten wir schon erwÃĪhnt; nun spricht Florian Þber ein weiteres, sehr bekanntes Meisterwerk aus der Sammlung: sein Selbstbildnis im Pelzrock. Wir erwÃĪhnen, dass Pinsel aus EichhÃķrnchenhaar gefertigt werden und eine Kopie des Bildes â es ist aber vermutlich nicht dieses Bild.
00.36:40. Der zweite Rotwein wird getestet.
00.39:00. Zweite Runde alte Bilder: Ich schwÃĪrme von meinem Lieblingsbild in der Alten Pinakothek, bei dem ich nie begrÞnden kann, warum es mein Lieblingsbild ist, aber ihr mÞsst euch das einfach alle mal anschauen: Lorenzo Lottos Mystische VermÃĪhlung der hl. Katharina.
00.45:30. Felix macht uns auf den Tresenjesus im Italienersaal aufmerksam (danke dafÞr): Luca Signorellis Madonna mit dem Kind. Wir erwÃĪhnen den Dornauszieher aus den Kapitolinischen Museen (nicht aus den Vatikanischen, wie ich rumblubbere).
00.54:10. Florian stellt Die Flucht nach Ãgypten von Adam Elsheimer vor und belegt, dass es sich auch immer lohnt, in den Seitenkabinetten rumzulaufen und nicht nur in den groÃen SÃĪlen.
01.01:00. Der letzte Rotwein.
01.05:20. Und die letzte Runde Bilder: Ich mache euch auf Werke aufmerksam, die nicht auf AugenhÃķhe hÃĪngen, und beschreibe ein Bild, das vier Teile hat, von Melchior d’Hondecoeter. (Von links: eins, zwei, drei, vier.)
01.13:00. Florian stellt eins der Bilder im Erdgeschoss vor (bisher waren wir nur in den oberen SÃĪlen): Das Schlaraffenland von Pieter Bruegel dem Ãlteren.
01.20:00. Auch Felix bleibt unten und erzÃĪhlt etwas Þber den Johannesaltar (Links, Mitte, rechts) von Hans Burgmair dem Ãlteren. Wir erwÃĪhnen den âDÞrer-Hasenâ auf der Mitteltafel â der ist aber, wie wir nach der Aufnahme festgestellt haben, nur online in der Abbildung zu sehen und nicht im Original; dort wird er fieserweise vom Rahmen verdeckt. Armes HÃĪschen.
01.27:45. Unser Bonusbild ist eine Leihgabe aus dem Rijksmuseum: Die Briefleserin in Blau von Johannes Vermeer.
01.33:33. Wir lÃķsen die Weine auf:
Wein 1: Roter Fitz, ein Cuvee aus Cabernet Sauvignon, St. Laurent und Cabernet Franc vom Weingut Fitz-Ritter, 2014, 13%, direkt beim Winzer fÞr 10 Euro.
Wein 2: ein Schwarzriesling vom Weingut Wageck, 2014, 13%, fÞr 15 Euro bei wirwinzer.de.
Wein 3: ein Schwarzriesling vom Weingut Benderhof, 2014, 13%, fÞr 9 Euro bei wirwinzer.de.
—
Was schÃķn war, Freitag, 27. Juli 2018 â Theatermond
Vormittags saà ich im ZI, um mich gebÞhrend auf unseren neuen Podcast vorzubereiten (und weil die Bibliothek so perfekt klimatisiert ist). Wir nehmen heute auf, das heiÃt, vermutlich gibt es hier morgen schon was zu hÃķren.
Ich hatte mir schon zuhause in der hauseigenen Suchmaschine ein paar BÞcher rausgepickt und die Signaturen im Moleskine notiert, sammelte nun entspannt fÞnf, sechs WÃĪlzer ein, lieà andere einfach stehen und las drei Stunden lang zum Spaà in der Gegend rum. Hat alles nichts mit der Dissertation zu tun, was auch mal ganz schÃķn war.
—
Gegen 12 war ich fertig und hatte genug zusÃĪtzliche Infos zu den Bildern, die ich besprechen mÃķchte; ich bummelte Þber den KÃķnigsplatz zum Kunstbau des Lenbachhauses. Ich staunte darÞber, dass das Gras auf dem Platz sich schon weitestgehend von den 25.000 Menschen erholt hat, die es letzten Sonntag bei der #ausgehetzt-Demo plattgetreten hatten, und bewunderte wie immer die PropylÃĪen. Danach ging ich in den Kunstbau und schlenderte durch Dan Flavins Neonlichter, die Þbrigens umsonst zu sehen sind.
—
Ich buk das zweite Brot in dieser Woche, weil das letzte nicht so richtig aufgegangen war. Das gestrige war auch nicht ganz so hÞbsch wie die bisherigen, vermutlich weil es der Hefe gerade zu warm ist. I feel you, Hefe!
—
Abends war ich mit F. in den Kammerspielen verabredet. Wir sahen No Sex von Toshiki Okada. Im StÞck treffen sich vier junge MÃĪnner in einer Karaokebar und singen Liebeslieder, um sie danach zu sezieren und zu ÞberprÞfen, ob diese Songs Þber Liebe etwas in ihnen hervorgerufen haben. Ich wollte das StÞck gar nicht so lustig finden wie ich es dann doch fand, denn zwischen den absurden und gleichzeitig anrÞhrenden Dialogen wurden Themen wie Lieblosigkeit, Selbstentfremdung, Zukunftsangst angerissen; bei einigen SÃĪtzen musste ich an die Mistkerle der Incel-Bewegung denken. Ich haderte im Nachhinein damit, dass mal wieder nur Jungs Þber ihre SexualitÃĪt â oder was sie sich darunter vorstellen â reden dÞrfen. F. meinte im Nachhinein, dass eine Rolle der vier eigentlich mit einer Schauspielerin hÃĪtte besetzt werden sollen, die aber wegen Ãberarbeitung abgesagt hatte. Warum es dann doch vier Kerle auf der BÞhne wurden, verstehe ich dann nicht. Die damit einzige Frau im StÞck ist dann auch diejenige, die Sex und KÃķrperkontakt deutlicher verbalisiert als die Herren: Sie sagt âvÃķgelnâ, wo die Jungs von âInter-Treatmentâ sprechen. Sie scheint auch ein deutlich gesÞnderes VerhÃĪltnis zu ihren BedÞrfnissen zu haben, und das stieà mir ein bisschen auf, dass die Frau fÞr die triebhafte KÃķrperlichkeit und die MÃĪnner fÞr die geistige Auseinandersetzung stehen.
WÃĪhrend des StÞcks singen alle sechs Personen irgendwann mal Karaoke (mit deutschen Texten). Bei Benjamin Radjaipour und seiner âWie ne Jungfrauâ von Madonna merkte man recht deutlich, dass er sich anstrengend musste, eher durchschnittlich zu singen; den Mann wÞrde ich gerne mal hÃķren, wenn er zeigt, was er kann. Und bei Franz Rogowskis âEventuellâ musste ich konstant gackern, zu schÃķn war die Ãbersetzung von âMaybeâ von Janis Joplin.
—
Normalerweise kehren F. und ich nach Theater- oder anderen Veranstaltungsabenden irgendwo auf einen Wein oder ein Helles ein, aber gestern wollten wir natÞrlich die Mondfinsternis bestaunen. Auf dem Weg von den Kammerspielen durch den kÞhleren Hofgarten (BÃĪume my love!) bis zum Odeonsplatz konnten wir nirgends einen Mond entdeckten, und auch meine Timeline meckerte geschlossen, dass nichts zu sehen war. Von F.s Zauberbalkon runter konnten wir ihn aber sehen: direkt Þber dem Heizkraftwerk in der Maxvorstadt stand eine staubigrote Kugel im Himmel rum und rechts unter ihr ein sehr heller Planet, der Mars, wie ich im Vorfeld gelesen hatte. Ich winkte Spirit, Sojourner und Curiosity zu, wir kÃķpften einen Prosecco, und wo wir eigentlich nur kurz mal hatten gucken wollen, blieben wir dann Þber zwei Stunden auf dem Balkon sitzen und starrten zu unserem Trabanten hoch.
Ich fand es spannend zu sehen, dass der Erdschatten den Mond anders aussehen lieà als wenn er teilweise von der Sonne angestrahlt wird; die Sichelform war die gleiche, aber er kam mir kugeliger vor als sonst. Irgendwann fand ich es sehr unheimlich, auf den Schatten eines Planeten zu gucken, auf dem ich gerade selber sitze. Das sind die Momente in der Astronomie, wo ich mit einem TeddybÃĪr unter mein Bett klettern will, dieses Merken, wie winzig man ist und wie irrwitzig, unbeschreiblich und fÞr mich schlicht unverstÃĪndlich groà alles andere.
In meinem Kopf stieÃen dann SÃĪtze zusammen wie âWow, wie groÃartig, es ist so toll, das zu erleben, what a time to be aliveâ und âMeTwo in der Timeline, AfuckingD im Bundestag, Trump, Putin, Orban, die polnische Justiz, die Angst um Europaâ. Genau deswegen versuche ich meine Zeit auf Twitter etwas einzudÃĪmmen, um nicht stÃĪndig daran zu erinnert werden, die scheiÃe wir als Menschheit uns derzeit mal wieder auffÞhren. Aber gleichzeitig fand ich es schÃķn, mit meiner Timeline gemeinsam dieses Naturwunder zu bestaunen.
Ich finde das sehr rÞhrend, wie wir zynischen, fiesmÃķppigen Interwebpeople gerade alle in den Himmel starren. #Mondfinsternis2018
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 27. Juli 2018
—
Was schÃķn war, Mitte Juli â Sommerferien
Die ganze letzte Woche durfte mein Kopf sich schon ausruhen bis auf die kleine Referat-Insel fÞr die geschÃĪtzte Korrekturleserin. Das hat mir viel Freude gemacht, meine DissertationsplÃĪne auszubreiten, Bilder zu zeigen und Dinge gefragt zu werden.
Ansonsten lieà ich BÞcher in Bibliotheken liegen, sagte Verabredungen ab, gab Theaterkarten weiter und machte: gar nichts. AuÃer mich auszuruhen, spazierenzugehen, zu backen, zu kochen und einen kurzen Urlaub auf Lindau am Bodensee fÞr diese Woche zu buchen. Jetzt wo ich wieder in MÞnchen bin, weià ich: Ich habe einen viel zu kurzen Urlaub gebucht.

Ich kam bei leichtem Regen an, also genau bei meinem Wetter, rollkofferte ins Hotel und verlieà es sofort wieder, um ans Wasser zu rennen, Meer, See, alles egal, hauptsache Wasser. Und so saà ich auf einer nassen Bank unter meinem Schirm, guckte auf den Bodensee und atmete ein und aus und wieder ein und wieder aus und war nach zehn Minuten schon entspannter als alle letzten Wochen zusammen.


Das Wetter wurde schnell wieder besser, ich bummelte und guckte und hatte nichts zu tun auÃer zu bummeln und zu gucken. Und weil die Lindauer Insel so winzig ist, war ich dauernd wieder am Wasser. Das ist da aber auch echt Þberall. Ich trank einen Latte Macchiato und eine Johannisbeerschorle, ich Stadtkind, und guckte dabei aufs Wasser. Ich kaufte Wasser und Schokolade im Supermarkt, ging fÞnf Minuten und guckte aufs Wasser. Ich durchquerte quasi die ganze Insel und guckte danach aufs Wasser. Abends setzte ich mich in das hauseigene Restaurant, verspeiste Schweinemedaillons mit SpÃĪtzle (aka âSchwabentellerâ), trank ein Helles, ging dann nochmal raus und guckte aufs Wasser. Wenn ich gekonnt hÃĪtte, hÃĪtte ich den Bodensee mit ins Bett genommen, um auf ihn raufzugucken.

Am nÃĪchsten Morgen erfreute mich das Hotelbuffet mit eintausend MÞsli- und Cerealsorten und dazu frischen Erdbeeren. AuÃerdem wurde das RÞhrei frisch fÞr mich gemacht und der Kaffee kam im SilberkÃĪnnchen.
Dann begann ich mein Tagwerk: Rumlaufen und aufs Wasser gucken. ZunÃĪchst kamen natÞrlich die beiden Kirchlein dran, die so niedlich im 20-Meter-Abstand parallel nebeneinander stehen. Raten Sie, welche meine evangelische ist. Mpf.


Vor dieser Kirche stand der Hinweis auf die sogenannte Mittagsinsel, eine winzige Andacht mit Gebet und Orgelmusik um 12 Uhr. Das merkte ich mir, musste aber erstmal weiter rumlaufen und aufs Wasser gucken. Dazu wagte ich mich sogar von der Insel runter aufs Festland und fand einen wunderbaren Platz zum Lesen. Und um aufs Wasser zu gucken. Tach, Ente!

AuÃerdem merkte ich, dass ich unwissentlich einen winzigen Abschnitt des Jakobswegs gegangen war. Wo bekomme ich ein Pilgerbuch, in dem ich das vermerken lassen kann?

Um 12 saà ich wieder in der Kirche und wurde andÃĪchtig. DermaÃen gestÃĪrkt wagte ich mich in die August-Macke-Ausstellung, die gegenÞber der Kirchen im wunderschÃķnen Stadtmuseum lief. Macke ist mir wie die meisten Expressionisten inzwischen ein bisschen egal, ich gucke sie pflichtschuldig, und so blieb ich auch hier nur eine gute halbe Stunde vor den 40 Bildern â ich musste ja auch wieder aufs Wasser gucken â, aber ein paar waren doch dabei, die mir sehr gefielen. Mein liebstes finde ich allen Ernstes weder bei den schÃķnen Unidatenbanken noch bei Google; wenn euch âGelbe Frau mit Kindâ von 1913 Þber den Weg lÃĪuft oder vor euch vom Laster fÃĪllt, schickt mir das Bild doch bitte mal. Ich mochte schon den Titel, und die wenigen, geometrischen bunten FlÃĪchen schienen mir klarer, sinnstiftender als das Þbliche bunte Gewusel. Generell mochte ich in der Ausstellung die Ecke mit den flanierenden Stadtmenschen am liebsten. Vielleicht auch, weil auf der kleinen Insel davon so wenig zu spÞren war. Klar, es war alles voller Tourist*innen, aber weil die Altstadt komplett denkmalgeschÞtzt ist, gibt es gefÞhlt nur fÞnf ParkplÃĪtze und fast nur einspurige StraÃen. Das sieht man auf meinen HÃĪuserbildern ganz gut; ab und zu fÃĪhrt ein Auto an einem vorbei, aber man muss mehr auf Pedelecs achten und auf Þberall rumstehende PostkartenstÃĪnder. Auch das war fÞr mich als GroÃstadtmensch ÃĪuÃerst entspannend.

Und dann war ich abends ein bisschen essen. Nur sieben GÃĪnge mit Kleinkram vorneweg und hintendran und Weinbegleitung und einem RosÃĐ-Champagner als Auftakt, denn wenn es RosÃĐ-Champagner gibt, dann trinke ich den auch.

Als Reinkommer gab’s eine Forelle mit BÃĪrlauch und, ich glaube, BÃĪrlauchknospen. DarÞber winzige Gurkenscheibchen, alles spannend sÞÃsauer. Ich fing an, wohlig zu seufzen und hÃķrte den ganzen Abend nicht mehr auf.

Als die Þberaus freundliche Bedienung mir diesen Teller hinstellte, entfleuchte mir ein âOh wowâ, weil OH SO PRETTY! GÃĪnseleber mit RÃĪucheraal darÞber und Rhabarber. Und der Riesling im Glas war das goldigste Gold, das ich je hatte. Schmeckte zunÃĪchst nach bitterem Honig und Kieselsteinen, aber mit der GÃĪnseleber zusammen â natÞrlich â perfekt. Dazu gab’s eine Brioche, die ich kaum anfassen konnte, so hauchzart fluffte sie unter meinen Fingerchen dahin. Aber in der Not schmeckt GÃĪnseleber ja auch ohne Brot.

Zum Hummer mit Gurken-Mandel-Kaltschale gab es einen spanischen WeiÃen, ich habe mir keine Weine notiert und wollte das auch nicht, aber hier musste ich schnell in mein iPhone die Notiz tippen: âSHERRYKAUGUMMI!â Ich weià nicht, ob diese wunderschÃķnen gelben BlÞten zwischen den gerÃķsteten Zwiebeln Fenchel sind. Vielleicht stammen sie sogar aus dem hauseigenen Garten; wÃĪhrend ich auf die GÃĪnge wartete und nicht im iPad lesen wollte, guckte ich in der Gegend herum und sah manchmal einen Koch im Garten winziges GrÞnzeug abschneiden.

Der Keta-Lachs kam mit Kalamansi und Ponzu-Sauce, die schon gefÞhlt einen halben Meter vom Tisch entfernt in meine Richtung duftete. Ich roch diesen Duft noch Ãķfter am Abend, wenn Teller an mir vorbeigetragen wurden. Dazu gab’s eine meiner liebsten Rebsorten, Sauvignon blanc, der erwartungsgemÃĪà frisch und sÃĪuerlich war, aber vor dem Lachs einen Kotau machte und nur noch rumschmeichelte. Ich seufzte weiterhin wohlig vor mich hin.

Mein liebster Gang des Abends: Steinbutt mit Zwiebeln und gerÃķstetem GemÞsejus. Wieder einmal hielt ich gefÞhlt minutenlang die Nase dicht Þber den Teller, bevor ich anfing zu essen. Meist wollte ich gar nicht, weil alle Teller so wunderschÃķn aussahen! Aber: Sie rochen halt alle gut, und das war ihr Verderben. Dazu gab’s einen Chardonnay, der wie einer meiner Hassrotweine roch, bei denen ich immer an schwefeligen Pferdemist denken muss. Ich notierte mir leicht angeheitert âPFIRSICHPFERD!â und lieà es mir schmecken.

LammrÞcken mit Erbsen und Salzzitronen, dazu den einzigen Rotwein des Abends. Ein Bordeaux, der schmeckte, als ob man auf Kirschkernen rumkaute, die in einem schweren Aschenbecher gelegen haben. Also: Rauch, Tannine, Holz, wenig Frucht. Aber dann kamen das Lamm reingehÞpft und die Sauce und die Erbsen und zack, war da die Kirsche. Ich kapiere bis heute nicht, dass ein Rotwein mit Salzzitronen klarkommt, aber kam er natÞrlich. Ich wollte mehr.
âWar das Lamm so recht?â
âIch kann mich nicht von ihm trennen!â
âWir machen Ihnen das gerne nochmal!â
*wimmer*
*Service schenkt einfach nochmal Rotwein nach*
*wohligseufz*
Ich ging zwischendurch aufs Klo und stellte danach fest: Das Tantris ist nicht das einzige Lokal, das die Serviette neu faltet, wenn man mal vom Tisch weg ist. Mir wurde natÞrlich auch der Stuhl zurechtgerÞckt, der Þbrigens eine halbe Sitzbank war. Ich habe selten so bequem und auch so angenehm gesessen. Ich saà zwischen Loggia und Innenraum und hatte immer einen leichten Luftzug, um mich herum auf allen Tischen standen kleine Blumengebinde und Kerzen, alles unterschiedlich, aber alles passte. Als ich um 19 Uhr kam, war ich erst der vierte Tisch, der besetzt wurde, aber als ich nach 22 Uhr ging, war der Laden voll. Trotzdem war alles ruhig, und obwohl ich auf kein einziges Wasser gucken konnte auÃer auf das in meinem Glas, war ich so entspannt wie schon den ganzen Tag Þber. Alleine essen gehen. Kann man machen. Auch stundenlang. Davor war ich ein bisschen nervÃķs gewesen, auch weil ich F. gerne als GesprÃĪchspartner fÞr Weinnotizen dabei habe. Aber ich merkte immer mehr, wie angenehm das war, nicht alles zu zerreden. Ich konnte mich ganz aufs Essen und die Weine konzentrieren. Irgendwann habe ich zwischen den GÃĪngen auch nicht mehr zur LektÞre gegriffen, sondern saà einfach nur noch da und guckte vor mich hin und das fÞhlte sich vÃķllig in Ordnung an.
Aber wir waren ja noch nicht fertig. Statt des Þblichen kalten Sorbets zum MagenaufrÃĪumen vor den SÞÃspeisen wurde mir ein heiÃer Tee gereicht. Ich habe mir nicht gemerkt, was das fÞr ein Tee war, aber er war herrlich. Und, kaum zu glauben, ich war wirklich wieder wach.

Deswegen konnte ich auch die Waldheidelbeeren wÞrdigen, die sich unter den Shards, wie ich dauernd bei Masterchef Australia hÃķrte, verbargen. Irgendwo war auch noch, laut Speisekarte, Verbene verbaut â vielleicht war das sogar der Tee. Wie ich lustigerweise gerade vor ein paar Tagen bei Masterchef gelernt hatte, soll das erste Dessert frisch und leicht sein, bevor das letzte Dessert dann seinen groÃen sÞÃen Auftritt hat. Das hat hier hervorragend geklappt. Eigentlich ist mir Blumenfirlefanz am Teller eher lÃĪstig, genau wie Steine, auf denen irgendwas liegt â ich mÃķchte nur Zeug auf dem Teller haben, das ich auch essen kann. Aber hier kam man nicht darum herum, mit dem Handgelenk die kÞhlen, glatten BlÞten zu berÞhren, wenn man die Beeren lÃķffelte, und das war ein sehr sinnliches Erlebnis.

Und da ist der groÃe sÞÃe Auftritt. Kirschsorbet, meine ich mich zu erinnern, Tonkabohnencreme, Schokolade, die kleinen rosa Nupsis waren baiserÃĪhnlich, der Turm irritierte mich zunÃĪchst als Dekoidee aus den 90ern, aber es war ÃĪuÃerst befriedigend, sich sein dekonstruiertes Dessert nicht vom Teller zusammensammeln zu mÞssen, sondern einfach mit dem LÃķffel durch siebzehn Schichten zu schlemmen. Der Kracher war allerdings die GetrÃĪnkebegleitung: Statt des Þblichen SÞÃweins gab’s einen Shot KirschlikÃķr â âvom [Hersteller Irgendwas Irgendwer] gleich hier die StraÃe raufâ â auf Eis. So mÃķchte ich meine LikÃķre ab jetzt nur noch trinken.
Dann gab’s noch Mangojogurt oder so als Rauswerfer, konfektÃĪhnlichen Kleinkram, einen Espresso, meinen Þblichen Nussgeist â das ist quasi die Klammer zum RosÃĐ-Champagner, das muss beides immer sein â und dann war ich so glÞcklich wie selten. Das Villino hat einen Stern und ich wÞrde ihm gerne noch 50 dazugeben. Ich habe mich ÃĪuÃerst wohlgefÞhlt, nie irgendwie komisch, so alleine und wie immer bei 28 Grad leicht transpirierend, das Essen war genauso entspannend wie mein ganzer Urlaub und trotzdem hatte jeder Gang eine kleine Ãberraschung, die mich innerlich freudig aufhorchen lieÃ, und jeder Wein konnte mich faszinieren. Das war endlich mal eine Kombi, die ich bisher auch nur aus dem Tantris kannte: nicht nur groÃartiges Essen oder herausfordernde Weine, sondern beides. Ich habe wirklich bei jedem Gang wohlig geseufzt und mich vermutlich total zum Klops gemacht. Das war’s wert. Ganz groÃe Empfehlung.

(Ja, das ist eine Peniswolke. Ja, das ist die offizielle wissenschaftliche Bezeichnung.)
Bis 9 Uhr geschlafen, mich wieder Þber die Erdbeeren auf dem Buffet und das frische RÞhrei gefreut. Ganz anderes Kochlevel, aber ÃĪhnliches GlÞckslevel. Gutes Futter halt. F. per DM: âDass du Þberhaupt schon wieder was essen kannst!â Ich zurÞck: âIch habe jahrzehntelang trainiert!â
Den Vormittag verbrachte ich mit einem Buch auf meiner am Vortag entdeckten Lieblingsbank bei den Enten im Toskanapark, dann schlenderte ich zu einem der Anbieter fÞr Bootsrundfahrten und lieà mich Þber den See schippern. Auf Twitter lernte ich, dass man auf dem Bodensee gleichzeitig in Deutschland, Ãsterreich und der Schweiz ist; die Grenzen hÃķren an Land auf. Europa, du tolles Ding!



Nach einer guten Stunde und einem Eiskaffee an Bord ging es wieder nach Deutschland zurÞck. Ich bummelte zum achtzigsten Mal durch die historische Altstadt und konnte mich immer noch Þber jedes bunte Haus freuen, suchte per Smartphone nach einem Laden, der Briefmarken hat, fand ihn, kaufte eine Postkarte fÞr Mama und Papa und ging ins Hotel zurÞck. NatÞrlich mit Umweg Þber den Uferweg. Wasser gucken. Nie langweilig.

Abends saà ich dann wieder bei den Evangelen. Die Kirche hat im vorderen Teil ziemlich lustige BÃĪnke, bei denen man die RÞckenlehnen so nach vorne klappen kann, dass man nicht in Richtung Chor, sondern in Richtung Orgel guckt. Sehr praktisch, denn ich war zu einem Orgelkonzert da. Die, ÃĪhem, Lichtorgel (ba-dum tss) belustigte mich im stillen Zustand, aber als sich die Lichtfarben verÃĪnderten, als auf ihr gespielt wurde, irritierte mich das doch sehr. Ich verstehe zu wenig vom Orgelaufbau, um sagen zu kÃķnnen, ob eine Lichtfarbe einem Register zugeordnet war, und ich konnte auch nicht ausmachen, ob es an irgendwelchen Akkorden lag â irgendwann schaute ich eh nur noch zu Boden, weil es mir dort oben zu bunt war. Obwohl zwischenzeitig mal ein Tableau aus verschiedenen Blau- oder VioletttÃķnen sehr hÞbsch aussah.
Das Programm selbst war fÞr meinen Geschmack etwas eigenwillig, aber auch hier: Ich habe keine Ahnung von Orgelliteratur. Mehr als Bach und Kirchenlieder kenne ich nicht. Das erste StÞck von Walter GlÞck fand ich fad, das zweite von Oskar Lindberg hingegen sehr reizvoll. Dann kam der vermutlich langweiligste HÃĪndel der Welt, ich wusste gar nicht, dass HÃĪndel langweilig sein kann, und ich merkte, wie ich immer Ãķfter ans Essen dachte. Als der Satie dann auch sehr melancholisch dahinschlich (und ich im Geiste die Minuten bis zum KÞchenschluss meines Hotels runterzÃĪhlte), ging ich dann doch leise aus der Kirche, warf aber einen Schein in das SammelkÃķrbchen zur Orgelrestaurierung, wie sich’s gehÃķrt, und sprintete in den Biergarten. Dort bestellte ich ein Helles und einen Backhendlsalat, und gerade als ich das Bier ansetzte, erklang aus dem Nachbarhaus ein vielstimmiger Chor. Auch der Rest vom Biergarten horchte auf, aber leider nicht lange genug, um mich wirklich erkennen zu lassen, was die (hÃķrbar mehr) Damen und Herren genau sangen. Ein Lied erkannte ich, aber das war’s dann auch. Jedenfalls saà ich nun wieder genau in dem Zustand da, der mich auf Lindau seit Tagen begleitete, vom ersten Durchatmen an: ÃĪuÃerst entspannt, sehr zufrieden, glÞcklich, ruhig, gelassen. Und mit Chorbegleitung.
Ich habe wirklich erst hier auf der Insel gemerkt, wie angespannt ich vorher war und wie dringend es nÃķtig war, aufs Wasser zu gucken. Auch das Alleinsein tat sehr gut, und dass ich mich wirklich um nichts kÞmmern musste, ich musste nur spazierengehen und essen und gucken, und ich hÃĪtte auch einfach im Zimmer rumliegen kÃķnnen und es wÃĪre in Ordnung gewesen, niemand will was von mir, ich will von niemandem was, ich mache einfach mal nichts und denke auch ungefÃĪhr so viel. Es warteten keine 50 Museen vor der TÞr, die mir ein schlechtes Gewissen machen, es wartete nur der See und der ist hoffentlich noch lange da, denn ich mÃķchte jetzt schon wieder zu ihm zurÞck.
Das war der erste Urlaub, der von mir aus noch lÃĪnger hÃĪtte gehen kÃķnnen. Ich mag mein Zuhause, wo auch immer es ist, ich bin da gerne und ich komme immer gerne dahin zurÞck, aber ja, der See hat schon sehr gut getan. Wieder was gelernt, ohne dass ich es mal darauf angelegt habe.

—
Was schÃķn war, Sonntag, 1. Juli 2018 â In der Puppenkiste
Als ich das erste Mal zum FuÃball mit nach Augsburg kam, spielte F. den FremdenfÞhrer und wies mal hierhin, mal dorthin, was es da alles gab im FuggerstÃĪdtchen, ich nickte und hatte keine Ahnung, und dann kam irgendwann der Satz: âUnd da hinten geht’s zur Puppenkiste.â Und ich so: âWie, die Puppenkiste? Die gibt’s wirklich?â
FÞr mich war die Augsburger Puppenkiste ein Fernsehstudio in KÃķln, in dem Jim Knopf und Lukas wohnten und dann Þbers Plastikplanenmeer nach Lummerland fuhren. Aber nein, es gibt wirklich ein Theater in Augsburg, das 1948 erÃķffnet wurde und wo zum Beispiel der RÃĪuber Hotzenplotz seit 1966 die KaffeemÞhle der GroÃmutter klaut. Und genau das schauten F. und ich uns gestern an.

Wenn ich alleine dagewesen wÃĪre, wÃĪre ich vermutlich am Theater vorbeigelaufen, denn es befindet sich in einem ehemaligen SpitalgebÃĪude â Þbrigens von Elias Holl, den ich aus dem Studium kannte; den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus hatte ich mal in einer Vorlesung gesehen. Eine unscheinbare TÞr fÞhrt in einen kleinen Vorraum, in dem es eine Garderobe gibt, ein CafÃĐ, das aus geschÃĪtzt zehn Tischen besteht und einer kleinen Merchandisinginsel, wo man neben Shirts, BÞchern und Postkarten auch die bekanntesten Marionetten kaufen kann. Von der Puppenkisten-Website habe ich gelernt: Jim und Lukas wohnen wirklich nur im Fernsehen, dieses StÞck ist als BÞhnenproduktion viel zu aufwendig.
Nebenbei bin ich jetzt schon gespannt darauf, welche Marionette in der nÃĪchsten Bundesliga-Saison anstatt eines Wimpels an den KapitÃĪn der Gastmannschaft Þbergeben wird, die gerade beim FC Augsburg spielt; in der abgelaufenen Saison war es ausgerechnet der Hotzenplotz â natÞrlich stilecht mit einem grÞnweiÃroten Fanschal um den hÃķlzernen Hals.
F. kannte das Theater schon, ich wie gesagt nicht, und ich war unerwartet aufgeregt, als wir in den GewÃķlbesaal traten und in der dritten Reihe Platz nahmen. F. hatte die Karten schon im letzten September gekauft; die Dinger sind so schnell weg wie Karten fÞr die Bayreuther Festspiele, aber deutlich gÞnstiger. Er hatte auch brav darauf geachtet, mÃķglichst weit vorne zu sitzen, denn, wer hÃĪtte es gedacht, die Kiste ist quasi wirklich eine Kiste. Die BÞhne ist winzig, und ich habe keine Ahnung, ob man in der letzten, der 20. Reihe, Þberhaupt noch was sehen kann. Ich war schon gerÞhrt, bevor es Þberhaupt losging, denn die FlÞgel der Kiste kannte ich natÞrlich aus dem Fernsehen und war gespannt, ob sie sich wirklich seitlich Ãķffneten oder einfach nach oben weggezogen wurden.
Sie Ãķffneten sich seitlich, wie es sich gehÃķrt und ich verdrÞckte ein kleines TrÃĪnchen, ich Marionettenmemme.

Im ersten Bild singen der Kasperl und der Sepperl der GroÃmutter ein GeburtstagsstÃĪndchen. Den Kasperl kenne ich auch aus dem Stadion; er sagt immer das Spielergebnis voraus, meist allerdings falsch. Deswegen war ich sehr Þber die Theaterstimme des Kasperl irritiert, denn sie war anders. Das lag daran, dass wir gestern ernsthaft noch die Sprechstimmenaufnahmen von 1966 hÃķrten â so wurde der Zauberer Petrosilius Zwackelmann (Petersilius Wackelzahn) vom PuppenkistengrÞnder Walter Oehmichen eingesprochen, der seit 1977 tot ist. Aber warum auch Dinge ÃĪndern, die anscheinend seit 50 Jahren funktionieren? Ich hatte erwartet, dass die ganzen Kinderscharen um uns herum, die mit iPads und Laptops groà werden, nicht mehr von Holzpuppen an deutlich sichtbaren SchnÞren fasziniert werden kÃķnnen, aber damit lag ich tollerweise total falsch. Sobald sich der rote Vorhang hinter den KistenflÞgeln Ãķffnete, war Ruhe im Saal (bis auf die stets blubbernden Kleinstkinder, aber das muss so) und die Kinder lachten Þber die gut platzierten Witze genau wie ich, erfreuten sich genau wie ich daran, dass Zwackelmann von einem Besen verkloppt wird oder dass ein Schnupftabaksack plÃķtzlich Beine hat und staunten genau wie ich lautstark Þber ein besonders dramatisch ausgeleuchtetes BÞhnenbild (der Unkenpfuhl! Huuuuh! Ich will die Unke als Marionette!).
Zwischen den einzelnen Bildern ging der Vorhang immer kurz zu â und sofort begannen die GesprÃĪche um uns herum. âMama, wieso hat der Kasperl …â âWillst du dem Papa erzÃĪhlen, was der RÃĪuber gemacht hat?â und ÃĪhnlich. Ich ahne, dass die Umbaupausen auch dazu da sind, damit man kleinen Kindern notfalls noch schnell erklÃĪren kann, was da gerade passiert ist. Das schien zu funktionieren, die GesprÃĪche brachen immer sofort ab, sobald der Vorhang sich wieder Ãķffnete. Das Publikum war Þbrigens geschÃĪtzt nur zur HÃĪlfte im Kindesalter, wenn Þberhaupt. In der ersten Reihe saà zum Beispiel ein kleiner Junge, dem sich gleich vier gut gelaunte Erwachsene als Begleitperson angedient hatten.

(Deko auf dem Merchandisingstand.)
Was mich Þberraschte: Die Marionetten waren deutlich kleiner als ich dachte. Aber klar, wenn man als Puppenspieler*in eine 80-Zentimeter-Puppe bewegen muss, ist das vermutlich irre anstrengend und vor allem schwer zu koordinieren. Was ich auch lustig fand und mich an meine erste BallettauffÞhrung denken lieÃ: dass man das hÃķlzerne Geklapper der FÞÃe auf dem BÞhnenboden hÃķrt. Daran musste ich mich erst gewÃķhnen, wie auch an das fÞr meine Ohren immer noch anstrengende Augsburger SchwÃĪbisch. Mit Bairisch komme ich inzwischen halbwegs klar, aber in Augsburg wird eher geschwÃĪbelt. Und dann auch noch, wie F. es nannte, eher maulfaul. Vieles wird verwischt oder verschluckt, weswegen ich mich in der Pause beschwerte, dass das total fies gegenÞber uns armen Norddeutschen ist. F. nur so: âDann baut’s eich halt selba a Puppakischt.â Werde den Mann jetzt ins Ohnsorg-Theater schleppen mÞssen. Oder in irgendwas Plattdeutsches. Im Programmheft steht Þbrigens eine Ãbersetzung fÞr viele AusdrÞcke, aber davon hat man leider wÃĪhrend der Vorstellung nichts. Gerade den Sepperl, der auch noch betont doof sprach, habe ich kaum verstanden. AuÃer bei einem seiner Lieder, aber der Reim war auch idioten- bzw. norddeutschensicher, der ging ungefÃĪhr so: âIch bin das arme Sepperle, ich bin ein kleines Depperle.â Aus dem Programmheft Þbernehmen werde ich aber ab sofort den Ausdruck âSimpelfranznâ fÞr âStirnhaare mit waagrechter Schnittlinie.â
Die Vorstellung dauerte knapp anderthalb Stunden, wobei es nach knapp einer Stunde eine Pause gab. Danach wurde der Zauberer verprÞgelt, aus der wirklich tollen Unke wurde eine total langweilige Fee, der Zauberer fiel in die HÃķlle, der Hotzenplotz wurde aus einem Gimpel wieder zu einem Mensch verwandelt und zum Schluss kriegten alle, auch der Wachtmeister Dimpflmoser, von der GroÃmutter einen anstÃĪndigen Zwetschgendatschi. Der Vorhang fiel und die Klappe schloss sich blitzschnell. Keine Verbeugung der Marionetten oder sogar der Spieler*innen. Letzteres findet wohl bei den Vorstellungen fÞr Erwachsene statt, aber bei den StÞcken fÞr Kinder ist das Ende sehr kurz und schmerzlos. Ich fand das ein bisschen schade, aber andererseits: Wenn man als Kind noch nicht die Theatererfahrung gemacht hat, dass sich am Ende alle verbeugen, dann muss das ja auch nicht sein.
Leider war die Kasperleampel in der NÃĪhe des Theaters gestern nicht eingeschaltet, die hÃĪtte ich auch gerne noch gesehen. So trÃķsteten wir uns mit Guinness und Kilkenny und eher mÃĪÃigen Pommes in einem Biergarten um die Ecke, sahen das ElfmeterschieÃen von Spanien und Russland und fuhren gemÞtlich (g’miatlich) mit dem Regionalzug wieder nach MÞnchen.
Das war sehr ungewohnt, mal ohne Stadionklamotten nach Augsburg zu fahren, aber wirklich schÃķn. Die Puppenkiste. Es gibt sie wirklich.
—
Was schÃķn war, Donnerstag, 21. Juni 2018 â Knipsen, lesen, quatschen
Gestern hatte ich mir mal wieder den Nachlass der Protzens im Kunstarchiv NÞrnberg zurÞcklegen lassen. Durchgesehen hatte ich die Boxen und Mappen ja schon mehrfach (okay, zweimal), und fÞr meine erste Zwischenbilanz sowie das Doktorandenkolloquium, das vermutlich im September oder Oktober stattfinden wird, brauchte ich jetzt mal einen Schwung Bilder. AuÃerdem ist es, wer hÃĪtte es gedacht, viel leichter, Þber einen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk nachzudenken, wenn man das Gesamtwerk kennt, es also vor der Nase hat anstatt dafÞr nach NÞrnberg fahren zu mÞssen.
Beim letzten Archivbesuch hatte ich den noch unerschlossenen Nachlass ein bisschen fÞr mich erschlossen. Ich hatte mir notiert, in welchen Boxen was liegt und was genau mich davon interessiert. Ich wusste also zum Beispiel, dass in der von mir nummerierten Box 2 drei Fotoalben lagen, in denen Protzens ÃlgemÃĪlde Nr. 306 bis 685 abgebildet waren. Die wollte ich komplett ablichten, um alle seine Werke digital vorliegen zu haben. In Box 3 liegen Werbegrafiken von ihm, die ich im Hinblick auf seine spÃĪteren Autobahnbilder ÃĪuÃerst aufschlussreich finde, in einer Mappe liegen Urlaubsfotos, deren Motive sich spÃĪter in Ãl wiederfinden usw.
Ich fragte im Archiv nach, ob sie einen Overheadscanner hÃĪtten, den ich benutzen dÞrfte. Haben sie garantiert, denn man kann sich ja Scans bestellen, aber fÞr den Publikumsverkehr ist der anscheinend nicht freigegeben; ich dÞrfte aber mit meiner eigenen Kamera lustig fotografieren. Das klingt zwar erstmal fies, ist aber im Vergleich zu anderen Archiven, wo man meist nicht mal mit dem Handy Bilder machen darf, schon ganz okay. (Vielleicht kann mir in diesem Zusammenhang mal jemand erklÃĪren, warum ich teilweise Archivgut mit bloÃen HÃĪnden anfassen, aber kein iPhone drÞberhalten darf.)
Ich besitze seit einiger Zeit wieder eine hÞbsche Kamera, die ich allerdings viel zu wenig benutze. Ich habe blÃķderweise erst nach dem Kauf festgestellt, dass mich das Fotografieren mit Display nervt, ich hÃĪtte gerne wieder einen Sucher. Gestern merkte ich aber, dass fÞr die schnarchlangweilige Dokumentenfotografie ein Display ziemlich schnafte ist.

Aber so weit war ich noch gar nicht. Vorgestern fragte ich, ob jemand ein Reprostativ hÃĪtte, mit dem ich arbeiten kÃķnne. Unser Medienraum in der Uni hat sowas, aber leider nicht in transportabler GrÃķÃe. Ich bekam aber auch den Tipp, es bei FotogeschÃĪften zu versuchen, die hÃĪtten manchmal einen Leihservice. Das wusste ich noch nicht! Ich rief bei Foto Sauter an, die mir bedauernd sagten, ein Reprostativ hÃĪtten sie nicht, aber man kÃķnnte ein Dreiwegestativ nehmen und die Mittelstange umdrehen, dann mÞsste man die Kamera ja so anbringen kÃķnnen, dass sie nach unten zeigt â wenn ich mal kurz dranbleiben kÃķnne, der freundliche Herr am Telefon versuche das mal eben … ja, das geht. Vorbeikommen und abholen, bitte. Das erledigte ich dann noch am Mittwochabend, zahlte 19 Euro GebÞhr fÞr einen Tag Leihzeit, baute das Ding probehalber auf dem eigenen Schreibtisch auf, fotografierte ein bisschen damit und stellte fest, das ging wirklich gut.
Gestern setzte ich mich dann wie immer in den ICE, allerdings nicht den frÞhen, mit dem ich zur Ãffnungszeit des Archivs um 9 vor Ort bin, sondern den etwas spÃĪteren. AuÃerdem gÃķnnte ich mir bei den gestrigen 28 Grad eine Station U-Bahn-Fahrt vom Hauptbahnhof zum Opernhaus, anstatt den Weg wie sonst zu Fuà zu gehen (ich mag die fÞhrerlose U-Bahn so gerne). Ich transpirierte leider trotzdem etwas, als ich im Archiv ankam, war allerdings auch schwer bepackt. Rucksack mit Rechner, Netzteil, Notizbuch, Zug- und WartezeitenÞberbrÞckbuch, WasserflÃĪschchen und externem Trackpad (das im MacBook zickt neuerdings etwas) sowie die Tasche mit Stativ und Kamera waren doch schwerer als ich dachte. Egal. Angemeldet (ich wurde schon erkannt), Sachen ins SchlieÃfach geworfen, an meinen Tisch gegangen und mein Pseudo-Reprostativ aufgebaut.

Hinter dem Stuhl auf dem WÃĪgelchen liegt der komplette Nachlass, mehr ist das leider nicht. Aber immerhin. Weil ich mir bei den Urheberrechten nicht so sicher bin, habe ich die Bilder, die ich abfotografiere, Þbrigens fÞr die Blogbilder absichtlich teilweise verdeckt. Nur dass ihr nicht denkt, ich wÃĪre zu doof, meine Handschuhe vernÞnftig abzulegen. Die GummibÃĪnder um die Kamera sind nur fÞr meine neurotische Angst, das Schraubgewinde kÃķnnte doch nicht halten. Vermutlich unbegrÞndet, aber man weià ja nie.
Und dann fotografierte ich. Und fotografierte. Und fotografierte some more. Meine GÞte, ist das langweilig, vier Stunden lang nichts anderes zu tun als Dinge hinzulegen, durch ein Display zu gucken, scharfzustellen und abzudrÞcken. Ich hatte auch nicht das GefÞhl, noch wirklich was zu sehen, ich zog einfach nur Zeug aus Boxen, legte es hin, knipste und machte alles nochmal. Das ist echt nicht mein Job. Leider war die Lichtsituation auch nicht die allerbeste, um Fotos zu fotografieren. Papiere und Dokumente gingen einwandfrei, aber bei den blÃķden glÃĪnzenden Bildern habe ich doch manchmal einen Lichtreflex drauf, trotz MacBook zum Abschirmen und meinem wild in die Gegend gehaltenen Notizbuch. Die meisten Seiten der Fotoalben habe ich mehrfach fotografieren mÞssen, um halbwegs blendfreie Bilder zu kriegen, denn irgendeinen Punkt gab’s halt doch, wo nichts reflektierte. Trotzdem ahne ich, dass ich irgendwann schlampig geworden bin wie das leider meine Art ist bei monotoner Quatscharbeit. Heute werde ich alle Bilder durch den Photoshop jagen und dann gucken wir mal. (Yay, 900 Bilder im Photoshop angucken! Ãchz.)

Um 15 Uhr beschloss ich, keine Lust mehr zu haben und auÃerdem zickte mein RÞcken vom vielen komisch Rumstehen und gebÞckt Þber Dingen hÃĪngen. Ich hatte alles abgelichtet, was ich mir vorgenommen hatte, und dann noch ein bisschen. FÞr alles weitere muss ich notfalls nochmal vorbeischauen.
FÞr den Abend hatte ich mich mit jemandem verabredet, den ich seit hundert Jahren lese, und den ich vor ungefÃĪhr zehn Jahren mal in Hamburg auf einer kleinen Feier getroffen hatte. Der gute Mann hatte nicht ganz so frÞh Feierabend wie ich, also ÞberbrÞckte ich die Zeit mit einem sehr guten Flat White und einer groÃen Apfelschorle bei MarchhÃķrndl, nachdem ich mir brav St. Lorenz angeguckt hatte. Dort hatte ich aber gemerkt, echt nicht mehr gucken zu kÃķnnen, auch wenn ich mich sehr Þber den Chorumgang in der Kirche freuen konnte. ChorumgÃĪnge sind super. Vor der Kirche fand gerade irgendeine kleine Handwerks- und Industriemesse statt, und wÃĪhrend ich auf alte GemÃĪlde mit Goldgrund guckte, hÃķrte ich einen mittelmÃĪÃigen Elvis-Imitator. Auch das war, neben meiner Kopfmatschigkeit, ein bisschen dem Kunstgenuss abtrÃĪglich.
Ich las im CafÃĐ, dann las ich auf einer Bank in der FuÃgÃĪngerzone, und dann hatte auch der Herr Feierabend und mein Kopf war wieder wach. Wir setzten uns in einen netten Biergarten mit noch netterem Service, aÃen eine Kleinigkeit, ich gÃķnnte mir drei schÃķne Dunkelbiere und blubberte vermutlich viel zu lange Þber Nazischeià (sorry!), wir sprachen aber immerhin nur drei Minuten Þber Trump und zwei Þber SÃķder, und dann viel lÃĪnger Þber schÃķne Dinge. Das war sehr nett, vielen Dank. Auch fÞr die Wegbeschreibung zum Bahnhof: âEinfach immer an der Stadtmauer lang.â Das kÃķnnen ja auch nicht mehr viele StÃĪdte von sich sagen.
Der Herr musste etwas frÞher weg als mein Zug fuhr, also trank ich mein letzten Bierchen sehr gemÞtlich, las weiter, schlenderte dann zum Bahnhof, las dort noch, stieg um kurz vor zehn in den ICE und, wer hÃĪtte es gedacht, las. Ich beendete das sehr schÃķne Buch fast punktgenau â fÞnf Minuten, bevor der Zug im MÞnchen ankam. Das freut den inneren Monk.
FÞr die zehnminÞtige Wartezeit auf die U-Bahn nach Hause hÃĪtte ich sogar noch ein zweites Buch im Rucksack gehabt (MAN WEISS JA NIE!), aber mein Kopf war schon im Bett. Der KÃķrper kam relativ schnell nach.
—
Was schÃķn war, Samstag, 16. Juni 2018 â Mein erster Bloomsday
Auf diesen Tag hatte ich quasi hingearbeitet: Ich wollte den Ulysses bis zum 15. Juni durchgelesen haben (I did it!), damit ich am 16. stolz den Bloomsday begehen konnte. Nicht in Dublin, aber immerhin mit dem Kauf von Zitronenseife, die ich auch brav in der Hosentasche mit mir herumtrug, wenigstens von der Lush-Filiale bis nach Hause.
Das Praktische an Lush ist ja: Selbst wenn man nicht weiÃ, wo genau es auf der Sendlinger StraÃe ist, riecht man es schon hundert Meter entfernt. So ging es mir auch; ich kam von der U-Bahn am Sendlinger Tor, ging in Richtung Asamkirche, und kurz hinter dieser roch ich schon die Þbliche Duftwolke. Ich habe seit Jahren nicht mehr bei Lush eingekauft, hatte den Geruch aber sofort wieder in der Nase. Eine freundliche Dame zeigte mir ihre beeindruckende Auswahl an Zitronenseifen, ich nahm gleich die erste, die am wenigsten Firlefanz hatte und noch dazu hÞbsch aussah, gÃķnnte mir noch eine Nachtcreme und ging wieder aus dem Parfumschuppen an die frische Luft.
Wenn ich eh schon in der NÃĪhe der Asamkirche bin, gucke ich natÞrlich auch rein. FÞnf Minuten barockester Barock sind immer drin.
Die Þblichen Touris machten ihre Bilder, und als ich mich wieder dem Ausgang zuwandte, kam eine ganze Gruppe hinein, alle schon die Kameras im Anschlag â und grÃķÃtenteils in Argentinien-Trikots gewandet. Ich flÞsterte ein âGood luck for the game today!â in ihre Richtung, aber ich glaube, das war so auÃerhalb des kirchlichen oder touristischen Kontextes, dass ich nur lÃĪchelndes Starren zurÞckbekam. Wenn ich mein Finnbogason-Trikot angehabt hÃĪtte, wÃĪre das vielleicht verstÃĪndlicher gewesen. (FÞr die fuÃballfreie Zone: Gestern spielte Argentinien gegen Island in der WM. Der Herr Finnbogason spielt fÞr Island, aber auch fÞr Augschburg, und ich habe ein FCA-Trikot mit seinem Namen drauf.)

Sehen Sie die Figuren unten rechts? Diese Kirche ist so irre.
Nach der Kirche ging ich wieder in Richtung Sendlinger Tor, als ich mich an eine Twitter-Reply vom German Abendbrot erinnerte, die ich bekam, als ich vom neu entdeckten Nilgiri-Tee schwÃĪrmte. Sie fragte, ob ich den vom Teahouse an der Sendlinger kenne. Kannte ich noch nicht â aber seit gestern schon, denn ich lieà mir einfach mal 100 Gramm abwiegen und kochte zuhause eine schÃķne Kanne. Er kam mir deutlich zitroniger vor als der Nilgiri vom Dallmayr, was gut zu meiner Hosentasche passte.
Vor der Teekanne kamen aber noch der Supermarkt und der Buchladen dran. Im Buchladen holte ich meine zwei neuen Joyce-BÞcher ab, und ich fand es sehr schÃķn, dass sie genau am Bloomsday fÞr mich bereitlagen. Ich hatte sie erst Freitag bestellt und mich auf Montag eingerichtet.
Danach ging ich zum Supermarkt und erstand ein Pfund Mehl sowie frische Hefe; das neue Brotbackbuch lockte. Eigentlich wollte ich mich sofort an BaguettebrÃķtchen und Fladenbrot machen, aber ich dachte, fÃĪngste doch mal schlau mit dem ersten Rezept im Buch an, dem Grundrezept, das danach in 100 Variationen abgefiedelt wird. Die Unterschiede zum Topfbrot beschreibe ich vermutlich ein epischer Breite, wenn das Brot fertig ist; noch ist es ein Teig in meiner KÞche, den ich direkt nach VerÃķffentlichung dieses Blogbeitrags in einen Laib verwandeln werde. Schauen Sie auch morgen wieder vorbei!
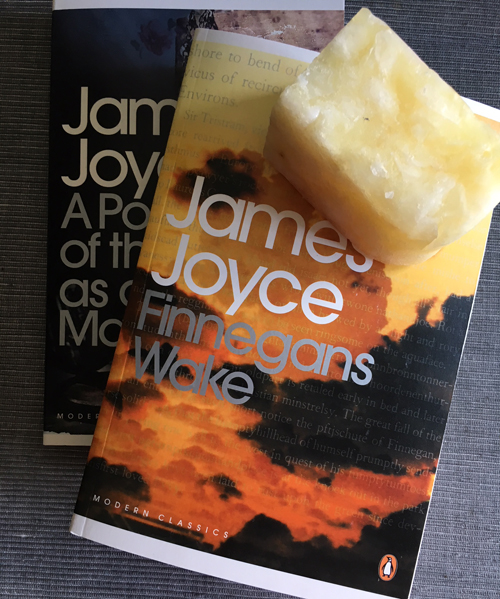
Mit frischem Tee, der Zeitung und zwei neuen BÞchern lungerte ich dann des Rest des Tages auf dem Sofa herum und schaute ein FuÃballspiel nach dem anderen. ZunÃĪchst mÞhte sich Frankreich sehr ab, was mir noch wurscht war, denn ich wartete natÞrlich auf #ARGISL, brav im Trikot, wie sich’s gehÃķrt. Dort durfte ich auch sehr laut jubeln, denn ALFREDFINNBOGASON (hier StadionlautstÃĪrke in der Stimme vorstellen) schoss das erste WM-Tor fÞr Island in dessen FuÃballgeschichte. Das Spiel endete 1:1 unentschieden, was quasi ein Sieg war.

Ja, F. und ich DMen manchmal auf Englisch. Und der Mann weiÃ, dass es nicht âdon’tâ heiÃt. Und ich weià seit gestern, dass die Wikinger keine HÃķrner hatten.
Auf Peru gegen DÃĪnemark verzichtete ich grÃķÃtenteils, weil ich endlich die ersten Folgen der neuen Staffel Queer Eye gucken wollte. Ich war sofort wieder der Puscheligkeit der fÞnf Herren verfallen und bin begeistert darÞber und fasziniert davon, dass es manche TV-Formate schaffen, mich nach fÞnf Minuten in eine Decke von Heimeligkeit zu wickeln.
Abends schlenderte ich dann Þber den Alten NÃķrdlichen Friedhof zu F. und wir schauten Kroatien gegen Nigeria gemeinsam, tranken Wein, knabberten SalzgebÃĪck und quatschten danach noch unter dem Sternenhimmel.
Mein erster Bloomsday war ein wirklich schÃķner Tag.
—
Joyce lesen
Die Ãberschrift ist eine Anspielung auf einen ÃĪlteren Blogeintrag, den ich schrieb, nachdem ich den letzten Band der Recherche von Proust durchgelesen hatte. Gestern beendete ich Ulysses von Joyce. Ratet, was ich danach geschrieben habe.
—
Ich versammele mal (fast) alle BlogeintrÃĪge zum Buch, die ich seit Anfang diesen Jahres verÃķffentlicht habe. Wer die alle schon kennt, springt zum Instagram-Bild am Ende vor, danach kommt die groÃe Erkenntnis, die mir vergÃķnnt war.
Am 8. Januar erwÃĪhnte ich erstmals, was ich gerade las:
FÞr Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit habe ich drei AnlÃĪufe gebraucht, um Þber die ersten fÞnf Seiten hinauszukommen, aber dann habe ich einfach alle dreitausend gelesen. Mal sehen, ob das auch beim Ulysses klappt. Den lese ich nÃĪmlich seit gestern, und ich habe bereits zwei Kapitel bezwungen, nachdem ich bei den ersten Versuchen nach zwei Seiten aufgegeben hatte.
F. hat im letzten Jahr mehrere Monate Finnegans Wake vor der Nase gehabt, an das ich mich vermutlich nicht rantrauen werde, aber wir sprachen Ãķfter darÞber und Þber die ZÞricher James-Joyce-Stiftung, die F. mit einem seiner Freunde schon mehrfach besucht hat. Der Leiter der Stiftung Fritz Senn hat einen guten Tipp fÞrs Joyce-Lesen, wenn man eingeschÞchtert vor dem WÃĪlzer steht und gar nicht weiÃ, mit welcher SekundÃĪrliteratur man anfangen soll, um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Er meint: âTake the short cut. Read the book.â
Genau das habe ich gestern gemacht. Ich selbst besitze den Text der Erstausgabe von 1922, laut meiner Eintragung auf der ersten Buchseite seit 2004. Diese wurde aber von Joyce wieder und wieder Þberarbeitet â wenn ich dem Vorwort glauben darf, musste man ihm die Druckfahnen quasi aus der Hand reiÃen, und selbst dann hat er noch darauf rumgemalt, weswegen es diverse Textfassungen gibt. Seit Jahren gilt die Gabler-Edition von 1984 als der Text, der Joyces Vorstellung am nÃĪchsten kommt, auch wenn die Ausgabe groÃe Kontroversen hervorrief. Die Editionsgeschichte in der englischen Wikipedia tut so, als wÃĪre die Gabler-Edition Schrott, was, soweit ich weiÃ, selbst Schrott ist. Aber eigentlich weià ich Þber das Thema noch viel zu wenig.
Wie dem auch sei: Ich lese seit gestern die Gabler-Edition von F., die keine FuÃnoten hat, gucke aber nach jedem Kapitel in die Endnotes meiner Edition
, um im Nachhinein zu verstehen, was ich da gerade gelesen habe. Es macht aber ziemlichen SpaÃ, sich einfach so in Joyce fallenzulassen, seine Sprache zu genieÃen, auch wenn ich bei manchen Zeilen nicht weiÃ, was die schÃķnen WÃķrter mir sagen wollen. But look how pretty:
âWoodshadows floated silently by through the morning peace from the stairhead seaward where he gazed. Inshore and farther out the mirror of water whitened, spurned by lightshod hurrying feet. White breast of the dim sea. The twining stresses, two by two. A hand plucking the harpstrings, merging their twining chords. Wavewhite wedded words shimmering on the dim tide.â
Oder hier, als Dedalus an seine tote Mutter denkt:
âFolded away in the memory of nature with her toys. Memories beset his brooding brain. Her glass of water from the kitchen tap when she had approached the sacrament. A cored apple, filled with brown sugar, roasting for her at the hob on a dark autumn evening. Her shapely fingernails reddened by the blood of squashed lice from the childrenâs shirts.â
Oder so NebenbeisÃĪtze, die mich kurz innehalten lassen â wenn Dedalus sich selbst im Spiegel sieht und denkt: âWho chose this face for me?â
Ich freue mich jetzt schon auf den Feierabend, wenn ich das dritte Kapitel beginnen werde.
—
Am 9. Januar hatte ich bereits drei Kapitel geschafft:
Chuckling at this review of Ulysses at the Waterstones in Oxford @WaterstonesOxf pic.twitter.com/QInJA1PROd
— Lillian (@HingleyTheory) 7. Januar 2018
Kurz vor dem Schlafengehen schaffte ich noch das dritte Kapitel von Ulysses, den ich vorgestern begonnen hatte. Ich glaube, die ersten zwei Kapitel hatten mich in falsche Sicherheit gewogen, denn sie waren zwar schwierig, aber irgendwie nachvollziehbar. Aber nach dem dritten dachte ich: âI have no idea what I’ve just read.â Dass es ein Stream of Consciousness war, hatte ich immerhin kapiert, aber worum es genau ging, konnte ich nur erahnen.
Trotzdem war es eine Freude, den Text zu lesen, was mich die ganze Zeit selbst verwirrte. Bei Sachtexten schimpfe ich sofort los, wenn irgendwas unklar ist, und auch bei literarischen weià ich gerne, was das Buch von mir will. Hier habe ich keine Ahnung, ich treibe einfach so durch die Worte und gucke, was sie mit mir machen. Mir fiel auf, dass ich genauso auch inzwischen an Kunst herangehe â ich versuche nicht mehr zu verstehen, ich gucke einfach nur und warte, was passiert. Meist lese ich danach schlaue Texte Þber die Bilder, vor denen ich gerade stand â und genauso wollte ich Ulysses lesen. Als ich aber gestern merkte, dass die Explanatory Notes lÃĪnger waren als das eigentliche Kapitel, dachte ich mir, ach, Schnickschnack, ich lese einfach das Buch weiter und gucke mal, wo es mich hinwirft. Wie ich vorgestern schon schrieb: âTake the short cut, read the book.â Den Satz verstand ich erst gestern abend so richtig.
—
Einen Tag spÃĪter hatte ich das vierte Kapitel durch:
Abends das vierte Kapitel von Ulysses gelesen. Die Taktik, sich wirklich immer nur ein Kapitel vorzunehmen, klappt ganz gut, ich werde nicht erschlagen von den vielen Fragen, die ich wÃĪhrend des Lesens habe, kann aber schon Dinge einordnen, die mir bekannt vorkommen. AuÃerdem habe ich neben der Oxford-Studienausgabe mit den Endnotes noch ein weiteres Buch bei mir im Regal gefunden, das ich sehr hilfreich finde: The New Bloomsday Book: Guide Through “Ulysses”. Darin wird der Inhalt nacherzÃĪhlt, aber es werden keine literarischen Anspielungen erklÃĪrt oder die vielen fremdsprachigen EinwÞrfe und Begriffe Þbersetzt. Diesen Satz aus einer Rezension fand ich sehr schÃķn: âHe guides the first-time reader carefully through Joyce’s (famously difficult) novel, but does not challenge the mystery that make[s] Ulysses a joy to read.â Mit diesen beiden SekundÃĪrliteraturen kann man sich das Buch ziemlich gut erarbeiten. Yay, ich lese Ulysses!
—
Am 12. Januar steckte ich in Kapitel 5 fest:
Genau wie in Kapitel 4 folgen wir Herrn Bloom bei seinem Weg durch Dublin und kriegen wie aus den Augenwinkeln mit, was er tut, was er sieht und worÞber er nachdenkt, gerne flÞchtig und in schwer durchschaubaren HalbsÃĪtzen. Gestern fiel mir zum ersten Mal auf, dass einige dieser HalbsÃĪtze wie Bildbeschreibungen aussehen â und mit denen kann ich rein aus Erfahrung mehr anfangen als mit, ich nenne sie jetzt mal so, literarischen HalbsÃĪtzen. Sobald ich anfing, seine Worte nicht mehr als Gedankenstrom und Assoziationsgeklingel anzusehen, sondern als einen Bildeindruck, verstand ich sie gefÞhlt eher. Ich nahm Cluster war, die ich vorher nicht gesehen hatte, Symboliken, die auf einmal Sinn ergaben.
Ich merke, dass es mir schwerfÃĪllt, meine LeseeindrÞcke in Worte zu fassen. Vielleicht sind meine Gedanken genau die gleichen Assoziationen, die mir gerade beschrieben werden: Bloom blubbert innerlich vor sich hin und ich lege im Geist weitere Dinge an. Das ist ein sehr neues Leseerlebnis, was mir da gerade widerfÃĪhrt. Es ist deutlich zeitaufwÃĪndiger als das meiste, was ich bisher gelesen habe, weil ich mich sehr konzentrieren muss â Ulysses ist kein Buch fÞr die U-Bahn, am gestrigen dreizehnseitigen Kapitel saà ich eine Stunde â, aber es ist sehr lohnend.
—
Am 19. Januar erwÃĪhnte ich nur, dass ich ein weiteres Kapitel hinter mir gelassen hatte, beschrieb das Leseerlebnis aber nicht groà â auÃer meine Ãberraschung, dass âUlyssesâ lustig sein kann. Am 21. Januar hatte ich das achte Kapitel beendet und schrieb Þber meine Assoziationen zu Essen, das in diesem Kapitel eine Rolle spielte. Am 30. Januar war anscheinend eine ErkÃĪltung auskuriert und ich konnte wieder lesen:
Der Husten hÃĪlt sich hartnÃĪckig, aber der Kopf ist wieder klar. Das heiÃt, ich konnte nach tagelanger Pause endlich im Ulysses weitermachen, fÞr den mein Hirn die ganze letzte Woche gefÞhlt zu matschig gewesen war. Ich beendete das neunte Kapitel.
In den Kapiteln zuvor folgte ich Bloom und meckerte innerlich rum, dass ich viel lieber Dedalus folgen wÞrde und zack, durfte ich das im neunten Kapitel tun. Schon nach den ersten Seiten fiel mir ein, warum ich lieber Þber Stephen lesen wollte: Bisher sind die Dedalus-Kapitel die fiesen, bei denen man quasi nichts versteht, aber dafÞr lesen sie sich fÞr meinen Geschmack viel spannender, eben weil man quasi nichts versteht. Wobei das falsch formuliert ist: Ich lese viel neugieriger, viel aufmerksamer, weil ich stets versuche, doch irgendwas mitzukriegen. Ich kann die Worte erfassen, die mir begegnen, aber sie ergeben keinen fÞr mich bekannten Sinneszusammenhang. Es liest sich wie der irre zweite Wein, den wir im Tantris hatten, es liest sich wie ein Twombly-GemÃĪlde. Man wird irgendwo reingeworfen und muss sehen, wie man mit den UmstÃĪnden klarkommt. Ich kann verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist, ich habe, wie beschrieben, auch drei AnlÃĪufe fÞr dieses Buch gebraucht, aber jetzt sitze ich mitten drin und lasse mich durch die Wortwellen schaukeln.
AuÃerdem habe ich seit gestern die perfekte Reply auf alles auf Twitter: âI know. Shut up. Blast you. I have reasons.â (Kapitel 9, Zeile 847, Gabler-Edition.)
Und eine wunderbare Beschreibung des Zustands, wenn man aus der Bibliothek kommt: âStephen, greeting, then all amort, followed a lubber jester, a wellkempt head, newbarbered, out of the vaulted cell into a shattering daylight of no thought.â A shattering daylight of no thought. <3 (Kapitel 9, Zeilen 1110â1113, Gabler-Edition.)
—
Erst am 23. Februar fand sich der nÃĪchste Eintrag:
Abends endlich mal wieder ein Kapitel im Ulysses gelesen: Wandering Rocks. Dabei bummeln wir mit diversen Protagonist*innen durch Dublin. Es war das Kapitel, das mir bisher am modernsten vorkam, es fÞhlte sich an wie eine filmische Montage, die mehrere HandlungsstrÃĪnge aufmacht und sie am Ende stimmig wieder zusammenfÞhrt.
Und nebenbei kam der schÃķne Satz âDamn good gin that wasâ darin vor. Soll nochmal einer sagen, dass Joyce so unverstÃĪndlich ist.
—
Und wiederum erst gut einen Monat spÃĪter der nÃĪchste Eintrag, der sich inhaltlich mit dem Buch auseinandersetzte:
Nachmittags lockte dann aber wieder der Ulysses. Im Sirenen-Kapitel saà ich sehr lange fest, weil ich immer nur zwei Seiten geschafft hatte, bevor mir abends die Augen zufielen. […]
Gestern wollte ich dieses Kapitel aber endlich abschlieÃen. Nicht weil es so langweilig ist (haha, langweilig. Der Ulysses und langweilig. Ihr seid ja niedlich), sondern … ÃĪhm … ich weià gar nicht, warum ich es so dringend abschlieÃen wollte. Vielleicht einfach nur, um mich ins nÃĪchste Kapitel stÞrzen zu kÃķnnen, das wieder ganz anders klingt. Wobei mir bisher Sirens am besten gefallen hat, denn es liest sich irre musikalisch. Die nachtrÃĪglich aufgeschlagene SekundÃĪrliteratur verriet mir, dass Joyce 150 StÞcke oder Lieder irgendwie anreiÃt, aber das war mir alles wurst. Dieses Kapitel klingt durch seine vielen Alliterationen, abgekÞrzte WÃķrter, SÃĪtze ohne Kommata, wildes Wortgewusel teilweise so, als ob man es singen kÃķnnte, was total toll zu den Sirenen passt. (Ach was?!?)
Nebenbei lernte ich neulich auf Twitter, dass Sirenen nicht sexy sind. Das wusste Joyce mit seiner englischen Ãbersetzung vermutlich nicht; auch darauf weist jemand im Thread hin. Denn das Kapitel kam mir neben seiner MusikalitÃĪt sehr sinnlich vor, teilweise schon fast niedlich-platt auf die ZwÃķlf, teilweise verfÞhrerisch, tastend, langsam, mal sehen, was geht. Und auÃerdem fand ich in diesem Kapitel meinen KÞnstlernamen, falls ich jemals einen brauche. […]
Jedenfalls geht es in diesem Kapitel um zwei Bardamen, Lydia und Mina. Den beiden werden Bronze und Gold zugeordnet, warum, steht bei der Wikipedia, und zum Schluss verkÞrzt Joyce mal wieder wild, weil er’s halt kann, auch Namen, und dann kommen SÃĪtze dabei heraus wie: âBlind he was she told George Lidwell second I saw. And played so exquisitely, treat to hear. Exquisite contrast, bronzelid, minagold.â
Mina Gold. Super Name. Die Idee hatte allerdings schon jemand. Und eine Mine ist es auch. Aber bis zum Googeln war ich der Meinung, ich hÃĪtte einen schÃķnen KÞnstlernamen gefunden.
—
Am 2. April war wieder ein Kapitel erledigt:
Wieder ein Kapitel im Ulysses durchschritten. Ich verweise faul auf die Zusammenfassung in der Wikipedia, die ich aber noch ergÃĪnzen mÃķchte. Ich empfand den Schreibstil nicht als Slang oder Alltagssprache â im Vergleich zu den anderen Kapiteln las sich dieses fast wie ein normales Buch mit Dialogen, denen man folgen konnte. Diese GesprÃĪche einer MÃĪnnergruppe im Pub werden unterbrochen von Berichten, die vÃķllig Þberzogen von verschiedenen Dingen erzÃĪhlen. Mit âvÃķllig Þberzogenâ meine ich nicht nur den Tonfall, sondern auch die Beschreibungen. Hier zum Beispiel der Beginn der Beschreibung eines irischen Helden:
âThe figure seated on a large boulder at the foot of a round tower was that of a broadshouldered deepchested stronglimbed frankeyed redhaired freely freckled shaggybearded wide-mouthed largenosed longheaded deepvoiced barekneed brawnyhanded hairylegged ruddyfaced sinewyarmed hero.â (Gabler-Edition, S. 243, Zeile 151â156.)
Die Herren unterhalten sich Þber Hinrichtungen. Auch hier wird wieder ein Bericht eingeschoben. Er erwÃĪhnt unter anderem die anwesenden Zeugen, bei deren Fantasiennamen man heute wegen ihres Alltagsrassismus latent zusammenzuckt. Ich muss gestehen, ich habe bei den deutschsprachigen aber doch lachen mÞssen. (Den Bindestrich habe ich eingefÞgt, weil der Name mir sonst ernsthaft das Layout zerschossen hÃĪtte.)
âThe viceregal houseparty which included many wellknown ladies was chaperoned by Their Excellencies to the most favourable positions on the grand stand while the picturesque foreign delegation known as the Friends of the Emerald Isle was accommodated on a tribune directly opposite. The delegation, present in full force, consisted of Commendatore Bacibaci Beninobenone (the semi-paralysed doyen of the party who had to be assisted to his seat by the aid of a powerful steam crane), Monsieur Pierrepaul PetitÃĐpatant, the Grandjoker Vladinmire Pokethankertscheff, the Archjoker Leopold Rudolph von Schwanzenbad-Hodenthaler, Countess Marha Virdga KisÃĄszony PutrÃĄpesthi, Hiram Y. Bomboost, Count Athanatos Karamelopulos. Ali Baba Backsheesh Rahat Lokum Effendi, SeÃąor Hidalgo Caballero Don Pecadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la Malaria, Hokopoko Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf Kobberkeddelsen, Mynheer Trik van Trumps, Pan Poleaxe Paddyrisky, Goosepond Prhklstr Kratchinabritchisitch, Herr Hurhausdirektorprasident Hans Chuechli-Steuerli, Nationalgymnasiummuseumsanatoriumandsuspensoriumsordinary-privatdocentgeneralhistoryspecialprofessordoctor Kriegfried Ueberallgemein. All the delegates without exception expressed themselves in the strongest possible heterogeneous terms concerning the nameless barbarity which they had been called upon to witness.â (Gabler-Edition, S. 252, Zeilen 552â571.)
Was im Wikipedia-Eintrag ein bisschen zu kurz kommt: Es geht nicht nur um Antisemitismus. Auch Schwarze, EnglÃĪnder und Frauen kommen nicht besonders gut weg in diesem Kapitel. Wobei ich fast bei allen BÞchern aus dieser Zeit bei den Frauenbeschreibungen die Augen rolle, aber da muss ich wohl weiterhin durch. Wie oben angesprochen, las sich dieses Kapitel im Vergleich recht einfach. Aber da will mich Joyce nur in Sicherheit wiegen, denn das ÞbernÃĪchste wird eine schÃķne Herausforderung, wenn ich der Wikipedia und F. glauben darf.
—
Auf der RÞckfahrt von Hamburg am 23. April las ich teilweise augenrollend, aber grÃķÃtenteils fasziniert âNausicaâ (das Kapitel vor dem eben angesprochenen âOxen of the Sunâ):
[D]ann las ich ein weiteres Kapitel im Ulysses und musste wiederholt die Augen rollen bei den Beschreibungen der Damenwelt. Wenn es irgendeinen Grund gibt, warum ich die BÞcher des literarischen Kanons (also den von weiÃen Kerlen aufgestellten) allmÃĪhlich ignoriere, dann den, weil es so irrsinnig anstrengend ist, den male gaze, den ich schon in der Kunstgeschichte dauernd sehe, auch noch lesen zu mÞssen. Hier entspannt sich Bloom gerade, nachdem er sich befriedigt hat und schaut der hinkenden Frau nach, die sich von ihm dafÞr hat anschauen lassen:
âMr Bloom watched her as she limped away. Poor girl! That’s why she’s left on the shelf and the others did a sprint. Thought something was wrong by the cut of her jib. Jilted beauty. A defect is ten times worse in a woman. But makes them polite. Glad I didn’t know it when she was on show. Hot little devil all The same. Wouldn’t mind. Curiosity like a nun or a negress or a girl with glasses. That squinty one is delicate. Near her monthlies, I expect, makes them feel ticklish. I have such a bad headache today. Where did I put the letter? Yes, all right. All kinds of crazy longings. Licking pennies. Girl in Tranquilla convent that nun told me liked to smell rock oil. Virgins go mad in the end I suppose. Sister? How many women in Dublin have it today? Martha, she. Something in the air. That’s the moon. But then why don’t all women menstruate at the same time with same moon, I mean? Depends on the time they were born, I suppose. Or all start scratch then get out of step. Sometimes Molly and Milly together. Anyhow I got the best of that. Damned glad I didn’t do it in the bath this morning over her silly I will punish you letter. Made up for that tramdriver this morning. That gouger M’Coy stopping me to say nothing. And his wife engagement in the country valise, voice like a pickaxe. Thankful for small mercies. Cheap too. Yours for the asking. Because they want it themselves. Their natural craving. Shoals of them every evening poured out of offices. Reserve better. Don’t want it they throw it at you. Catch em alive, O. Pity they can’t see themselves. A dream of wellfilled hose.â
(Kapitel 13, Zeilen 772â793, Gabler-Edition.)
EYEROLL!
—
âOxen of the Sunâ erwÃĪhnte ich sehr kurz am 10. Mai:
Wieder ein Kapitel im Ulysses in Angriff genommen. Nicht ganz fertig geworden, mich aber wieder gefreut, Ulysses zu lesen. Ich wusste, dass sich in diesem Kapitel der Sprachstil ÃĪndert und hatte mir vorgenommen, darauf zu achten, wann und wie er das tut, also ob sich das am Inhalt direkt festmachen lÃĪsst, wann das Englische vom Altenglisch zu einem etwas moderneren wird. Trotzdem habe ich diesen einen Satz, diesen einen Zeitpunkt nie mitbekommen, weil ich so mit dem Inhalt beschÃĪftigt war. Mir ist nur irgendwann mittendrin aufgefallen, dass es sich auf einmal anders liest. Joyce, der alte DJ! SchÃķn Þbergeblendet! (Oder wie immer das bei DJs heiÃt, wenn ein StÞck ins nÃĪchste Þbergeht, ohne dass man es mitbekommt.)
—
Und am 24. Mai war ich dann im lÃĪngsten Kapitel des Buchs: âIch bin endlich im Circe-Kapitel angekommen, dem Everest des ganzen Buchs, und ich ahne, dass ich darin ein bisschen versacken werde.â Am 27. Mai bloggte ich darÞber:
Ansonsten widmete ich mich dem riesigen Circe-Kapitel im Ulysses, das ich allerdings nicht durchbekam; irgendwie geriet mir ein SchlÃĪfchen dazwischen. Mein Plan ist es, das Buch bis zum 15. Juni durchgelesen zu haben, denn am 16. ist bekanntlich Bloomsday, und den kÃķnnte ich dann in diesem Jahr erstmals mitfeiern. Zumindest im Geist, nach Dublin fahren werde ich dazu nicht. Aber ich kÃķnnte eine schÃķne Zitronenseife kaufen.
Vorher muss ich aber noch ein bisschen lesen. Circe ist in Form eines TheaterstÞcks geschrieben. Die Regieanweisungen sind genauso surreal wie die theoretisch gesprochenen Texte, und was mir in diesem Kapitel zum ersten Mal im Buch passierte, ist, dass sich das GefÞhl beim Lesen dauernd ÃĪndert. Klar gibt es auch in den anderen Kapiteln SpannungsbÃķgen â oder eben nicht â, aber gestern stellte ich quasi alle fÞnf Minuten fest, dass ich mich anders fÞhlte als eben noch.
Es gibt Stellen, bei denen ich keine Ahnung habe, worum es gerade geht, aber auch das kenne ich schon, und ich glaube inzwischen, das muss so sein. Ich lasse mich von den Worten und Beschreibungen mittragen, ohne dass ich weiÃ, was sie von mir wollen; es ist ein bisschen wie Touristin in einem fremden Land zu sein, dessen Sprache man nicht spricht. Man wird zu irgendeiner Feier eingeladen, es gibt Dinge zu essen und zu trinken, die man nicht kennt, und man macht halt mit und es ist irgendwie okay. Wenige Seiten spÃĪter merkte ich, dass ich traurig war und nicht einmal sagen konnte, warum eigentlich. Bloom muss sich verteidigen, er stottert Wortbrocken vor sich hin, beschreibt die Beerdigung, von der er kommt, bis sogar der Leichnam persÃķnlich seine Aussage bestÃĪtigt. Wieder einige Seiten spÃĪter scheint Bloom erst zum BÞrgermeister Dublins zu werden und dann gottÃĪhnlich, es folgen Beschreibungen von Þppigen FestivitÃĪten mit riesigen Aufbauten und Menschenmengen, und ich wurde ehrfÞrchtig (und mochte die Beschreibungen gern).
âBLOOM My beloved subjects, a new era is about to dawn. I, Bloom, tell you verily it is even now at hand. Yea, on the word of a Bloom, ye shall ere long enter into the golden city which is to be, the new Bloomusalem in the Nova Hibernia of the future.
(Thirtytwo workmen wearing rosettes, from all the counties of Ireland, under the guidance of Derwan the builder construct the new Bloomusalem. It is a colossal edifice, with crystal roof built in the shape of a huge pork kidney, containing forty thousand rooms. In the course of its extension several buildings and monuments are demolished. Government offices are temporarily transferred to railway sheds. Numerous houses are razed to the ground. The inhabitants are lodged in barrels and boxes, all marked in red with the letters: L. B. Several paupers fall from a ladder. A part of the walls of Dublin, crowded with loyal sightseers, collapses.)
THE SIGHTSEERS (Dying) Morituri te salutant. (They die.)â
(Gabler-Edition, Kapitel 15, Zeilen 1541â1557)
Ein paar Seiten spÃĪter musste ich sehr Þber die neuen Musen dieser neuen Zeit lachen:
âBloom explains to those near him his schemes for social regeneration. All agree with him. The keeper of the Kildare Street Museum appears, dragging a lorry on which are the shaking statues of several naked goddesses, Venus Callipyge, Venus Pandemos Venus Metempsychosis, and plaster figures, also naked, representing the new nine muses, Commerce, Operatic Music, Amor Publicity, Manufacture, liberty of Speech, Plural Voting, Gastronomy, Private Hygiene, Seaside Concert Entertainments, Painless Obstetrics and Astronomy for the People.â (1702â1710)
Dann wird Bloom plÃķtzlich zu einer Frau und gebiert Kinder und ich las vermutlich mit offenem Mund und simpler Begeisterung.
âDR DIXON (Reads a bill of health) Professor Bloom is a finished example of the new womanly man. His moral nature is simple and lovable. Many have found him a dear man, a dear person. He is a rather quaint fellow on the whole, coy though not feeble-minded in the medical sense. He has written a really beautiful letter, a poem in itself, to the court missionary of the Reformed Priests’ Protection Society which clears up everything. He is practically a total abstainer and I can affirm that he sleeps on a straw litter and eats the most Spartan food, cold dried grocer’s peas. He wears a hairshirt winter and summer and scourges himself every Saturday. He was, I understand, at one time a firstclass misdemeanant in Glencree reformatory. Another report states that he was a very posthumous child. I appeal for clemency in the name of the most sacred word our vocal organs have ever been called upon to speak. He is about to have a baby.
(General commotion and compassion. Women faint. A wealthy American makes a street collection for Bloom. Gold and silver coins, bank cheques, banknotes, jewels, treasury bonds, maturing bills of exchange, I.O.U.s, wedding rings’ watch-chains, lockets, necklaces and bracelets are rapidly collected.)
BLOOM O, I so want to be a mother.
MRS THORNTON (In nursetender’s gown) Embrace me tight, dear. You’ll be soon over it. Tight, dear.
(Bloom embraces her tightly and bears eight male yellow and white children. They appear on a redcarpeted staircase adorned with expensive plants. All are handsome, with valuable metallic faces, wellmade, respectably dressed and wellconducted, speaking five modern languages fluently and interested in various arts and sciences. Each has his name printed in legible letters on his shirtfront: Nasodoro, Goldfinger, Chrysostomos, MaindorÃĐe, Silversmile, Silberselber, Vifargent, Panargros. They are immediately appointed to positions of high public trust in several different countries as managing directors of banks, traffic managers of railways, chairmen of limited liability companies, vice chairmen of hotel syndicates.)â (1798â1832)
Dann sind wir wieder im Bordell, wo das ganze Kapitel spielt, die anwesenden Damen und ihre kÃķrperlichen VorzÞge werden beschrieben, was mich genervt hat, aber immerhin ist Stephen wieder da, dem ich so gerne folge. Und dann singt eine Motte ein Lied, das mich rÞhrte, warum auch immer:
âI’m a tiny tiny thing
Ever flying in the spring
Round and round a ringaring.
Long ago I was a king,
Now I do this kind of thing
On the wing, on the wing!
Bing!â (2469â2475)
âLong ago I was a king / Now I do this kind of thingâ fand ich sehr schÃķn und gleichzeitig sehr traurig. (Ja, es ist eine Motte, schon gut. Trotzdem.)
Ich beendete das Kapitel bei circa Zeile 2700; auf mich warten noch ungefÃĪhr 2300. Die Drogen, die Joyce bei diesem Kapitel eingenommen hat, will ich auch.
—
Am 10. Juni war das drittletzte Kapitel erledigt:
Gestern durchschritt ich das drittletzte Kapitel vom Ulysses, das mir wie eine Pastiche (oder sogar Parodie) auf Proust, Dickens, Melville und die anderen Herren mit den langen Texten und den vielen Adjektiven vorkam. Das war mit Abstand das un-ulysseischste Kapitel im Buch, weil es sich so normal angefÞhlt hat. Und so sehr ich bei allen anderen Kapiteln zwar davon fasziniert war, dass ich Dinge lese und nicht weià warum, weil ich nicht weiÃ, was das alles soll, aber gleichzeitig ein bisschen verlassen auf hoher See war, weil ich eben nicht wusste, wo es hingeht, so war ich hier auf einmal im sicheren Hafen total gelangweilt. Hier kenne ich ja alles! Werd bitte wieder irre, du seltsamstes Buch aller Zeiten!
ðĪĢð
— James Joyce Centre (@BloomsdayDublin) 10. Juni 2018
—
Vergangenen Montag dann das vorletzte:
[D]ann nahm ich mir das vorletzte Kapitel im Ulysses vor: Ithaca.
Die Wikipedia behauptet, âDie Handlung wird â mÞhsam und umstÃĪndlich â in Form von pseudo-wissenschaftlichen Fragen und Antworten erzÃĪhltâ, was ich Þberhaupt nicht so empfunden habe. Frage und Antwort, ja, oder auch gerne mal eine Anweisung: âCompile the budget for 16 June 1904â, worauf eine Liste mit Dingen und Preisen folgt, aber dass das âmÞhsam und umstÃĪndlichâ gewesen sein soll, fand ich Þberhaupt nicht. Ich habe das Kapitel mit groÃem Genuss gelesen und hÃĪtte davon auch gerne noch weitere 50 Seiten gehabt, gerade weil ich es so spannend fand, dass das relativ strenge Format â Frage und Antwort â nie langweilig wurde, ganz im Gegenteil.
Das lag natÞrlich auch an den Fragen. Manche erforderten eine kurze Antwort, andere brauchten eine Seite. Zum Beispiel, als Bloom sich in der KÞche die HÃĪnde waschen mÃķchte, bevor er sich und Stephen einen Kakao zubereitet. Die total logische Frage, die uns allen auf der Seele brennt, lautet:
âWhat in water did Bloom, waterlover, drawer of water, watercarrier returning to the range, admire?â
Und die Antwort, nach der ich das Buch mal eben umarmen und F. eine schwÃĪrmische DM schicken musste, weil ich so verliebt in den Text war:
âIts universality: its democratic equality and constancy to its nature in seeking its own level: its vastness in the ocean of Mercator’s projection: its umplumbed profundity in the Sundam trench of the Pacific exceeding 8,000 fathoms: the restlessness of its waves and surface particles visiting in turn all points of its seaboard: the independence of its units: the variability of states of sea: its hydrostatic quiescence in calm: its hydrokinetic turgidity in neap and spring tides: its subsidence after devastation: its sterility in the circumpolar icecaps, arctic and antarctic: its climatic and commercial significance: its preponderance of 3 to 1 over the dry land of the globe: its indisputable hegemony extending in square leagues over all the region below the subequatorial tropic of Capricorn: the multisecular stability of its primeval basin: its luteofulvous bed: Its capacity to dissolve and hold in solution all soluble substances including billions of tons of the most precious metals: its slow erosions of peninsulas and downwardtending promontories: its alluvial deposits: its weight and volume and density: its imperturbability in lagoons and highland tarns: its gradation of colours in the torrid and temperate and frigid zones: its vehicular ramifications in continental lakecontained streams and confluent oceanflowing rivers with their tributaries and transoceanic currents: gulfstream, north and south equatorial courses: its violence in seaquakes, waterspouts, artesian wells, eruptions, torrents, eddies, freshets, spates, groundswells, watersheds, waterpartings, geysers, cataracts, whirlpools, maelstroms, inundations, deluges, cloudbursts: its vast circumterrestrial ahorizontal curve: its secrecy in springs, and latent humidity, revealed by rhabdomantic or hygrometric instruments and exemplified by the hole in the wall at Ashtown gate, saturation of air, distillation of dew: the simplicity of its composition, two constituent parts of hydrogen with one constituent part of oxygen: its healing virtues: its buoyancy in the waters of the Dead Sea: its persevering penetrativeness in runnels, gullies, inadequate dams, leaks on shipboard: its properties for cleansing, quenching thirst and fire, nourishing vegetation: its infallibility as paradigm and paragon: its metamorphoses as vapour, mist, cloud, rain, sleet, snow, hail: its strength in rigid hydrants: its variety of forms in loughs and bays and gulfs and bights and guts and lagoons and atolls and archipelagos and sounds and fjords and minches and tidal estuaries and arms of sea: its solidity in glaciers, icebergs, icefloes: its docility in working hydraulic millwheels, turbines, dynamos, electric power stations, bleachworks, tanneries, scutchmills: its utility in canals, rivers, if navigable, floating and graving docks: its potentiality derivable from harnessed tides or watercourses falling from level to level: its submarine fauna and flora (anacoustic, photophobe) numerically, if not literally, the inhabitants of the globe: its ubiquity as constituting 90% of the human body: the noxiousness of its effluvia in lacustrine marshes, pestilential fens, faded flowerwater, stagnant pools in the waning moon.â
(Zeilen 185â228, Gabler-Edition)
HACH! He, Wallace, THIS is water.
Zwischendurch war ich wie immer im Buch verzÞckt von schÃķnen Formulierungen, die bei lÃĪngerem Nachdenken keinen Sinn ergeben, aber schÃķn klingen (âwith winedark hairâ, Zeile 785) oder die schÃķn klingen und viel zu viel Sinn ergeben wie âthe ecstasy of catastropheâ, Zeile 786, oder:
âWhat events might nullify these calculations? [die Altersberechnung von Stephen und Bloom]
The cessation of existence of both or either, the inauguration of a new era or calendar, the annihilation of the world and consequent extermination of the human species, inevitable but impredictable.â (462â465)
oder
âAlone, what did Bloom feel?
The cold of interstellar space, thousands of degrees below freezing point or the absolute zero of Fahrenheit, Centigrade or RÃĐaumur: the incipient intimations of proximate dawn.â (1242â1244)
[…]
Jetzt muss ich aber los, Penelope wartet.
—
Penelope las ich vorgestern und gestern durch und damit den Rest des Buchs. 644 Seiten in gut fÞnf Monaten ist vermutlich nicht irre schnell, aber man kann Ulysses anscheinend auch mit grÃķÃeren Pausen darin lesen. Vielleicht sind sie sogar nÃķtig.
Mir ist beim nachtrÃĪglichen Sammeln der BlogeintrÃĪge einiges aufgefallen. Zum Beispiel, dass ich bereits relativ frÞh aufgehÃķrt habe, die FuÃnoten zu lesen, die in meiner Oxford-Ausgabe drin sind und die ich anfangs parallel zur Gabler-Edition las. Ich merkte aber schnell, dass ich gar nicht jedes fremdsprachige Wort und jede Anspielung verstehen musste, um das Buch zu genieÃen. Genauso ging es mir mit der SekundÃĪrliteratur. WÃĪhrend ich anfangs nach jedem Kapitel im Bloomsday Book nachlas, ob ich das eben Gelesene auch richtig verstanden hatte, merkte ich hier ungefÃĪhr in der Mitte des Buchs, dass es vÃķllig egal ist, ob man irgendwas versteht.
Das war vermutlich fÞr mich das grÃķÃte Aha-Erlebnis dieses Werks: Es geht gar nicht darum, es zu verstehen. Genauso wenig wie man abstrakte Kunst verstehen muss oder zeitgenÃķssische Musik. Man kann natÞrlich die viele Literatur zum Ulysses nebenbei lesen, man kann versuchen, das Gilbert-Schema wiederzufinden (ich habe das komplett ignoriert), man kann sich an jedes Wort und jede Szene klammern. Man kann sich aber auch einfach dem Roman Þberlassen und die vÃķllige Distanzlosigkeit zwischen Verfasser und Leserin erleben.
Meiner Meinung nach geht es schlicht darum, die SchÃķnheit und Vielfalt der englischen Sprache zu wÞrdigen, zu genieÃen, sie zu bewundern oder sich auch von ihren MÃķglichkeiten einschÞchtern zu lassen. Jedes Kapitel ist in einem anderen Stil verfasst, weswegen sich das Buch auch nach 500 Seiten noch so anfÞhlt, als hÃĪtte man gerade erst damit angefangen. Manche Kapitel gefielen mir besser, andere las ich eher pflichtschuldig durch, aber bei denen, die ich mit Begeisterung las, ging es mir wie bei Proust: Mir war bewusst, dass ich etwas AuÃergewÃķhnliches lese. Warum, ist egal. Ob ich alles kapiere, auch egal. Ich darf an etwas teilnehmen, was vielleicht nicht jeder vergÃķnnt ist. Ich hatte die Zeit und die MuÃe und, ja vielleicht auch die innere Einstellung, mich in dieses Buch und seine Kapriolen fallen zu lassen.
Zu dieser Einstellung schrieb F. vor ein paar Tagen etwas sehr Gutes, das ich mal zusammenfasse:
âSeit dem Lachenmann-Konzert am Freitag habe ich Þber etwas nachgedacht. Der Herr neben mir zog wÃĪhrend des SchluÃapplauses mit seiner Frau empÃķrt von dannen und konstatierte, es sei eine Zumutung gewesen. Abgesehen von der Frage, warum er Þberhaupt da war (vermutlich Ehrenkarte). / Ich bin zu dem Schluà gekommen, daà jegliche Infragestellung unserer kulturellen Gewohnheiten (sei es Musik, Theater oder bildende Kunst) zunÃĪchst eine Zumutung ist, dann aber zur Herausforderung wird, die wiederum Erkenntnis gebiert, was dann am Ende unseren Horizont erweitert. / Ich bin froh, fÞr mich selber an dem Punkt angekommen zu sein, dass ich es gleich als Herausforderung empfinde, in meinen Seh- oder HÃķrgewohnheiten angegriffen zu werden. Und daà dann in gewisser RegelmÃĪÃigkeit auch Erkenntnis folgt. / GlÞcklich kann sich schÃĪtzen, wer in einem oder mehrerer dieser Bereiche so bewandert ist, dass er sowohl Zumutung als auch Herausforderung Þberspringen kann, und gleich zum Erkenntnisgewinn kommt.â
ZunÃĪchst schrieb ich nach dieser Tweetkette diese SÃĪtze in den Blogeintrag: âSo bewandert bin ich literarisch nicht, dass der Ulysses fÞr mich eine Erkenntnis bereitgehalten hat â auÃer dass ich jetzt noch mehr Joyce lesen mÃķchte, hey!â Ein paar Stunden spÃĪter fiel mir aber auf, dass ich eine irre groÃe Erkenntnis gewinnen konnte, die mir aber nicht sofort eingefallen war, weil sie mit meinem Handwerk und meiner EinschÃĪtzung meiner eigenen FÃĪhigkeiten zu tun hat, die ich beide gerne abtue, was sehr doof ist. Also, Erkenntnis, Achtung: was Sprache alles kann. Was sie kann, wenn man sie lÃĪsst bzw. wenn man jemanden hat, der*die weiÃ, wie er*sie mit ihr arbeitet. Und was man selber kann, wenn man sich lÃĪsst und nicht dauernd hinterfragt, ob das jetzt Sinn ergibt oder was nÞtzt. (!) Erkenntnisausrufezeichen! Bloom gilt als der Allerweltsmann, und wir lesen lauter Allerweltsdinge in einer Allerweltsstadt. Genau deshalb, denke ich, kann der Ulysses auch jede Leserin zu einer anderen Erkenntnis bringen, denn jeder Alltag ist anders. Dein Leben ist anders als meins, und deswegen liest du dieses Buch auch anders.
Nochmal zurÞck zur Tweetkette: Ja, Ulysses war mehrere AnlÃĪufe lang eine Zumutung, der ich mich nicht aussetzen wollte. In diesem Jahr aber ist es anscheinend zu einer Herausforderung geworden, ohne dass ich es darauf angelegt hÃĪtte. Wie bei Proust denke ich, dass die Zeit â bzw. ich â einfach dafÞr reif war, mich von diesem Werk mitnehmen zu lassen und mich ihm vÃķllig auszuliefern.
Ich las mal irgendwo, dass man Ulysses mindestens dreimal liest: das erste Mal, um einfach zu gucken, warum alle so eine Angst vor diesem Buch haben â ist das wirklich so schlimm und unverstÃĪndlich und anstrengend? (Nein, oft, selten.) Dann das zweite Mal, wo man schon weiÃ, worum es geht, man kennt die Orte und Personen â jetzt kann man sich den tausend FuÃnoten und Anmerkungen hingeben, um das Buch vielleicht doch zu entschlÞsseln, wenn man es denn darauf anlegt. Und das dritte Mal liest man zum SpaÃ: Das Buch hat keine Geheimnisse mehr â aber jetzt ist man gewappnet fÞr alle Ebenen, die man bei den ersten beiden AnlÃĪufen noch nicht mitbekommen hat und die man jetzt ganz individuell fÞr sich aufdrÃķselt. Dazu zitiere ich noch mal Fritz Senn:
âNatÞrlich verdient der Ulysses die ganze intellektuelle Belastung durchaus. Der Roman ist noch lange nicht ausgebeutet: Da ist noch viel zu entdecken. Das Buch eignet sich vorzÞglich fÞr gelehrte und geistesgeschichtliche Untersuchungen, ob deren Ergebnisse nun pedantisch, abseitig, lehrreich, abstrakt oder wegweisend sind. Was alles wir Þber den Ulysses schon gehÃķrt haben, trifft meistens auch zu; aber noch viel mehr stimmt das, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist und worauf vielleicht, wer weiÃ, gerade wir bei der unvoreingenommenen LektÞre, wenn’s die gÃĪbe, zuerst stoÃen. Trotz der vielen Wegweiser, die hilfreich in alle Richtungen zeigen, weist die Landkarte noch ein paar weiÃe Flecke auf.â
(Fritz Senn: âLese-Abenteuer âUlyssesââ, in: Franz Cavigelli (Hrsg.)/Ders.: Nichts gegen Joyce. AufsÃĪtze 1959â1983, ZÞrich 1983, S. 32â47, hier S. 32.)
Anders ausgedrÞckt: Ulysses ist, was du daraus machst.
Take the short cut. Read the book.
—
âAlles klapptâ (UrauffÞhrung), 6. Juni 2018
F. und ich hatten bei einem Konzertbesuch festgestellt, dass wir Ãķfter zeitgenÃķssische Musik hÃķren mÃķchten. Daher schauten wir schon vor lÃĪngerer Zeit ins Biennale-Programm und entschieden uns fÞr eine UrauffÞhrung eines kurzen MusiktheaterstÞcks von OndÅej AdÃĄmek, âAlles klapptâ, im Marstall des Residenztheaters. Der AnkÞndigungstext sprach von Archivalien, die durch die Archivar*innen plÃķtzlich zu sprechen beginnen, wenn ich mich richtig erinnere (ich finde ihn nicht mehr online), aber um welche ArchivstÞcke aus welcher Zeit es sich handelte, stand dort meiner Meinung nach nicht.
Das erfuhren wir erst Mittwochabend vor Ort aus dem Programm und mir wurde ein bisschen mulmig: Der Komponist verarbeitete unter anderem StÞcke aus seinem Familiennachlass, genauer gesagt, Postkarten aus Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau. Dem Programm beigelegt waren eine undatierte Karte aus Theresienstadt und zwei aus Auschwitz, letztere von Januar und April 1944, auf denen eine Mutter an ihren Sohn in Prag schrieb. Auf diesen befindet sich auch der Stempel mit dem Hinweis, dass eine âRÞckantwort nur auf Postkarten in deutscher Sprache Þber die Reichsvereinigung der Juden in Deutschlandâ zu geschehen habe. Eine Karte ist erkennbar in Charlottenburg abgestempelt worden, bei der anderen fehlen Briefmarke und Stempel.
Das StÞck begann damit, dass der Komponist und Dirigent mit einem Metalldetektor den BÞhnenboden absuchte, aber nichts fand. Danach traten nacheinander sechs SÃĪnger*innen und zwei Percussionist*innen auf; einige schoben hÃķlzerne Kisten, andere Schlaginstrumente, die nach und nach von den Musiker*innen bearbeitet wurden. Der Sprechgesang der sechs begann mit â ich hoffe, ich erinnere mich halbwegs korrekt â Beschreibungen von Werterhaltung und Wertzuwachs. Es wurden MÃķbelstÞcke und ihre Anzahl aufgezÃĪhlt, wobei der Sprechgesang stets rhythmisch blieb. Mir fiel erst nach gefÞhlt zehn Minuten auf, dass der Rhythmus mich an Eisenbahnen und ihr Rollen Þber Schwellen erinnerte. Es wurde von Menschen auf Transporten gesprochen, immer mehr Instrumente kamen auf die BÞhne, Text und BÞhnengestaltung ergÃĪnzten sich hier sehr intuitiv. Es wurde voller und enger auf der SpielflÃĪche und die gesprochen-gesungenen Zahlen immer hÃķher.
Die sechs Archivar*innen nahmen GegenstÃĪnde aus den Holzkisten und wickelten sie in durchsichtige Folie ein, wÃĪhrend im Hintergrund Luftpumpen, BlasebÃĪlge und eine SprÞhdose bearbeitet wurden, mit der man per Druckluft Computerkeyboards reinigen kann. FÞr mich waren das alles Anspielungen darauf, dass viele der Menschen auf den Transporten keine Luft bekamen â und ein Hinweis auf ihr gewaltsames Ersticken in den Gaskammern.
Die Nennung von MÃķbelstÞcken und Orten, aus denen sie kamen, erinnerte mich an die Listen, die ich aus Auktionskatalogen kannte, wo eben nicht nur Bilder und WertgegenstÃĪnde der deportierten oder vertriebenen Menschen versteigert wurden, sondern auch Tische, StÞhle, Blumenvasen und Kleidung. Die GegenstÃĪnde, die unter anderem aus den Kisten geholt wurden, waren einmal, wenn ich das richtig erkannt habe, ein Radio (das jÞdische BÞrger*innen seit 1939 nicht mehr besitzen durften) und ein Koffer (bei dem ich sofort die Sammlung von Koffern in Auschwitz vor Augen hatte).
Dann trat aber eine Archivarin an eine Kiste und holte eine Brille hervor (auch bei ihr musste ich an die Sammlung in Auschwitz denken). Sie packte sie allerdings nicht in Folie ein, sondern setzte sie auf â und die Besitzerin der Brille sang nun durch sie. Sie sang sinngemÃĪà oder teilweise wortwÃķrtlich die Texte, die wir vorher auf den Postkarten schon hatten lesen kÃķnnen: âWir sind alle gesund. Seid ihr? Alle danken wir herzlichst fÞr die Postpakete, kamen in Ordnung an. […] DÞrfen nur selten schreiben, seid daher unbesorgt, wenn wenig Berichte. Haben uns gut eingewÃķhnt. Wohne in groÃem Zimmer gemeinschaftlich. In Gedanken stets bei euch. Wir sehen einander tÃĪglich in freier Zeit, arbeiten fleiÃig.â (undatierte Karte aus Theresienstadt)
Ein anderer Archivar nahm nun ein GemÃĪlde aus einer Kiste und sang auf tschechisch. Es gab deutsche und englische Ãbertitel, fÞr die ich recht dankbar war, denn der Klang setzte sich aus Percussion und mehrstimmigem Gesang, der meist eher eine gerÃĪuschvolle Wortproduktion war, zusammen. F. meinte nach dem StÞck, er habe sehr auf die Percussionist*innen geachtet, wÃĪhrend ich die irgendwann vÃķllig vergaÃ, weil ich so mit den Worten beschÃĪftigt war. Ich versuchte bei jedem Satz zu ergrÞnden, woher er wohl stammte: von einem Reichsgesetzblatt oder der letzten Postkarte, die ein HÃĪftling aus einem Konzentrationslager schrieb? Das war alles andere als ein entspannter Theaterabend, aber ich war gleichzeitig fasziniert, verstÃķrt, begeistert und traurig und klatschte danach auch sehr lange.
Aber soweit waren wir noch nicht. Nach dem GemÃĪlde, bei dem ich wirklich kurz davor war zu heulen, weil es so nah an dem ist, was ich tagtÃĪglich mache und bei dem ich immer noch hadere, ob ich meine Kraft nicht lieber fÞr Provenienzforschung einsetzten sollte anstatt einem anscheinend eher unbedeutenden, systemkonformen Maler der NS-Zeit nachzuspÞren, kamen GegenstÃĪnde, Þber die ich erst nachdenken musste. Eine Archivarin entnahm der Kiste eine Pflanze, ein Archivar eine Peitsche. Bei der Pflanze dachte ich mir, dass sie vielleicht auf den Stellen wÃĪchst, an denen frÞher Lagerbaracken standen, bei der Peitsche dachte ich daran, dass viele HÃĪftlinge gezwungen wurden, sich gegen ihre MithÃĪftlinge zu stellen. Die vorletzte Archivarin nahm eine groÃe Flasche KÃķlnisch Wasser und Þbergoss sich damit, was ich einerseits mit Reinwaschen und andererseits mit Erinnerungen wegwaschen verband â und was den Weg ebnete fÞr den letzten Archivar.
Dieser trug einen grauen Anzug, dessen Jackett er ablegte, bevor er die letzte Kiste Ãķffnete. In ihr befand sich schwere, schwarze Erde, die er nun mÞhevoll mit beiden HÃĪnden und ausgebreiteten Armen auf dem BÞhnenboden verteilte. Dann nahm er seinen Kolleg*innen ihre jeweiligen GegenstÃĪnde ab und vergrub sie, wÃĪhrend alle weiterhin Postkartentexte, Vorschriften oder SÃĪtze Þber Werterhalt und Besitz sprachsangen. FÞr mich war das Ablegen des Jacketts ein Bezug auf die vielen Deutschen, die nach 1945 ihre Uniformen vergruben oder verbrannten, die Orden vernichteten und ihre IdentitÃĪt neu aufstellten â oder auf SchreibtischtÃĪter wie Eichmann in grauen AnzÞgen, die sich eben nicht die HÃĪnde schmutzig machten, aber natÞrlich genau die gleiche Verantwortung trugen.
SchlieÃlich war alles vergraben, der Archivar verdreckt und verschwitzt, die anderen sangen âSchreibt baldâ, wobei aus dem ersten Wortteil ein lautes SCHREI- wurde, bevor daran noch ein leistes -bt gesetzt wurde. Die Percussion wurde immer lauter und lauter â und dann war es still. Ich dachte noch, nee, das ist ein doofes Ende, als ein neuer Sprechgesang begann. Den Text konnte ich zunÃĪchst nicht zuordnen, er ging ungefÃĪhr so: âIch vermisse meine GegenstÃĪnde. Ich wollte nur ein stilles Leben mit meinen GegenstÃĪnden.â Und ich dachte, das ist ja ein noch blÃķderes Ende, wieso reden wir jetzt Þber Dinge, wo wir eben so zutiefst menschliche Texte gehÃķrt hatten? Bis mir auffiel, dass eben diese Dinge das einzige sind, was noch von ihren Besitzer*innen Þbrig ist. Ein Koffer. Ein Bild. Eine Brille. Und wir Historiker*innen suchen mit Metalldetektoren oder Archivfindmitteln nach diesen Dingen und nach irgendjemandem, dem wir Schmuck oder Bilder oder BÞcher in die Hand drÞcken kÃķnnen, als ob damit irgendwas wieder gut werden wÞrde.
Gestern, nachdem ich alles ein bisschen hatte sacken lassen kÃķnnen, gab ich den Namen der Absenderin der Postkarten in die Datenbank fÞr die Opfer der Shoah in Yad Vashem ein. Ich hatte sinnloserweise die winzige Hoffnung, dass die Schreiberin den Holocaust Þberlebt haben kÃķnnte. Hat sie nicht. Malvine Pokorny, geboren am 3. Mai 1873, wurde am 15. Dezember 1943 von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert, wo sie zu einem unbekannten Zeitpunkt verstarb. Ihre Postkarte vom 15. April 1944 an ihren Sohn Alfred lautete:
âGeliebter Sohn,
bin gesund. Karte 26.1. 16.3 erhalten, sehr erfreut. Alles in bester Ordnung nach meiner [?] und Eurerem Wunsche. Innigste GrÞÃe allerseits. In grÃķÃter Dankschuld und Liebe
Mutter.â
—
Das StÞck ist heute und morgen noch im Marstall um 20 Uhr zu sehen, am Sonntag um 17 Uhr. Am 14. Juli wird die AuffÞhrung, die wir gesehen haben und die aufgezeichnet wurde, bei BR Klassik um 20.05 Uhr zu sehen hÃķren sein. Ich werde euch definitiv daran erinnern.
—
Was schÃķn war, Mittwoch, 6. Juni 2018 â Rakel
Mittwoch ist EichhÃķrnchenvorlesungstag. In der letzten Sitzung, die ich zu faul war zu verbloggen, sprachen wir Þber die âHandschriftâ von KÞnstler*innen â also ihre visuellen Eigenarten, der bestimmte Pinselstrich oder ÃĪhnliches; van Gogh drÃĪngt sich hier geradezu als Beispiel auf. Jahrhundertelang war eben diese Handschrift vernachlÃĪssigt worden â ich schrieb bereits darÞber, dass das geistige Konzept hinter einem Werk als wichtiger angesehen wurde als dessen AusfÞhrung. In der Akademiemalerei im Frankreich des 19. Jahrhunderts erreichte diese Idee seinen HÃķhepunkt, indem per Blaireautage, der Nachbearbeitung mit dem Dachshaarpinsel, jede vorherige Pinselschraffur geglÃĪttet oder ganz getilgt wurde, so dass keine Spur mehr davon zu sehen war, dass dieses Kunst-Werk ein Hand-Werk war.
Interessanterweise sorgte auch die Fotografie dafÞr, dass diese Haltung Þberdacht wurde. 1856 fotografierte das Studio Mayer & Pierson in Paris den Comte Cavour. 1862 verfremdete ein anderes Fotostudio diese Aufnahme, woraufhin Mayer & Pierson die erste Copyrightklage der Fotografiegeschichte einreichten. (Auf gemalte Werke gab es seit 1793 ein Copyright.) Daraufhin wurde erstmal diskutiert, ob die Fotografie Þberhaupt eine Kunst sei, denn ein Fotograf sei praktisch nur ein operateur einer Maschine. Trotzdem kam man nicht ganz darum herum, sich auch Þber das Konzept, die geistige Idee hinter einem Werk zu unterhalten, die hier offensichtlich kopiert wurde, auch wenn es in diesem Fall noch nicht zu einer Verurteilung wegen Copyrightsbruch reichte.
Wir begannen die letzte Sitzung mit dem Hinweis von Meyer Shapiro, der in den 1960er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, etwas Þberspitzt meinte, Kunst, auch bzw. gerade die abstrakte, sei zutiefst human, denn GemÃĪlde und Skulpturen seien die letzten wirklich handgemachten GegenstÃĪnde der Moderne. Gestern sprachen wir dann Þber Gerhard Richter und seine Rakel, mit der er quasi jede eigene Handschrift negiert und nur (?) sein Werkzeug Spuren hinterlassen lÃĪsst.
Der Dozent verwies hierbei natÞrlich auch auf den Film Gerhard Richter Painting, aus dem wir viele Stills zu sehen bekamen, in dem er, soweit ich mich erinnere, fast dauernd mit der Rakel in der Hand an seinen Bilder vorbeischreitet, sie gerne noch ein bisschen hÃĪngen lÃĪsst und dann wieder an ihnen arbeitet. Ganz eventuell bezieht sich dieser hÞbsche Cartoon von 2013 darauf; der Film kam 2012 in die US-amerikanischen Kinos.
Der Dozent meinte, dass sich die Kunstgeschichte bisher noch nicht mit der Rakel Richters auseinandergesetzt habe und trug uns daher seinen eigenen Katalogbeitrag vor, der demnÃĪchst zu einer Richter-Ausstellung im Museum Barberini erscheinen wird. Den Katalog empfehle ich euch einfach mal, denn das war eine ÃĪuÃerst spannende Sitzung, auch wenn ich Richters SpÃĪtwerk immer noch etwas misstrauisch gegenÞberstehe.
FÞr mich interessant: die Rakel, wie der Duden sie nennt, wird in vielen deutschen Publikationen zu dem Rakel, warum auch immer (hier bitte die Þblichen geistigen Abrisse zu MÃĪnner = Kunst, Frauen = Frauenkunst einfÞgen). Im Englischen wird aus diesem Werkzeug gerne squeegee anstatt wie vorbildlich in der Wikipedia beim Spracheumschalten doctor blade, wobei letzteres ein Werkzeug aus dem Druckverfahren bezeichnet, ersteres aber das Gummiding zum Fensterputzen. Daher finden sich in der englischen Literatur zu Richters Rakelwerken auch gerne Vergleiche zu Seifenspuren wie nach dem Fensterputzen, generell der Hinweis auf LeinwÃĪnde als Fenster zu irgendwas oder eben das Versperren desselben durch Farbe. In der deutschen Literatur fehlen diese Assoziationen vÃķllig. (Hier bitte die Þblichen geistigen Abrisse zu âAber Sprache ist doch egal, die formt unser Denken doch nicht und Frauen sind halt mitgemeintâ einfÞgen.)
Nochmal zur Handschrift: Richter meint selbst zu seinen Rakelwerken, dass er bei ihnen eher etwas entstehen lasse anstatt etwas zu kreieren. Vermutlich ist das genau mein Problem mit den Dingern; anscheinend hÃĪnge ich auch noch an dem ollen Renaissancekonzept, dass die Idee hinter einem Werk wichtig ist, und ich habe Probleme mit Werken, die einfach irgendwie da sind. Obwohl ich sie schon gerne anschaue. Ja, auch die Rakeldinger (hier ein winziger Ausschnitt).
Richter selbst nennt sein Werkzeug Þbrigens Spachtel, jedenfalls in diesem Monsterwerk, indem er sich genau zweimal darauf bezieht, und beide Male sagt er nicht Rakel. Vermutlich bezieht er sich auf Courbet; auch Þber ihn und seine Palettmesser schrieb ich bereits. Zwei seiner Bilder rekurrieren sogar bewusst auf diesen Maler.
Dann ging es um August Strindberg, von dem ich bisher nicht wusste, dass er auch gemalt hatte. Hat er aber, und angeblich stammt von ihm die Idee der Farbresteverwertung auf Paletten (ich hoffe, ich habe mir das richtig notiert). In der Sitzung Þber Paletten hatten wir bereits erfahren, dass einige Maler*innen aus den Farbresten auf der Palette noch ein Bild schufen â eben auf der Palette. Strindberg nutzte diese Reste aber nun und malte aus ihnen ein neues Bild; er zwang sich selbst quasi dazu, aus einer vorgegebenen Farbauswahl ein Motiv zu schaffen. Richter machte mit seinen Rakelbildern etwas ÃĪhnliches: Nachdem ein Bild fertig war, streifte er die noch farbige Rakel auf bereitliegenden, meist belanglosen Urlaubsfotos ab (Beispiel âFirenzeâ). Keine Ahnung, ob das ein bewusster Bezug ist oder ein simpler Zufall, aber sowas mag ich. (Dass Richter sich fast von Anfang an mit Fotografie und ihre Verwendung in der Malerei interessierte, dÞrfte Dauerleser*innen dieses Blogs bekannt sein; in meiner MA-Arbeit bezog ich mich auf frÞhe GemÃĪlde, fÞr die er per Episkop Fotos auf die Leinwand projizierte und sie nachmalte. Mein Þbliches Beispiel: Onkel Rudi.)
Wir sprachen auch Þber andere BezÞge von KÞnstlern auf KÞnstler. Richters Rakel waren auch hierfÞr der Ausgangspunkt, denn der Fotograf Timo Schmidt baut sie nach und fotografiert sie. Ein anderes Werk in diese Richtung wÃĪre Rauschenbergs Erased de Kooning: HierfÞr hatte Rauschenberg de Kooning um ein Bild gebeten, das er ausradieren wollte. Nach anfÃĪnglichem ZÃķgern Þberlieà de Kooning Rauschenberg ernsthaft ein Bild, das dieser, wie angekÞndigt, ausradierte. Ãber 50 Jahre spÃĪter schuf J. Newton das Werk Not Rauschenberg’s Eraser, eine Plastikbox mit Radiergummis darin.
Richter verarbeitete Palettenreste noch anders. FÞr seine Serie Ausschnitt fotografierte er winzige Details seiner farbbeschmierten Palette und malte diese Fotos dann Þbergroà nach. Ein Ausschnitt-Bild trÃĪgt den Zusatz Makart. Es bezieht sich auf den Maler Hans Makart, der ebenfalls gerne auf seinen Paletten malte. Der Dozent erzÃĪhlte die Geschichte von Makarts riesigem Schinken (seine Worte) âDer Einzug Karls V. in Antwerpenâ, das ich aus der Hamburger Kunsthalle kenne. Das Ding kostete damals so viel wie ein Viertel des gerade neu errichteten GebÃĪudes â oder wie der Dozent es ausdrÞckte: so viel, wie heute ein Richter kostet. Angeblich erhoffte sich die Kunsthalle von dem damals sehr angesagten Maler einen ÃĪhnlichen Coup wie der Louvre mit seiner Mona Lisa, die schon damals die Massen anzog. Dummerweise war Makart recht schnell den meisten Leuten egal â so wie Þbrigens heute auch der Kunsthalle. Das Bild ist zu groÃ, um es umzuhÃĪngen, weshalb es seit dem Umbau vor kurzer Zeit nun fieserweise fÞr die Besucher*innen unsichtbar hinter einer eigens errichteten Gipswand hÃĪngt. Von mir aus kÃķnnte die Neue Pinakothek das mit den ganzen Pilotys auch so machen. Wobei ich Makarts Falknerin dort gerne anschaue. Und ich vermisse ein bisschen den groÃformatigen Richter am Aufgang der Pinakothek der Moderne. Wo hÃĪngt der eigentlich gerade?
—
Was schÃķn war, Montag/Dienstag, 28./29. Mai 2018 â Ein, zwei gute Tassen Tee. Oder sechsundzwanzig
Nachdem ich bei Dallmayr schon mal Kaffee bzw. Espresso kosten durfte, kam jetzt Tee dran. Dieses Mal war ich gewarnt: nicht alles trinken, was man dir hinstellt, sonst hÃķrst du dein Herz wieder so laut schlagen! Aber dazu kam ich gar nicht. Auch wenn ich sofort zugegriffen hÃĪtte, so hÞbsch sahen die 26 Sorten aus, die da akkurat aufgebaut waren. Das sind Þbrigens lÃĪngst nicht alle Teesorten, die das Haus vertreibt; momentan sind es ungefÃĪhr 120.


Im oberen Bild stehen ein weiÃer Tee, ein paar GrÞntees und dann folgen die Schwarztees. Auf der anderen Seite des Tisches standen zunÃĪchst einige aromatisierte Schwarztees (wie Jasmintee, Earl Grey oder Chai) und dann GetrÃĪnke, die im strengen Sinn kein Tee mehr sind, weil sie nicht vom Teestrauch stammen, sondern stattdessen AufgÞsse aus getrockneten Pflanzenteilen sind (Rooibos, KrÃĪutertee, FrÞchtetee).
Der Leiter der Tee-Abteilung erklÃĪrte mir zunÃĪchst, wie und wo Teeanbau und Verarbeitung stattfindet. Was mich Þberraschte: Nicht China oder Indien sind die weltweit grÃķÃten Exporteure, sondern Kenia. In China und Indien wird zwar mit weitem Abstand am meisten angebaut, aber eben auch das meiste bereits im Land getrunken. Die meisten der 10 Milliarden (kein Tippfehler) Tassen Tee, die tÃĪglich (auch kein Tippfehler) getrunken werden, werden in diesen beiden LÃĪndern aufgebrÞht. In Deutschland sind Þbrigens die Ostfriesen ganz weit vorne im Verbrauch. Das war zu erwarten, aber den Abstand fand ich dann doch beeindruckend: 300 Liter Schwarztee pro Jahr im Vergleich zu lausigen 29 (plus 35 Liter KrÃĪuter- und FrÞchtetee) im Rest der Republik . Ostfriesland sÞppelt sogar mehr weg als England, das sich mit 205 Litern pro Jahr noch ein bisschen lang machen muss.
Ich erfuhr auÃerdem, wie genau aus den jungen Trieben eines Teebusches die lustigen Kringel werden, die in meiner Teepackung landen. GepflÞckt werden am besten two leaves and a bud, also der oberste Trieb des Busches, der aus zwei BlÃĪttern herauswÃĪchst. In losem Tee kann man die Triebe mit bloÃem Auge von den schmalen BlÃĪttern unterscheiden; sie sehen aus wie eingerollte BlÃĪtter und sind manchmal heller. Nach dem PflÞcken dauert es nur wenige Tage, bis die nÃĪchsten Triebe nachgewachsen sind, die dann wiederum gepflÞckt werden. In Indien und China ist das PflÞcken Frauenarbeit, wÃĪhrend die Verarbeitung von MÃĪnnern erledigt wird, in Kenia geschieht es genau andersherum.
Nach dem PflÞcken werden die BlÃĪtter und Triebe sofort verarbeitet. ZunÃĪchst werden sie gewelkt, das heiÃt, sie liegen auf langen Sieben, durch die kalte Luft geleitet wird. Dadurch verlieren die BlÃĪtter und Triebe circa 30 Prozent ihrer natÞrlichen Feuchtigkeit. Danach folgt das Rollen, bei dem sie quasi zwischen zwei sich bewegenden Scheiben grob zerrieben werden. Der austretenden Zellsaft reagiert mit dem Sauerstoff â jetzt beginnt die Fermentation, die fÞr die charakteristischen Aromen von Darjeeling, Assam oder anderen Sorten sorgt. WÃĪhrend der Fermentation verÃĪndert sich auch die Farbe der TeeblÃĪtter von grÞn zu rot, braun, kupferfarben etc. Ein Trockenvorgang stoppt die Oxidation. Danach laufen die BlÃĪtter Þber eine Art FÃķrderband, die sie nach GrÃķÃen aussiebt. Die grÃķÃten BlÃĪtter und Triebe landen in den Lose-Blatt-Teepackungen, die kleineren eher in Tassenportionen wie Beutel. Ich musste mich hier von einem meiner Vorurteile Þber Tee verabschieden: Ich dachte bisher immer, in den Beuteln lande irgendwie weniger guter Tee als in den Packungen mit den losen BlÃĪttern. Jetzt weià ich: Es stammt alles aus der gleichen Produktion, ist halt nur kleiner.

Jetzt wollte ich aber endlich was trinken. Teeverkostungen sind genormt, das heiÃt, die Menge von Tee und Wasser wird weltweit gleich eingesetzt. Abgewogen wird hier stilecht mit einer Waage, die genau 2,86 Gramm Tee abwiegt, das Gewicht einer alten englischen Sixpence-MÞnze. Danach wird das kleine TassenkÃĪnnchen mit 150 Milliliter Wasser gefÞllt, und der Tee zieht genau fÞnf Minuten. Das KÃĪnnchen wird umgedreht, damit der Tee in die Schale laufen kann. Das sieht dann in Reihung sehr putzig aus, und jetzt weià ich auch, wofÞr die Dinger Zacken haben.



Die Schalen stehen da Þbrigens nicht nur, weil sie hÞbscher aussehen als Tassen. Generell gilt fÞr Tee: je dÞnnwandiger das Porzellan oder das Glas, desto besser. Kanne vorwÃĪrmen, kennen wir alle, den Tee am besten lose schwimmen lassen, damit er Platz hat (Teeeier sind bÃķse!), und dann mÃķglichst in eine Thermoskanne umfÞllen, damit das ebenso bÃķse StÃķvchen nicht zum Einsatz kommt. Ich gebe zu, ich benutze das Ding bei Assamtees, aber ich glaube, da ist es okay. Darjeeling verbrennt man damit allerdings ganz prima.

Diese Farben! Das kriegt Kaffee nicht hin, der braune Langweiler.

Weiter mit der Verkostung. Nach dem AusgieÃen des Tees landen die BlÃĪtter auf dem Deckel des KÃĪnnchens, denn hier bekommt man schon den ersten Eindruck. Man prÞft das Aussehen, aber vor allem den Duft. Ich zuckte sehr bei einem Sencha zurÞck, dessen Geruch ich in Richtung FleischbrÞhe verortete, bis der Teeexperte meinte: âSpinat.â Genau. Spinat. Muss ich nicht morgens zum MÞsli haben, stelle ich mir aber zu Spiegeleiern super vor. Generell ist Tee ein guter Essensbegleiter, man sollte nur die richtige Sorte wÃĪhlen. In chinesischen Restaurants zum Essen parfÞmierten Jasmintee zu bestellen, ist eher eine blÃķde Idee, und wenn ich mich richtig erinnere, trinkt man in China eh keinen Tee zum Essen, sondern davor und danach. Bestimmt top zum Schinkenbrot: der Lapsang Souchong, ein gerÃĪucherter Tee, der mich daran erinnerte, dass ich auch keine rauchigen Whiskys mag.
Genug an den BlÃĪttern gerochen, jetzt wurde Tee getrunken. Beziehungsweise nicht, denn bei einer Teeverkostung trinkt man nicht, sondern schlÞrft wie irre und benimmt sich wie auf einer Weinprobe, bei der man alles wieder ausspuckt.
Man nimmt mit einem groÃen, flachen LÃķffel Tee aus der Schale und schlÞrft, als ob er zu heià wÃĪre (ist er nicht). Dann zieht man wie beim Weintrinken Luft in den Mundraum, um die Aromen besser schmecken zu kÃķnnen, und schon spuckt man das schÃķne Zeug wieder aus. Bei den ersten Tees habe ich das sehr bedauert, beim sechsundzwanzigsten wusste ich, warum man nichts trinkt; ich blubberte auch so schon vor mich hin. Tee enthÃĪlt Þbrigens mehr Koffein als Kaffee, gibt es aber nicht so brachial ab wie letzterer. Bei Tee ist das Koffein an die Gerbstoffe gebunden; es lÃķst sich erst im Magen und hÃĪlt dann den Koffeinspiegel Þber Stunden konstant, wÃĪhrend Kaffee eher der schnelle Fix fÞr eine gute halbe Stunde ist. Seitdem ich das weiÃ, Þberlege ich, ob der klassische FÞnf-Uhr-Tee so eine clevere Idee ist. Ich schiebe den Brexit jetzt auf sehr unausgeschlafene und dementsprechend schlecht gelaunte Briten.
Ich fand es sehr spannend, die verschiedenen Aromen zu riechen und zu schmecken: die edle, florale Note im Darjeeling, der ganz milde Heuduft im GrÞntee, die Zitrusnote im Ceylon, das Karamell im Rooibos. Oder eben auch nicht: Die Aromen verstecken sich gefÞhlt mehr als die im Wein, aber es kann sein, dass ich mich auf sie einfach schon lÃĪnger konzentriere.
Ich trinke Tee gerne beim Arbeiten und Studieren und beschrÃĪnkte mich bisher auf Assam als Ostfriesenteemischung (mit Milch), Darjeeling (pur) und Earl Grey (meistens pur, manchmal mit Milch). Vorgestern entdeckte ich den zarten Nilgiri-Schwarztee fÞr mich und trank den ersten Chai, der nicht fies nach Zimt und Nelken im Rachen brennt. Ich mochte selbst den fiesen Jasmintee, der eigentlich alles erschlÃĪgt, und war Þberrascht von einem sehr frischen KrÃĪutertee. Netterweise bekam ich eine TÞte Teepackungen mit und kann jetzt zuhause weiterÞben.
—
Am Dienstag trank ich dann auch allen Ernstes Tee zum FrÞhstÞck anstatt Cappuccino. Und dann Þber den Tag verteilt noch weitere fÞnf Tassen. Ostfriesland, nimm dich in Acht!
—
Was schÃķn war, Sonntag bis Mittwoch, 20. bis 23. Mai 2018 â Wennebostel, Hannover, Halle, MÞnchen
Sonntag: Wennebostel
Am Sonntag feierte mein Papa seinen 80. Geburtstag. Er hatte dazu die Þbliche Rotte an Verwandtschaft und Bekanntschaft eingeladen; der Landgasthof, in dem meine Familie quasi alles feiert von Hochzeiten bis zu Goldenen Hochzeiten, tischte wie immer bergeweise rustikale KÃķstlichkeiten auf, und wir lieÃen es uns von 11 Uhr morgens bis kurz vor 19 Uhr abends rundum gutgehen. Mich persÃķnlich interessierte natÞrlich die Welfenspeise am meisten, mein allerliebster Nachtisch, von dem nie etwas Þbrigbleibt, was ich jedesmal anprangere. Ansonsten griff ich zum Huhn statt zum Wildschwein, genoss fiese Fertigkroketten, die ich genau deshalb nie kaufe, weil sie fies und fertig sind, aber auf einem Buffet findet ich sie super, nachmittags schmeckte eine Mascarpone-Himbeer-Torte ganz ausgezeichnet, und ich alleine vernichtete vermutlich ein bis zwei Flaschen herrlichen Kerner. Was man halt so in LandgasthÃķfen macht.
Mir gefiel auch der gebuchte Alleinunterhalter gut. Ich wÞrde den Mann nie anheuern, weil er schlicht nicht zu meiner Altersklasse passt, aber ich mochte seine ProfessionalitÃĪt sehr gerne. Er begrÞÃte uns alle, als wir drauÃen beim EmpfangsschlÞckchen Sekt herumstanden, mit einem Lied auf dem Akkordeon und brachte fast alle dazu, Papa ein GeburtstagsstÃĪndchen zu schmettern, wobei die ÃĪltere Generation weitaus textsicherer war als wir und die Generation nach uns. Danach hielt er sich wieder zurÞck und dudelte unaufdringliche Schlager im Hintergrund, teilweise am Keyboard selbst gespielt und gesungen, teilweise vom Band, wÃĪhrend wir aÃen und uns unterhielten. Nach Absprache mit meinen Eltern wurde dann zum Tanz aufgespielt. Irgendwann am Nachmittag verteilte er TextbÞcher, und wer wollte, konnte Volkslieder mit ihm singen. Ab und zu wurden GÃĪste mit in die Performance einbezogen, wenn sie wollten, keiner musste, alles ging. Das fand ich wirklich bemerkenswert, diese Grenze zwischen âich muss fÞr Stimmung sorgenâ, âich lasse alles einfach mal laufen, sorge aber fÞr einen angenehmen Musikteppichâ und âich unterstÞtze die gut gelaunte Feierlichkeit, ohne dass es peinlich oder penetrant wirdâ. Profi halt.
WorÞber ich mich auch freute: dass meine Idee mit den ausgedruckten Fotokarten gut ankam. Meine Schwester hatte in den letzten Jahren nach und nach unsere ganzen Familienalben eingescannt und mir einen Berg an Zeug gemailt, aus dem ich Motive auswÃĪhlte, die meiner Meinung nach Papas 80 Lebensjahre wenigstens punktuell abbildeten: mit seinen Eltern, mit Mama, die vor Þber 50 Jahren noch seine schicke, junge Verlobte war, dann mit meiner Schwester und mir, Hausbau, Urlaub, Feiern mit der Verwandtschaft, Nachbarschaftshilfe, Familienkram. Wir stellten einige Karten auf die Tische, andere aufs Buffet und es passierte genau das, was ich mir erhofft hatte: Die Menschen an den jeweiligen Tischen unterhielten sich Þber die Bilder bzw. die Abgebildeten, tauschten die Karten miteinander und guckten auch nach, was auf den anderen Tischen so stand. Simple Idee, prima Konversationsstarter. Profi halt. (SCNR.)
Abends war ich eigentlich platt, aber ich sehe meine Schwester und ihren Mann recht selten, weswegen F. und ich den Restabend bei den beiden auf der Terrasse verbrachten. Es wurde Rotwein gereicht und Pastis (Haselnussgeist fÞr die Anti-Anis-Fraktion wie mich), wir vernichteten ein Kilo NÞsschen und ich stellte erstaunt fest, dass bestimmte RÃĪucherstÃĪbchen wirklich gegen MÞcken halfen. Eigentlich stellte ich das erst einen Abends spÃĪter bei meinen Eltern auf der Terrasse fest, wo ich ohne RÃĪucherstÃĪbchen fies gestochen wurde.
SpÃĪt und mÞde ins Bett.
—
Montag: Hannover
FrÞh und mÞde wieder wach. Keine Ahnung warum, aber F. und ich waren beide gefÞhlt vor 6 wach (ich auf jeden Fall). Wir hatten das Sprengelmuseum in Hannover geplant, das um 10 Ãķffnete. Pfingstmontag war kein richtiger Montag, wo die meisten Museen geschlossen haben, aber der S-Bahn Hannover war das egal. Aus unserem kleinen DÃķrfchen fuhr nur jede Stunde eine Bahn, weswegen wir aber immerhin eine gute Ausrede hatten, um nicht noch stundenlang mit der Familie und der Verwandtschaft zu frÞhstÞcken â âwir mÞssen los, die S-Bahn, Feiertag und soâ.
Auf dem Weg zum Bahnhof zeigte ich F. noch meinen Lieblingsjesus, der in der Kirche hÃĪngt, in der ich getauft und konfirmiert wurde und in der man mich meistens am Heiligen Abend antrifft, wo ich bei Weihnachtsliedern heule. Hier sieht man den Jesus im Header und auf dem Bild zum Abschnitt GrÞndonnerstag; ich selbst habe ernsthaft kein Foto von der Skulptur. (Memo to me: machen.) Ich mag an dieser Jesus-Darstellung die Gradlinigkeit, die Schlichtheit und dass die Figur nicht als Mensch an einem Kreuz hÃĪngt oder steht, sondern selbst das Kreuz bildet. Es sieht dabei aber nicht nach Leiden und Tod aus, sondern nach ausgebreiteten, empfangenden Armen. Er trÃĪgt keine Dornenkrone, und ich meine, selbst die Stigmata sind nicht zu sehen.
Ich mag voreingenommen sein, weil ich auf diesen Jesus seit Þber 40 Jahren gucke, aber ich kenne keine weitere Darstellung, die mir ÃĪhnlich gut gefÃĪllt, und ich habe gerade in den letzten Jahren des Studiums wirklich bergeweise gesehen. Das Gerokreuz im KÃķlner Dom kommt ihm in meiner Zuneigung recht nahe, wohl auch, weil es Jesus ebenfalls eher als Mensch denn als Gott zeigt.
—
Ich kannte das Sprengelmuseum grÃķÃtenteils, aber F. noch nicht, und so lieà ich ihn bestimmen, wo er hinwollte. Okay, fast: Zuerst zerrte ich ihn in die LichtrÃĪume von James Turrell, die ich sehr liebe. Vor allem den, in dem man in absoluter Finsternis sitzt, bis sich nach sechs, sieben Minuten die Augen an das Fehlen von fast allem Licht gewÃķhnt haben und man ein Rechteck? einen schmalen Streifen? ein Kreissegment? aus Licht wahrnimmt, das vor einem in nicht bestimmbarer Entfernung auftaucht.
Wir gingen recht schnell durch die Kunst nach 45, die ÃĪuÃerst luftig hÃĪngt, das hatte ich etwas enger in Erinnerung. Aber: Das Museum hat seit Kurzem einen neuen, groÃen Anbau, und in dem hing dann auch all das, an was ich mich erinnerte, vor allem die Neue Sachlichkeit, die ich besonders sehen wollte. (Mein Liebling: das MÃĪdchen im CafÃĐ von Ernst Thoms. Darauf freute ich mich genau wie auf die Lichtspiele Turrells.) Was mir auch auffiel: AllmÃĪhlich scheint sich der Umgang mit systemkonformer Kunst zwischen 1933 und 1945 zu ÃĪndern. Anstatt diese Zeit still zu Þbergehen, hÃĪngen wenigstens ein paar Exponate, zum Beispiel von Adolf Wissel oder Georg Schrimpf, an denen bzw. deren Begleittexten die gebrochenen oder konstanten Biografien ganz gut sichtbar werden.
Was der Anbau Þbrigens auch hat: ein groÃes Panoramafenster, von dem man auf den Maschsee gucken kann, bequem auf zwei Sofas. Man kann dabei auch einen Film Þber Arno Breker gucken, aber wir sahen lieber dem Regattastart der Drachenboote zu. Aber spÃĪter bei einem Eiskaffee im MuseumscafÃĐ guckten wir dann brav auf ein NS-Kunstwerk am See.
Im Untergeschoss waren wir schon recht mÞdegesehen, aber natÞrlich musste der Merzbau sein. Ich konnte mich nicht daran erinnern, schon einmal im El-Lissitzky-Kabinett gewesen zu sein, aber das machte uns wirklich wieder wach, was der Sinn der ganzen Raumgestaltung war. Man konnte SchaukÃĪsten kippen und Bilderleisten verschieben, und mit sowas kriegt man mich ja immer. Mal eben eine Wand vor einen Mondrian ziehen, warum nicht?
Ganz zum Schluss huschten wir noch in eine kleine Ausstellung mit Werken von Hans Uhlmann und GÞnter Haese, von denen mich letzterer total begeisterte. Er stellte aus dÞnnstem Draht, Uhrenfedern und ÃĪhnlich winzig-fragilen MetallgegenstÃĪnden abstrakte Skulpturen her, die mich schlicht faszinierten. Hier sieht man ein paar von ihnen. Gerade die goldfarbenen Objekte erinnerten mich an die Eldorado-Ausstellung, die ich als Kind gesehen hatte: ein Ãberfluss an Reichtum und SchÃĪtzen. Hier ist es deutlich billigeres Material, aber der Gesamteindruck war der gleiche: ein Geschenk an Farbe, Material und Raumgestaltung. Leider waren wir beide doch recht platt, weswegen wir diesen Ausstellungen nicht mehr genÞgend Zeit lieÃen.
—

Die von Niki de Saint-Phalle gestaltete Grotte in den HerrenhÃĪuser GÃĪrten. KÞnstlerische Darstellungen von dicken Frauen haben bei mir immer gewonnen.
Nach einer StÃĪrkung im CafÃĐ ging es in die HerrenhÃĪuser GÃĪrten. Erstens, weil man in die halt reingeht, wenn man als Touri in Hannover ist, und zweitens, weil die Performance This here and that there von Vlatka Horvat angekÞndigt war, die spannend klang. Die KÞnstlerin und ihre drei Mitstreiterinnen bespielten die sogenannten Schwanenbecken, vier quadratische, flache Wasserbecken. Dort stellten sie StÞhle in gewisse Formationen, lÃķsten diese wieder auf und schufen neue Anordnungen. Das ganze lief an drei Tagen fÞr jeweils acht Stunden, wofÞr ich die Damen sehr bewundere. Wir erwarteten nicht viel, saÃen aber gebannt Þber eine halbe Stunde zwischen zwei Becken, und wenn meine Eltern uns nicht zum Abendessen erwartet hÃĪtten, wÃĪren wir bis zum Ende um 19 Uhr gelieben.
Es hÃķrt sich so simpel an â da stellen halt Leute Muster aus StÞhlen ins Wasser â, aber genau diese Muster, die entstanden und wieder zerstÃķrt wurden, entwickelten eine spannende Dynamik, auf die ich gar nicht vorbereitet war. Ich wollte da eigentlich nur sitzen und nicht mehr rumlaufen mÞssen, es war schattig, ein leichter Wind ging, wir hatten eine bequeme Bank und Wasser, wir hÃĪtten einfach rumlungern kÃķnnen. Ich konnte mich aber nur kurz entspannen, denn erstaunlicherweise guckte ich den entstehenden Mustern und Formationen doch atemloser zu als erwartet. Im Becken rechts von uns entstanden aus den StÞhlen gerade zwei Viertelkreise, und ich empfand es als unglaublich befriedigend, als aus den einzelnen, teilweise schrÃĪg gestellten StÞhlen zwei herrlich symmetrische Kreisteile wurden. Genauso unbefriedigend bzw. aufwÞhlend empfand ich es aber, als dann nach einer kurzen Ruhezeit, in der das Bild einfach stand, StÞhle wieder entfernt wurden und die Symmetrie brutal zerstÃķrt wurde. Jedenfalls kam es mir brutal vor. So ging es mir auch mit dem Bild, das im linken Becken enstand. Wir kamen an, als verschiedene StuhlgrÞppchen so standen wie Wartezimmeranordnungen oder an FlughÃĪfen, mal hier ein GrÞppchen, dann eins da drÞben. Nach und nach entstanden vier Reihen, die aufeinander zuliefen, was die gleiche Befriedigung bei mir auslÃķste wie die Kreissegmente. Auf einmal war alles gut, alles passte, nichts anfassen bitte. Daran hielt sich die KÞnstlerin natÞrlich nicht, sondern nahm mal hier, mal dort einen Stuhl weg oder drehte ihn seitwÃĪrts, alles langsam, alles gemÃĪchlich, das Wasser plÃĪtscherte vor sich hin, die BlÃĪtter der BÃĪume und Hecken um uns herum rauschten im leichten Wind, es hÃĪtte alles so schÃķn sein kÃķnnen, aber nein, es musste ja jemand aus einer perfekten Linie eine unperfekte machen!
Falls ihr die Chance haben sollten, diese Performance noch einmal irgendwo zu sehen: macht das mal. Hypnotisch.

—
Abends platt und mÞde bei meinen Eltern Reste des sonntÃĪglichen Festessens verspeist, ein Herri getrunken (auch schon sehr lange nicht mehr gemacht), um zehn ins Bett, weil wirklich fertig. Dass Kunstgucken immer so anstrengend ist!
Wobei ich auch deswegen platt war, weil sich mein Introvert’s Hangover meldete. Ich leide nur bedingt kÃķrperlich vor mich hin, mein Ãhrchen piept manchmal tinnitusmÃĪÃig, aber es geht immer wieder weg, sobald ich Ruhe habe, und ich bin verspannt, aber ich glaube, in bin immer verspannt. Ich merke aber, dass ich immer gnatziger und kurz angebundener werde, jede Smalltalk-Minute macht mich aggressiver und ich werde schlicht unleidlich, obwohl ich es gar nicht sein will. Der Sonntag hatte mich durch die vielen Menschen schon sehr gestresst, obwohl ich ihn genossen hatte, und Montag abend waren einfach alle Reserven verbraucht.
—
Dienstag: Halle
Auf der Zugfahrt nach Halle konnte ich die Reserven wieder auffÞllen. Dazu reichten ein schÃķner Sitzplatz am Fenster und die Noise-Cancelling-KopfhÃķrer und schon war ich eine Stunde in meiner eigenen kleinen Blase. Danach ging es mir deutlich besser.
Die Moritzburg in Halle hatte Ende letzten Jahres ihre stÃĪndige Sammlung zur Kunst der ersten HÃĪlfte des 20. Jahrhunderts neu gehÃĪngt; eine Leserin machte mich freundlicherweise darauf aufmerksam. Ich zitiere von der Website â der Text findet sich auch im begleitenden Blog zur NeuhÃĪngung:
âEtwas Besonderes stellt die Inszenierung der Kunst entlang der drei politischen Systeme in der ersten JahrhunderthÃĪlfte dar und hierbei besonders die Thematisierung der Kunst im âDritten Reichâ. In einer diskursiven GegenÞberstellung wird sowohl das Fortwirken der Moderne in den 1930er und 1940er Jahren vorgestellt als auch die von den Nationalsozialisten offiziell anerkannte Kunst. Damit beschreitet das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) unter den Kunstmuseen in Deutschland einen neuen Weg in der Auseinandersetzung mit der eigenen Institutionsgeschichte sowie mit der deutschen Kunstgeschichte und der daraus abgeleiteten PrÃĪsentation der SammlungsbestÃĪnde.â
Das wÞrde ich heftig abnicken. Ich bin blÃķderweise davon ausgegangen, dass es zur NeuprÃĪsentation einen Katalog geben wÞrde, daher habe ich nicht fotografiert, weder Werke noch Beschriftungen, und als uns nach drei Stunden unten im Museumsshop klar wurde, dass es keinen gibt, war ich zu faul, nochmal hochzugehen. Daher kann ich euch jetzt keine Namen nennen, aber ich lege euch den Besuch dringend ans Herz, falls euch das Thema nicht schon zu den Ohren rauskommt, seit ich hier davon dauernd schreibe. Hier werden aktuelle ForschungsstÃĪnde abgebildet bzw. als gut lesbarer Wandtext verfÞgbar gemacht (looking at you, Wandtexte in der Pinakothek der Moderne). Es wird klar, dass die Kunst eben nicht 1933 aufgehÃķrt und 1945, huch, wieder angefangen hat. Dass viele Maler und Malerinnen gewisse SpielrÃĪume hatten, die sie ausnutzten und eben nicht alles schwarz oder weià war. Dass die NS-konforme Kunst noch lÃĪngst nicht aufgearbeitet und dass jede Biografie anders ist und anders gelesen werden kann. (Genau das mache ich ja gerade mit Protzen.) Die wenigen Werke waren meiner Meinung nach sehr gut gewÃĪhlt, weil sie eine gewisse Bandbreite abbildeten â das Grau zwischen dem Schwarz und dem Weià halt, zwischen den Gottbegnadeten und der âentarteten Kunstâ. Die Pinakothek der Moderne hat mit ihrem Saal 13 2015 (?) damit angefangen, NS-konforme Kunst in der Sammlung auszustellen, war aber einen Hauch zu zÃķgerlich. Die Moritzburg hat das jetzt sehenswert und konsequent gemacht. Wie F., der sich seit drei Jahren meinen, Zitat, âNazischeiÃâ aufmerksam anhÃķrt und anguckt, sagte: âSaal 13, aber richtig.â

Das ganze Stockwerk war toll, nicht nur die kleine Ecke mit der Regimekunst. In der Neuen Sachlichkeit freute ich mich Þber zwei Bilder, die F. und ich gerade in Frankfurt bei der Weimar-Ausstellung gesehen hatten. AuÃerdem bewunderte ich frÞhe Werke von Franz Marc, die aber schon den spÃĪteren erkennen lassen, den ich ja eigentlich nicht so mag, diese Arbeiten dann aber doch. Beckmann geht ja eh immer, genau wie Lehmbruck, und ein paar Bilder halfen mir auch bei der Einordnung von Protzen weiter, zum Beispiel von Karl VÃķlker.
Direkt nebenan ging es weiter â mit Kunst nach 1945 aus der DDR. Davon verstehe ich quasi nichts, aber den Raum fand ich bis auf seine wirre WegefÞhrung genauso begeisternd. Auch hier, aber ich muss nochmal betonen, davon keine Ahnung zu haben, hatte ich das GefÞhl, einen aktuellen Forschungsstand prÃĪsentiert zu bekommen. F. war im letzten Jahr bereits schon einmal in der Moritzburg gewesen, und da wurde die DDR-Kunst noch verschÃĪmt als abstrakt prÃĪsentiert, so nach dem Motto, hatten wir auch. Der sozialistische Realismus wurde genauso verschwiegen wie heute eben die NS-konforme Kunst verschwiegen wird (womit ich beide keinesfalls gleichsetzen will). Nun kann man auch den Realismus anschauen, aber eben auch die Abstraktion, die Pop Art (noch nie davon in der DDR gehÃķrt) und die stetigen Auseinandersetzungen mit der vom System gewÞnschten Kunst. Auch hier: SpielrÃĪume. Alleine fÞr Wolfgang Mattheuers Kain lohnt sich der Eintritt; das Bild kannte ich aus einem Uni-Seminar, wusste aber nicht, dass es hier hÃĪngt. Neu entdeckt habe ich fÞr mich Hermann Bachmann.
—
Auch in diesem Museum blieben wir lÃĪnger als geplant, daher war der Rest des Stadtaufenthalts kurz und schmerzlos. Ein Blick in den Dom (och jo), einen etwas lÃĪngeren in die Marktkirche (die Decke!), und dann saÃen wir noch knapp zwei Stunden im Schatten in einer gutbÞrgerlichen Kneipe, ich trank Schwarzbier, F. Pils, wir aÃen Salzkrustenbraten bzw. eine Bauernpfanne und schleppten uns dann wieder in Richtung Tramhaltestelle. In den Trams war ich vorher schon von der Ansagestimme Þberrascht worden, denn das war die gleiche Dame, die mich in Hamburg in den Bussen der Linien 20 und 25 jahrelang genervt hatte mit ihrer Pause mitten im Namen meiner Endhaltestelle: âKottwitz … straÃe.â DAS IST EIN WORT, DU TRULLA VOM BAND!
Gegen 22 Uhr wieder in MÞnchen. Endlich, seufzte ich in der U2, endlich wieder zuhause, endlich wieder allein sein.
—
Mittwoch: MÞnchen
Urlaub vom Urlaub. Vormittags arbeitete ich kurz und erledigte beruflichen Kleinkram, dann ging ich einkaufen, um vor allem meine BrotvorrÃĪte wieder aufzufÞllen â ich war ja ewig weg! â, aber dann lag ich nur noch auf dem Sofa, guckte unter anderem vier Folgen Masterchef Australia, zu denen ich am Wochenende nicht gekommen war, las, ruhte mich aus und schrieb Þber zwei Stunden an einem Blogeintrag *hust*. Ich muss mir meinen innerlichen Bildungsauftrag abgewÃķhnen. Wenn ich nur Þber mein Essen bloggen wÞrde, wÃĪre ich viel schneller fertig!
—
Was schÃķn war, Mittwoch/Donnerstag, 16./17. Mai 2018 â EichhÃķrnchenvorlesung und Kunstarchiv
Mittwoch ist EichhÃķrnchenvorlesungstag! So nenne ich bekanntlich die Vorlesung, die sich mit den Werkzeugen der modernen Malerei befasst. In der dieswÃķchigen Sitzung ging es um Farben, also nicht um ein Werkzeug, sondern um ein Material, aber auch hier lernte ich wieder tausend Kleinigkeiten, die mein Bild der Malerei um wichtige BruchstÞcke ergÃĪnzten.
Wir begannen mit einer kleinen EinfÞhrung in die Geschichte der Farbherstellung, also wie aus Pigmenten und Bindemitteln die Farbe wird, die auf der Holztafel oder der Leinwand landet. Schon die Namen der alten Farben lassen erkennen, wie weit der Weg der Pigmente war, bis sie im zentralen Europa benutzt wurden. Das ist leider auch wieder so ein westlich-europÃĪisches Denken â die Farben wurden natÞrlich auch in Asien und Afrika benutzt, wo diese Namen weitaus weniger Sinn ergaben. In Indigo steckt Indien (Bengalen) drin, und ich lernte die Indigo-Unruhen kennen, der mir bis dahin unbekannt war. Ultramarin (âÞber das Meerâ) wurde aus Lapizlazuli gewonnen, das hauptsÃĪchlich in Afghanistan abgebaut wurde (seitdem denke ich Þber die Farbe der afghanischen Burkas nach, bei denen ich mich schon lÃĪnger gefragt habe: wieso sind die blau und nicht schwarz wie in arabischen LÃĪndern die FrauengewÃĪnder?). Ich lernte, dass in der Renaissance die beauftragten Maler ihre Materialien genauso wie ihre Arbeitszeit abrechneten und dass Gold und Ultramarin extrem teuer waren, weswegen mit diesen FarbtÃķnen nur die wichtigsten Bilddetails gemalt wurden (der Himmel als Goldgrund, das dunkelblaue Gewand der Maria). In TÞrkis steckt die TÞrkei, in Orange die exotische Frucht, in Indisch-Gelb … okay, das ist selbsterklÃĪrend. Was ich aber noch nicht wusste: Diese Farbe entstand aus dem Urin von KÞhen, die mit Mangos gefÞttert worden waren.
In diesem Zusammenhang lernte ich auch, dass Pigmente mit zu den ersten Dingen gehÃķrten, die global gehandelt wurden. Einen wirtschaftlichen Buchtipp des Dozenten dazu lieh ich mir gleich aus. Und dazu noch ein Buch, das er empfahl, in dem es unter anderem um die schon angesprochenen KÞnstlerrechnungen geht und was sie uns Þber die Malerei der Renaissance verraten.
Wir kamen noch einmal auf den intellektuellen Kampf zwischen Linie und Farbe, disegno/colore, zu sprechen, der in der Renaissance begann, sich aber bis ins 19. Jahrhundert fortsetzte. Die beiden Spielarten der Malerei wurden gerne als mÃĪnnlich/weiblich positioniert, siehe das Bild von Il Guercino im Wikipedia-Link zu disegno. Das ging so weit, dass Charles Blanc in seinem Buch Grammaire des arts du dessin (1867) davon sprach, dass die Farbe nie die Macht Þber die Linie gewinnen dÞrfe, sonst wÞrde sie die Malerei ruinieren so wie Eva die Welt ruiniert hÃĪtte. (Hier bitte das Þbliche Augenrollen meinerseits dazu denken.) Wir sahen auch wieder ein Bild von GÃĐrÃīme, Der FarbenhÃĪndler (1890), in dem man, wenn man will, die FarbtÃķpfe mit den Pigmenten und den StÃķÃel als weiblich/mÃĪnnlich interpretieren kann.
Wir sprachen dann Þber den Ãbergang von Tempera- zu Ãlfarben, mit denen sich die MÃķglichkeiten der Darstellung deutlich verÃĪnderten. Weil Ãlfarbe lÃĪnger braucht, bis sie trocknet, kann man sie dementsprechend lÃĪnger verarbeiten, verÃĪndern, mischen, wÃĪhrend Tempera kaum noch nachtrÃĪgliche Ãnderungen mÃķglich macht. Vor allem fÞr die Darstellung von menschlicher Haut und ihrer sinnlichen QualitÃĪten wurde Ãlfarbe geschÃĪtzt, bis im 19. Jahrhundert der Historismus eine ZÃĪsur schuf. Die PrÃĪraffaeliten in England sowie die Nazarener im deutschsprachigen Raum orientierten sich eher an alten Bildmotiven bzw. Malstil, wÃĪhrend in Frankreich viele KÞnstler bewusst wieder zur Temperafarbe griffen, um der akademischen Ãlmalerei etwas entgegenzusetzen.
Im 20. Jahrhundert bewarb Magna Paint ihre Acrylfarbe mit dem (sinngemÃĪÃgen) Slogan: âDie erste neue Farbe seit 500 Jahren.â Ob das vÃķllig stimmt, lieà der Dozent mal dahingestellt, aber: Die Acrylfarbe verÃĪnderte die Malerei erneut, ÃĪhnlich wie die industrielle Herstellung von Farben Ende des 19. Jahrhunderts den Welthandel mit Pigmenten verÃĪnderte bzw. zum Erliegen brachte. Anfang des 20. Jahrhunderts war Þbrigens das Deutsche Reich fÞhrend in der Herstellung; 90 Prozent aller Industriefarben stammten daher. Die zwei Weltkriege verÃĪnderten aber auch diese Industrie bzw. den Welthandel damit. (Ich wundere mich ja immer noch, was wir alles verkackt haben in unserer Geschichte. Es kommen immer wieder Details dazu, die ich noch nicht kannte.)
ZurÞck zur Acrylfarbe. Wir sahen unter anderem ein Bild von Thomas Hart Benton, dem Lehrer von Jackson Pollock, der mit der Moderne haderte. Sein WandgemÃĪlde Instruments of Power from America Today (1930/31) besteht zum Teil aus Tempera, ein bewusst gewÃĪhltes Material. Pollock hingegen verwendete bewusst Acrylfarbe bzw. Autolack, der nicht nur andere FarbtÃķne aufwies, sondern sich auch anders auf seinem Malgrund verteilen lieÃ. Autolack kam im Eimer und musste nicht mehr auf Paletten angemischt werden; seine Drip Paintings wÃĪren mit althergebrachten Materialien gar nicht mÃķglich gewesen. Er sagte 1951 in einem Interview: âEach age finds its own technique.â Ich musste sofort an die Videokunst der 70er und 80er Jahre denken, die heute nicht mehr von anfÃĪlligen BÃĪndern und Videorekordern abgespielt wird, sondern schon auf DVD existiert (noch). Oder die ersten Kunstwerke, die sich mit Computern und dem Internet auseinandersetzten und schon heute total veraltet aussehen, obwohl sie gerade mal 20 bis 30 Jahre alt sind. Gleichzeitig denke ich aber Þber die Renaissance der Malerei nach wie sie zum Beispiel Neo Rauch betreibt, der fÞr meinen Geschmack immer barocker wird.
—
Gestern saà ich dann wieder im Kunstarchiv in NÞrnberg und wÞhlte den Nachlass von Protzen ein zweites Mal durch. Seit dem ersten Durchgang hatte ich viel gelesen und mich weiter in dieser Zeit umgeschaut, aber vor allem hatte mein Kopf die Gelegenheit, alles sacken zu lassen. So sah ich gestern Dinge, die mir beim ersten Anschauen nicht aufgefallen waren. Zum Beispiel hatte ich seine vielen privaten Fotoalben nur flÞchtig durchgeblÃĪttert, sah nun aber, dass viele Motive aus Urlauben oder von Wochenendausfahren sich in seinen GemÃĪlden wiederfanden. Ich sah Ãlbilder, die eindeutig auf die Grafikmappe von 1920 rekurrierten, ich konnte Namen und Daten besser einordnen, die mir jetzt in der Korrespondenz unterkamen (die leider nicht sehr reichhaltig vorhanden ist), und ich konnte generell sein Werkverzeichnis etwas aufmerksamer anschauen als beim ersten Mal, weil ich inzwischen ein bisschen besser weiÃ, wo ich hinmÃķchte.
AuÃerdem durfte ich gestern die 15 Kisten des noch unverzeichneten Nachlasses nummerieren und habe mir brav notiert, was ich in welcher Kiste oder Mappe finde; das wird mir bei den nÃĪchsten DurchgÃĪngen sehr helfen. Dass es noch weitere DurchgÃĪnge geben wird, ist klar, aber jetzt warte ich erstmal auf ein paar Antworten per Mail bzw. schreibe noch an weitere Menschen, Firmen und Institutionen, von denen ich mir AuskÞnfte erhoffe. Das wird! (Hoffe ich.)
—
Tagebuch, Montag, 14. Mai 2018 â Dinge geregelt kriegen
TOP 1: zum PrÞfungsamt radeln und endlich mein Masterzeugnis im Original vorlegen. FÞr meine Immatrikulation als Doktorandin reichte das vorlÃĪufige Zeugnis und ich musste versprechen, das Original nochmal vorzulegen, sobald es mir ausgehÃĪndigt wurde. Das habe ich natÞrlich total vergessen (ich war ja immatrikuliert, nach mir die Sintflut), bis letzte Woche eine freundliche Mail kam, die mich darauf hinwies, dass ich dem Amt noch was schuldig wÃĪre (es muss was Lebendiges in den Deich). Also hingeradelt, ohne Wartezeit eingetreten, Original vorgelegt, drei mitgebrachte Kopien abgestempelt bekommen, alles da. Neben der PrÞfungsamtsdame saà Þbrigens eine Auszubildende (?), der erklÃĪrt wurde, was hier gerade passiert. Jetzt weià ich, dass es anscheinend Leute gibt, die per Farbkopierer Masterzeugnisse fÃĪlschen. Ich gucke ja lieber Serien, aber das klingt auch wie ein interessanter Zeitvertreib.
TOP 2: dem LieblingshÃķrsaal Hallo sagen. Wenn ich im HauptgebÃĪude in der NÃĪhe bin, gucke ich da immer sehnsuchtsvoll rein. Ich vermisse dich, klimatisierte und optimal verdunkelbare Holzkiste mit guter Akustik und bequemen Sitzen! Team B 201 forever! Let’s get tattoos together!
TOP 3: zur Stabi radeln und ein Buch abgeben. Eigentlich kein Ding, aber wenn vor einem in der Schlange ein MÃĪdel mit zwei BÞchertaschen steht, dauert es eben doch ein bisschen. Vor allem, wenn die HÃĪlfte der BÞcher auf die Karte ihrer Schwester ausgeliehen war und sie ein paar davon jetzt auf ihre eigene und Þberhaupt. Ging aber alles, ich gab mein lausiges Einzelbuch ab und radelte wieder nach Hause.
TOP 4: WÃĪsche waschen, Teil 2. Meine SamstagswÃĪsche war trocken, nun kam das ganze Bettzeug dran.
TOP 5: Erdbeeren mit Vanillejogurt essen. Bester Tagesordnungspunkt ever!
TOP 6: Masterchef Australia gucken. Zweitbester Tagesordnungspunkt ever! Und dank der Zeitverschiebung nach Australien schon ab ungefÃĪhr 14 Uhr in diesem Interweb mÃķglich!
TOP 7: Mails schreiben.
â an die Unibibliothek MÞnster, die die gleiche Grafikmappe von Protzen im Bestand hat, die ich mir Freitag im ZI angeschaut hatte. Bei uns fehlt allerdings ein nummeriertes Blatt â nach der 2 kommt die 4 â, aber die Gesamtzahl von 20 BlÃĪttern ist korrekt, denn nach der 20 kommt noch eine unnummerierte Seite. Da es diese Mappe anscheinend nur in diesen zwei Bibliotheken gibt und die Uni MÞnster das Ding als RaRa-Bestand nicht als Fernleihe rausrÞckt, fragte ich per Mail nach, ob ihre Mappe genauso aufgebaut ist wie unsere und wenn nicht, ob ich Blatt 3 bitte als Digitalisat oder Kopie kriegen kÃķnnte. Die Bibliothek antwortete nur kurze Zeit spÃĪter, dass sie die Mail an die Abteilung Historische BestÃĪnde weitergeleitet habe, und von dort meldete sich ebenfalls nur kurze Zeit spÃĪter jemand, der mir sagte, dass die dortige Mappe ein Blatt 3 habe. Da Protzen aber erst 1956 verstorben und sein Werk damit noch nicht gemeinfrei ist, darf das Digitalisat nicht ins Netz gestellt werden, sondern ich muss gegen eine kleine GebÞhr einen Scan bestellen, den ich dann per Mail kriege. Hin- und hergerissen gewesen zwischen Freude Þber die schnelle Erledigung und die tollen MÃķglichkeiten der Digitalisierung und Ãrger Þber das beknackte Urheberrecht und seine bescheuerten 70 Jahre Schutzfrist.
â an das Kunstarchiv NÞrnberg, wo ich Donnerstag wieder sitzen und im Nachlass von Herrn Protzen rumwÞhlen werde. DafÞr mÞsste mir der Nachlass aber ausgehoben werden und darum bat ich in der Mail.
â an das Lenbachhaus, in dessen nicht-Ãķffentlicher Bibliothek sich anscheinend das letzte Exemplar eines Katalogs zu einer Ausstellung von Protzen und seiner Frau Henny Protzen-KundmÞller von 1976 befindet. Der Nachlass der beiden, den ich gerade in NÞrnberg bearbeite, wurde von Protzen-KundmÞller sowohl dem Lenbachhaus als auch der Bayerischen StaatsgemÃĪldesammlung Þberlassen mit der Auflage, eine GedÃĪchtnisausstellung auszurichten. Die haben beide nicht mehr miterlebt â Protzen starb 1956, Protzen-KundmÞller 1967 â und sie war vermutlich nicht exorbitant groÃ, denn der Katalog umfasst gerade 16 Seiten. Aber auch die will ich natÞrlich sehen. Und ich hoffe insgeheim, dass vielleicht doch ein paar Unterlagen noch im Lenbachhaus oder bei der StaatsgemÃĪldesammlung rumliegen, die ich in NÞrnberg schmerzlich vermisse.
â nochmal an das Lenbachhaus, aber an eine andere Ansprechpartnerin. Dieses Mal geht es mir um die BestÃĪnde von Protzen im Haus, von denen ich gerne eine Liste hÃĪtte. Ein Anfang war natÞrlich die Datenbank GemÃĪlde in Museen â Deutschland, Ãsterreich, Schweiz Online, bei der ich generell nachschauen kann, welches Bild sich wo befindet, aber die einzelnen HÃĪuser verzeichnen gerne noch fÞr mich relevante Infos wie Zugangsdatum, Ankaufspreis oder ÃĪhnliches.
â nochmal die gleiche Mail, aber dieses Mal an die Pinakotheken, die Þber 100 Bilder von Protzen im Depot haben. Und eins in der Ausstellung. (Theoretisch. Ich weià gerade selbst nicht, ob es derzeit im Saal 13 hÃĪngt oder fÞr die Klee-Ausstellung weichen musste. Oh, die kÃķnnte ich mir auch allmÃĪhlich mal anschauen. TOP fÞr heute!) Die Liste hÃĪtte ich gerne, weil mir die Online-Sammlung, so praktisch sie fÞr den ersten Eindruck ist, nicht weiterhilft wegen der bereits bemÃĪngelten Bildrechte. Ich brauche Abbildungen!
â ans Bundesarchiv in Berlin, um die Unterlagen der Reichskammer der bildenden KÞnste einzusehen und zu ÞberprÞfen, ob Protzen wirklich kein Mitglied der NSDAP war, wie er es im Spruchkammerbogen angegeben hatte, der netterweise im Nachlass liegt. Ich frage nicht nach, warum er da liegt und nicht in einem Archiv, sondern freue mich Þber einen Weg weniger.
(Ach, wo ich gerade nach âSpruchkammerbogenâ gegoogelt habe, weil ich mir plÃķtzlich bei der Bezeichnung unsicher war: hier ist der Bogen von Oskar Schindler aus Regensburg.)
TOP 8: Zeitung lesen, Ulysses lesen.
TOP 9: KÃĪsebrot, Gin Tonic.
TOP 10: den Abend mit F. verbringen. Gemeinsam einschlafen.
Alles abgearbeitet!
—
Was schÃķn war, Dienstag/Mittwoch, 8./9. Mai 2018 â âPhilipp Lahmâ, Palettmesser, Zitronenbutter
Meine EindrÞcke zum StÞck Philipp Lahm von Michel Decar, das F. und ich am Dienstag abend im Marstall sahen, wollte ich eigentlich schon gestern aufschreiben, aber eine fast schlaflose Nacht mit anschlieÃender fieser MÞdigkeit tagsÞber kam mir dazwischen. AuÃerdem hadere ich seit dem StÞck mit meiner fast tÃĪglichen Ãberschrift âWas schÃķn warâ.
Philipp Lahm hat mir sehr gut gefallen, mich aber gleichzeitig auf vielen Ebenen angefressen. Und gerade als ich mich ÃĪrgern wollte, weil mich ein Theatersatz anfrisst, dachte ich, nee, das ist ja nur Theater, du bist ja gar nicht gemeint. Aber klar bin ich als Publikum gemeint und war wieder angefressen. Dann habe ich mich brav zusammengerissen und gedacht, du bist schon richtig so in deiner gelackten MittelmÃĪÃigkeit, auch wenn die dir gerade fies vor Augen gefÞhrt wird in der Person eines fiktiven FuÃballers, und das ist auch vÃķllig okay, sich dauernd Þber sein eigenes Leben zu freuen und Dinge aufzuschreiben, die schÃķn sind.
âFernsehen und frÞh ins Bett gehen, das ist eine Haltung.â
(Zitat aus dem StÞck.)
Philipp Lahm arbeitet sich an der OberflÃĪche ab, die wir alle herumtragen und weigert sich, in die Tiefe zu gehen, genau wie sich ganz vielleicht auch der echte Philipp Lahm dafÞr entschieden hat, Ãķffentlich nur OberflÃĪche zu sein, unangreifbar, immer diplomatisch, immer beherrscht. Vielleicht hat der Mann keine AbgrÞnde, vielleicht ist der ja wirklich so. Und so einer Figur, die sich mit SÃĪtzen Þber die MittelmÃĪÃigkeit und den Mainstream Þber 90 Minuten Spielzeit (FuÃball/Theater, die Wortgleichheit fÃĪllt mir erst gerade beim Schreiben auf) rettet, sehen wir halt zu. In seinem Ikea-Wohnzimmer, in dem ich natÞrlich sofort eine Vase wiederentdeckt habe, die gerade bei mir auf dem KÞchentisch steht. Vor einer Green Screen, einer Videoleinwand und vor einer dieser klappbaren Plastiktafeln mit Sponsorenaufklebern, vor denen im Stadion die armen FuÃballer schlaue Antworten auf die immer gleichen doofen Fragen geben mÞssen. Auch damit spielt das StÞck (ich zitiere aus dem Kopf und daher vermutlich falsch:)
(Off-Stimme:) âPhilipp Lahm trifft sich mit einem Reporter von The Sun bei Burger King am MÞnchner Hauptbahnhof. âWie haben Sie sich gefÞhlt, als Sie den Weltmeister-Pokal in den HÃĪnden …â [usw.]â
Das wird im letzten Interview sehr schÃķn karikiert, als sich Philipp Lahm mit der SchÞlerzeitung Stachelbeere (eine groÃe Verneigung fÞr diese Namensgebung) irgendwo trifft und gefragt wird, wie er sich fÞhlte, als er zum ersten Mal hÃķrte, dass die Dinosaurier ausgestorben sind.
Sonst erfahren wir noch Lieblingsbuch und Lieblingsfilm dieses mittelmÃĪÃigen Mannes (âMein Lieblingsbuch ist Die Unendliche Geschichte und mein Lieblingsfilm ist die Verfilmung von der Unendlichen Geschichte.â) Aber ab und zu setzt sich die Figur auch damit auseinander, dass ihm eben diese MittelmÃĪÃigkeit immer vorgeworfen wird. Er behauptet, dass eigentlich L’Avventure von Antonioni sein Lieblingsfilm ist, weist aber weitere Theorien zurÞck, dass sein Leben eigentlich falsch sei. Manche Leute sagten, dass er sein Lieblingsbuch gar nicht kenne, denn das sei in den 1920er Jahren in einer Sprache geschrieben, die er nicht verstehe, und auch seine Frau sei nicht die richtige â vielleicht sitzt die Frau seines Lebens auf Korsika und trinkt Kirschsaft? Aber dann vergewissert er sich schnell selbst: Nein, die Frau seines Lebens sitzt da hinten im Wintergarten.
Wintergarten ist ein schÃķnes Stichwort. Es fallen stÃĪndig Stichworte, die assoziativ sind und bei denen man sich an die eigene Nase fassen kann. Katar â dabei denken Bayern-Fans auch an die blÃķden Trainingslager vor Ort und die Partnerschaft mit dem Flughafen, der per Bandenwerbung zu sehen ist. Das wird aber alles nicht angesprochen, nur das Wort fÃĪllt und wer damit etwas assoziiert, ist halt selber schuld. Deswegen bin ich selber schuld, wenn ich mich angefressen fÞhle, weil mir jemand durch ein StÞck zu verstehen gibt, dass es vielleicht nicht mein Job ist, nur schÃķne Dinge aufzuschreiben, sondern stattdessen heute auf die Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz um 13 Uhr auf dem Marienplatz zu gehen, was ich nicht tun werde, weil ich lieber BlogeintrÃĪge schreibe und Þber deren Titel nachdenke und auÃerdem ist es zu warm.
Im StÞck kommt nur eine Person vor, nÃĪmlich der fiktive Lahm, aber das wird kurz gebrochen, als der ebenso fiktive Autor eines Films Þber Lahm darÞber sinniert, worÞber man eigentlich schreiben soll, wenn man sich an einem derart unfassbaren Menschen abarbeitet. Autor Decar beschreibt das selbst so:
âWas soll denn passieren in so einem StÞck? Auf den ersten Blick denkt man sich: ist doch eine vÃķllig reibungslose Biographie, die der Lahm hat. Also dramaturgisch beschrieben: Es wird besser, dann wirdâs noch ein bisschen besser, dann wirdâs noch ein bisschen besser und dann hÃķrt es auf. Die Dramaturgie geht steil nach oben und man wartet vergeblich auf den FALL. Man sieht den RISE, den RISE, den RISE, den RISE und wartet: Wo kommt denn jetzt der groÃe Skandal? Wann gibtâs die groÃe EnthÞllung? Wann kommt der Knall? Aber stattdessen hÃķrt der einfach auf zu spielen und zwar ein Jahr vor Vertragsende und sagt: Ich hab keine Lust mehr. Ich verzichte auf ein paar Millionen und bin jetzt raus. Ciao.â
Genauso fÞhlt sich das StÞck auch an. Zwischendurch kÃķnnte es eventuell zum Fall kommen, darÞber denkt auch Lahm nach und erzÃĪhlt von einer Spritztour an den Tegernsee, die eventuell an einen Abgrund fÞhrt, aber vielleicht auch nicht. Der Mann macht eben alles richtig – und will uns davon Þberzeugen. Er singt ein Lied fÞr die EU, er macht Werbung fÞrs WÃĪhlen, und er gibt gute Tipps fÞr den Alltag: âSagt Nein zu 19-jÃĪhrigen Prostituierten, denn sie sind nie wirklich so alt, sagt Nein, wenn ihr eine Lufthansa-Maschine entfÞhren sollt, sagt Ja zu Fahrradhelmen.â
Ich persÃķnlich habe den Abend nicht nur wegen der Performance von Gunther Eckes sehr genossen, sondern auch, weil der Text schlicht gut ist. Der funktioniert vermutlich auch in Leseform, aber alleine fÞr den Monolog darÞber, wie Philipp Lahm sich etwas bei Foodora bestellt, sollte man sich das StÞck anschauen. Ich werde das vermutlich noch mal tun.
âManche sagen, dass das GlÞck nur existieren kann, wenn es auch das UnglÞck gibt. Aber das glaube ich nicht.â
—
F. und ich sprachen Þber das StÞck bei PfÃĪlzer Wein und Wurst- bzw. KÃĪsebrot, was meiner Meinung nach ein sehr passendes Ende des Theaterabends war. Dann Þbernachteten wir bei mir. Oder zumindest F. Þbernachtete. Ich dÃķste kurz weg, wachte dann wieder auf â und blieb die ganze Nacht lang wach. Irgendwas saà ich lesend am KÞchentisch, dann spielte ich Candy Crush auf dem Sofa, dann versuchte ich diverse Dinge, die bei mir sonst eigentlich dazu fÞhren, dass ich schlafen kann, aber dieses Mal ging gar nichts. Erst gegen 5 schlief ich ein und war dementsprechend gerÃĪdert, als der Wecker klingelte. Theoretisch hÃĪtte ich einfach im Bett bleiben kÃķnnen, aber die EichhÃķrnchenvorlesung lockte. (Ich nenne die Vorlesung Þber Materialien der modernen Malerei inzwischen EinhÃķrnchenvorlesung.) Also quÃĪlte ich mich aus dem Bett und radelte katzengewaschen und ohne Kaffee, weil keine Zeit mehr, in die Uni, wo ich spannende Dinge Þber das Palettmesser erfuhr.
In der vierten Sitzung verstand ich endlich den Impetus fÞr diese Vorlesungsreihe: Es geht dem Dozenten darum klarzumachen, dass die Wahl von Material und Farbe nicht nur eine kÞnstlerische Funktion hat, sondern manchmal auch eine politische. So wie die Dachshaarpinsel alles schÃķn zupuschelten und die RealitÃĪt vor der TÞr lieÃen, sorgte das Palettmesser fÞr eben diese RealitÃĪt auf der Leinwand.
âIch denke, die BRD ist als Staat ganz okay.â
Ich dachte bisher, Courbet wÃĪre der erste gewesen, der das Palettmesser zum Farbauftrag genutzt hatte, anstatt nur damit Farbe auf der Palette anzumischen, wie der Name des Werkzeugs schon sagt, aber laut Dozent hatte sogar Rembrandt das schon gemacht. Courbet war allerdings der erste, bei dem die Benutzung einen programmatischen Hintergrund hatte. Courbet gilt heute als BegrÞnder des Realismus, also der Malerei, die sich nicht mehr damit begnÞgt, anÃĪmische Adlige oder biblische Sagen zu pinseln, sondern Menschen, denen wir tÃĪglich begegnen. Sein vermutlich bekanntestes Werk sind die Steinklopfer, die wir gestern auch zu sehen bekamen. Gerade fÞr Stein und Felsen nutzte Courbet den flÃĪchigen Farbauftrag, der durch das Messer mÃķglich war. Dass er nicht nur Menschen malte, die hart arbeiteten, sondern dazu auch noch ein Werkzeug â und eben nicht das feine Instrument eines Pinsels â benutzte, war mehr als eine kÞnstlerische Absicht.
FÞr sein Bild Die Quelle malte Courbet die Haut der abgebildeten Frau brav und schÃķn mit dem Pinsel, fÞr Wasser, Felsen und BlÃĪtter nutzte er hingegen das Messer. Das sieht man gut am rechten Arm der Frau, die teilweise von BlÃĪttern verdeckt wird. (Danke an das Met, dass man die Bilder schÃķn ranzoomen kann.) Die zeitgenÃķssische Kritik warf ihm vor, eher ein Arbeiter als ein KÞnstler zu sein, und in Karikaturen wurde er gerne mit Maurerkelle an der Leinwand gezeigt. Sein Kollege Millet, dessen SÃĪmann auch nicht gut ankam, wurde mit Harke statt Pinsel dargestellt.
Mein Lieblingsbild aus der Vorlesung war Vollons Butterklumpen, den ich noch nicht kannte, und der diesen Klumpen eben nicht nur mit dem Messer malte, sondern auch noch eins abbildete. AuÃerdem sah ich ein Bild von CÃĐzanne wieder, das mich schon in der Vorlesung zu diesem Maler faszinieren konnte: sein Stillleben mit Brot und Lammkeule, das auf der Website vom Kunsthaus ZÞrich leider nicht zu finden ist, daher hier ein Werbelink. Angeblich ist sich die Forschung immer noch nicht ganz sicher, womit CÃĐzanne den Fleischbrocken gemalt hat; ein Palettmesser wÞrde hÃĪrtere Kanten erzeugen. Momentan denkt man laut Dozent Þber LÃķffel oder sogar nur die behandschuhten Finger nach.
Was ich noch nicht kannte: CÃĐzanne malte auch Menschen in dieser fleischigen, flÃĪchigen, fast schon skulpturalen Malweise, hier seinen Onkel als Anwalt. Das Bild L’Oncle Dominique en avocat hÃĪngt im MusÃĐe d’Orsay, das leider nur winzige Abbildungen hat, daher kopiere ich jetzt mal aus der Datenbank Prometheus ein Detail raus, damit ihr die Malweise vernÞnftig sehen kÃķnnt.

Paul CÃĐzanne: L’Oncle Dominique en avocat (1866), Ãl auf Leinwand, 65 x 54 cm, MusÃĐe d’Orsay, Paris (Detail).
Der Dozent meinte, dieses Bild sei im Pariser Salon vermutlich nur als Provokation eingereicht worden; CÃĐzanne musste klargewesen sein, dass er damit keine Chance gegen die braven Akademiemaler hatte.
—
Nach der Uni schaffte ich es noch, mir BÞcher aus der Bibliothek zu holen und zu Packstation und Supermarkt zu radeln, ohne einen Unfall zu bauen. Zuhause fiel ich dann aber doch ins Bett.
Abends in netter Gesellschaft Pasta mit Bohnen, Brokkoli und Erbsen und einer Kracherzitronenbutter mit Knoblauch.
âDas kann man nicht performen. Das muss man leben.â
(Ja, danke auch, Decar. Ich les jetzt alles von dir nach.)
—
Tagebuch, Samstag, 5. Mai 2018 â Alleine sein
Immer noch schlechte Laune. Bzw. immer noch wÞtend und traurig gleichzeitig. Ich weiÃ, wo die Wut und die Traurigkeit hinmÞssen, aber ich kriege sie noch nicht an ihr Ziel. Aber: Mal wieder die Erkenntnis gehabt, dass ich inzwischen alt genug bin, um zu wissen, was mit mir los ist. Ich bin allerdings anscheinend immer noch nicht alt genug, um damit zielgerichtet umzugehen. Oder noch nicht alt genug, um es einfach auszusitzen, denn irgendwann ist es auch wurscht.
Wenn ich so drauf bin, muss ich alleine sein. Daher fuhr ich nicht nach Augsburg zum letzten Heimspiel der Saison. Stattdessen habe ich mich Þber nette und aufmunternde Mails gefreut, vor allem Þber eine, die mit diesem Comic versehen war, der mich sehr zum Lachen bringen konnte. Well played und DankeschÃķn.

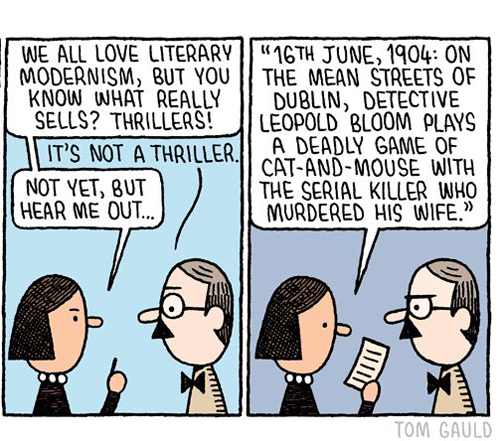
—
Was schÃķn war, Mittwoch, 2. Mai 2018 â Noch mehr EichhÃķrnchenpinsel!
In der ersten Sitzung der Vorlesung Þber Materialien der modernen Kunst erwÃĪhnte der Dozent die EichhÃķrnchenpinsel bereits, ich schrieb darÞber. Gestern gab es nun eine ganze Sitzung nur zum Werkzeug Pinsel, worÞber ich immer noch grinse. UniversitÃĪten. So much fun!
Wir stiegen wieder mit den EichhÃķrnchenpinseln ein, die mit ihrer Weichheit einen Gegensatz zum Borstenpinsel bildeten. Dieses Mal habe ich mir auch endlich die schÃķne Quelle gemerkt, aus der die Info stammte, dass man fÞr einen Pinsel acht EichhÃķrnchenschwÃĪnze brauchte. Das BÞchlein Trattato della pittura von Cennino Cennini wurde um 1400 verÃķffentlicht; hier gibt es eine deutsche Ãbersetzung von 1871, die ihr online bei meiner geliebten Stabi lesen kÃķnnt. Auf Seite 41 beginnt der kurze Abschnitt zu den Puschelpinseln und wie man sie herstellt (bis zu Abschnitt 66 springen und dann eine Seite zurÞckblÃĪttern). Die Ãberschrift sagt schon alles: âAuf welche Art man Pinsel vom EichhÃķrnchenhaar macht.â Und so geht’s weiter:
âIn der Kunst bedarf man zweier Gattungen Pinsel: nÃĪmlich von EichhÃķrnchenhaar und solche von Schweinsborsten. Jene vom EichhÃķrnchen macht man folgender Art: nimm die SchwÃĪnzchen vorn EichhÃķrnchen (denn keine andern taugen dazu) und diese SchwÃĪnzchen mÞssen gekocht, nicht roh, sein. Die KÞrschner werden dir davon sagen. Nimm ein solches SchwÃĪnzchen, ziehe vorerst die Spitze heraus, weil deren Haare lang sind und vereinige die Spitzen mehrerer SchwÃĪnze, so dass sechs oder acht Spitzen dir einen weichen Pinsel liefern, tauglich zum Aufsetzen des Goldes auf die Tafel […].â
Falls ihr von Craft Beer und PalettenmÃķbeln gelangweilt seid, aber gerne bastelt â wie wÃĪr’s damit?
Der Dozent erwÃĪhnte eine Anekdote, die von Giotto Þberliefert ist. Der gute Mann wurde eines schÃķnen Tages von einem Wildschwein umgerannt, und als er sich wieder aufgerappelt hatte, hÃĪtte er gesagt, passt schon, mit den Borsten dieser Tiere habe ich viel Geld verdient und ihnen nicht mal zwischendurch eine Kelle BrÞhe gespendet als DankeschÃķn.
Generell ging es in der Sitzung um den Unterschied des Farbauftrags von Haar- und Borstenpinseln. Auch noch nie darÞber nachgedacht: Einige Maltechniken wurden erst durch bestimmtes Werkzeug mÃķglich. Der sehr pastose Farbauftrag von Goghs zum Beispiel war erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mÃķglich, weil es zu dieser Zeit bereits flache Borstenpinsel gab statt der bisher rundlichen Spitze. Wenn ihr hier mal den oberen Teil der Vase der guten alten Sonnenblumen vergrÃķÃert, seht ihr sehr deutlich die flachen Borstenstriche, die ein Haarpinsel oder auch ein abgerundeter Borstenpinsel nicht hÃĪtten erzeugen kÃķnnen. So dient diese Materialkunde auch der Datierung von Kunstwerken.
Gerade die franzÃķsischen Realisten des 19. Jahrhunderts nutzten Tierhaarpinsel, um Fellstrukturen darzustellen; der Dozent verwies auf Courbets Durchgehendes Pferd. Ich mag es, wenn Dozierende sich auf Kunstwerke beziehen, die vor Ort hÃĪngen, denn dann kann man dank des schÃķnen Studiausweises nach der Vorlesung mal kurz umsonst ins Museum hÞpfen und sich die Bilder im Original anschauen. Wobei ich Þber das olle Pferd immer eher grinse als bewundernd davorzustehen.
Dann ging es um den Dachshaarpinsel, der im FranzÃķsischen mit der gleichen Vokabel bezeichnet wird wie ein Rasierpinsel (und der Dachs selbst): blaireau. Der Dachshaarpinsel sieht dem Rasierpinsel sehr ÃĪhnlich, und mit seinen dicken, runden, weichen Haaren glÃĪtteten gerade die Salon- oder Akademiemaler ihre BildoberflÃĪchen, bis kaum noch Arbeitsspuren vorhanden waren (also genau das Gegenteil von Courbets Pferd). Diesen Vorgang nennt man dementsprechend blaireautage oder poli bzw. fini â der letzte Schliff, die Politur. Oder wie wir heute sagen wird: Photoshop. Ingres, den ich bisher sehr mochte, der mir aber durch diese Vorlesung immer unsympathischer wird, meinte, dass dieses GlÃĪtten absolut notwendig sei, denn die OberflÃĪche zeige sonst die Hand des KÞnstlers und nicht seinen Geist.
Von Jean-LÃĐon GÃĐrÃīme, einem typischen Akademiemaler, erzÃĪhlte der Dozent die Anekdote, dass er seinen SchÞlern verboten habe, ihre Studien zu glÃĪtten, denn sonst sei die wichtige Kopfarbeit nicht mehr zu sehen. Die fertigen Werke seien aber ungeglÃĪttet bloà nicht der Ãffentlichkeit zuzumuten. Das GlÃĪtten von Studien verglich GÃĐrÃīme, und hier erwÃĪhnte der Dozent das wichtiges Stichwort âGender-Aspektâ, mit NÃĪhen, Sticken, ÞberflÞssiger Frauenarbeit eben. Er sprach auÃerdem Þber einen Vergleich, der die Kunstwelt etwas verlÃĪsst: In privaten RÃĪumen kann man rumlaufen wie man mÃķchte, aber wenn man vor die TÞr geht, wenden die meisten von uns dann doch ein wenig oder auch irrwitzig viel Energie darauf auf, wie man sich anderen Menschen prÃĪsentiert. Das Stichwort the finished gentleman entspringt diesem Gedanken und verweist wieder auf das finish an Bildern.
Von GÃĐrÃīme sahen wir Þbrigens dieses Bild in der Vorlesung. Ich kannte von ihm bereits den Klassiker Phryne vor den Richtern, bei dem ich jedesmal von der Dramatik und Dynamik und dem Zusammenspiel von Rot und Blau begeistert bin, bis ich mit den Augen rolle, weil halt nackte junge Frau vor vielen Kerlen schnarch ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich hatte von ihm auch schon den SchlangenbeschwÃķrer gesehen, bei dem es uns in der Seminar-Diskussion um die Darstellung des Orients durch westliche Augen ging. Und wir haben uns lange an der ausgeprÃĪgt detailliert dargestellten Architektur ergÃķtzt, die eine wilde Mischung aus realen Orten und kÞnstlerischer Fantasie ist.
Nach GÃĐrÃīme sahen wir einige Werke von Alexandre Cabanel, dessen Geburt der Venus eins meiner persÃķnlichen Hassbilder ist, weil siehe oben (AUGENROLLEN). Auch Cabanel glÃĪttete wie bescheuert, und van Gogh soll gesagt haben, je mehr Bilder er von Cabanel sehe, desto mehr drÃĪnge es ihn zum pastosen Farbauftrag. Ich musste allerdings feststellen, dass ich einige Bilder von Cabanel doch mochte, zum Beispiel das PortrÃĪt der Duchesse von Vallombrosa, wo ich die verkÞnstelte Handhaltung spannend fand. Ich habe leider keine groÃe Abbildung gefunden, aber die rechte Hand mit ihren Adern hÃĪtte ich stundenlang anschauen kÃķnnen. Oder das PortrÃĪt der Comtesse de Koller. Beiden Bildern wurde von der Kritik das GlÃĪtten, die blaireautage, vorgeworfen, wÃĪhrend Liebhaber dieses Stils meinten, die Zartheit oder Unversehrtheit der adligen Haut kÃĪme so noch besser zur Geltung. Anders ausgedrÞckt: Man sieht ihnen an, dass sie den ganzen Tag rumsitzen kÃķnnen und nie irgendein Werkzeug in die Hand nehmen mÞssten, was womÃķglich Muskeln oder Blasen erzeugen kÃķnnte. Gerade bei Damen ja ganz schlimm.
Die Kritik erfand auch ein Schimpfwort fÞr diese zugepuschelten Bilder bzw. ihre SchÃķpfer: blaireauteur! Das Þbernehme ich sofort in meinen Wortschatz. Wann immer mir demnÃĪchst blutleere, totgepostete, langweilige Kunst Þber den Weg lÃĪuft, werde ich innerlich âAlles Dachshaarpinselmaler!â denken. Denn nicht fÞr die Uni, sondern fÞrs Leben lernen wir.
—
Tagebuch, Samstag/Sonntag, 28./29. April 2018 â Sternenstaub und Spargel
Am Freitag im Biergarten fragte mich der ehemalige Mitbewohner, ob ich Lust hÃĪtte, ihn am Samstag Mittag zur ErÃķffnung der ESO Supernova zu begleiten, er hÃĪtte da zwei Tickets fÞrs Planetarium geschossen. Ich so: âESO? Was fÞrn Ding? Nie gehÃķrt.â Aber wenn man schon so freundlich gebeten wird, dann geht man natÞrlich mit. Zuhause googelte ich erstmal, wohin ich Samstag fahren mÞsste: hierhin.
Samstag bestieg ich die U6 und fuhr erstmals bis zur Endstation Garching Forschungszentrum. Oder anders: drei Stationen weiter als bis zur Allianz-Arena, was bisher immer mein Endpunkt gewesen war. Ein paar Frankfurter und FCB-Fans waren schon an Bord, aber sonst war es leer und ruhig und ich konnte endlich mal wieder in der U-Bahn lesen, was sich in MÞnchen fÞr mich sonst nie lohnt, weil alle Wege so kurz sind.

Die 400 Meter FuÃweg durch die fiese Mittagshitze Þberstand ich gut, ich war wie seit Wochen brav dick mit Sonnencreme bestrichen. Noch kein Sonnenbrand in diesem Jahr, nicht mal im Stadion, wo-hoo! Am Supernova-GebÃĪude warteten bereits der ehemalige Mitbewohner und mit ihm noch so dreiÃig, vierzig Menschen, die wie wir zu den ersten gehÃķren wollten, die sich dieses neue Ding anschauen konnten. Um Punkt 12 Ãķffneten die TÞren, eine freundliche Dame wies uns auf die âPicknick-Areaâ und die Garderobe im Untergeschoss hin, erklÃĪrte, wo die online erworbenen Tickets, fÞr die man einen Code zugeschickt bekommen hatte, nun ausgedruckt werden konnten … und weiter habe ich nicht zugehÃķrt, denn wir stratzten sofort zum Drucker, bevor alle anderen Menschen das auch wollten. Ich glaube, es gab nur zwei Drucker, an denen man die Planetariumskarten ausdrucken konnte, was ich ein bisschen unterdimensioniert finde, wenn es denn so ist. Man konnte auch nicht einfach sein Handy auf den Touchscreen legen und lustig losdrucken, sondern musste den Code abtippen. Kein irrer Aufwand, aber es wunderte mich doch. Um uns herum wuselte ein dreikÃķpfiges Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks, und als mir das auffiel, verfluchte ich meine Sonnencreme dann doch. Ich hoffe, ich glÃĪnze nicht zu sehr in irgendwelchen Abendschauen.
Eigentlich braucht man fÞr die Ausstellung, die sich in einer Spirale vom Erdgeschoss ins zweite Obergeschoss windet, noch ein Ticket, aber wir dachten uns, dass das heute vermutlich egal sei und gingen einfach mal durch, wÃĪhrend sich eine Schlange am Drucker bildete. Wir hatten nicht irre viel Zeit, denn die Show im Planetarium sollte bereits um 12.30 Uhr losgehen, daher sind meine EindrÞcke sehr verkÞrzt und vermutlich nicht ausgewogen.
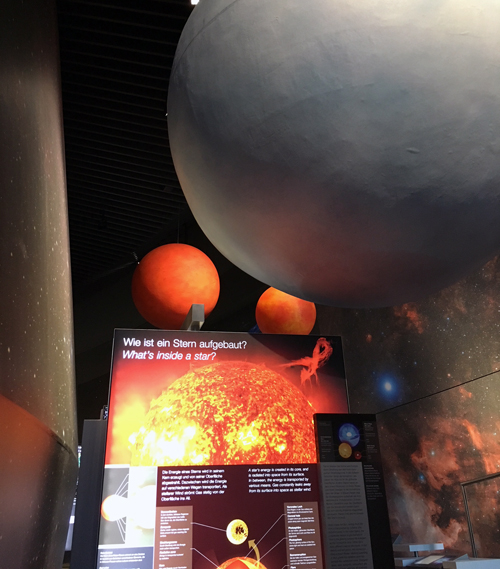
Generell merkte man der Ausstellung an, dass sie versuchte, es allen Besucher*innen recht zu machen â was vermutlich die Schwierigkeit bei dieser Art Museum ist. Es soll nicht zu simpel sein, damit die Erwachsenen sich nicht langweilen, aber auch nicht zu kompliziert, damit die Kinder nicht quengeln. Man wird erstmal von einer Menge, und ich meine einer Menge, Schautafeln erschlagen. Darauf habe ich meist drei TextblÃķcke wahrgenommen: Oben wird man ins Thema reingeholt und zwar schlauerweise mit einer Frage, zum Beispiel (ich zitiere aus dem Kopf, also vermutlich falsch): âWie entstehen Gezeiten?â Erster Gedanke bei mir: Ha, weià ich. Zweiter Gedanke: Ãhm, aber so ganz genau dann auch nicht. Mal die Tafel durchlesen. Alleine fÞr die Formulierung als Frage gibt’s von mir einen didaktischen Daumen nach oben.
Die Antworten auf die Frage waren dann quer Þber die Tafel verteilt: einmal in ÃĪuÃerst knappen Texten, die groà gedruckt waren, und dann rechts an jeder Tafel kleiner gedruckt, aber ausfÞhrlicher. Man konnte also schÃķn im Vorbeigehen was lernen, aber wenn man mehr wissen wollte, konnte man auch mehr lesen. Auch das fand ich recht clever gemacht. Allerdings waren einige der Tafeln nicht optimal beleuchtet, so dass ich manchmal Schwierigkeiten hatte, die Texte zu entziffern, gerade die lÃĪngeren. Aber: Ich habe brav was gelernt. Auf einer Tafel stand die Frage âBestehen wir aus Sternenstaub?â und die Antwort âFast jedes Atom, das schwerer als Wasserstoff oder Helium ist, wurde durch nukleare Reaktionen im Inneren von Sternen erzeugt. Das gilt auch fÞr die Atome im menschlichen KÃķrper.â Wir bestehen wirklich aus Sternenstaub! Hach! I feel so special now!
Bei der englischen Ãbersetzung, die stets gleich mit auf den Tafeln steht, stutzte ich aber des Ãfteren, gerade bei der Sternenstaub-Tafel. Dort lautete die Frage in der Ãberschrift nÃĪmlich: âAre we made of starstuff?â, was ich doof Þbersetzt fand. Inzwischen habe ich mich aber schlau gegoogelt und weiÃ: Das ist ein Zitat. Trotzdem habe ich an der Tafel was zu meckern, denn die englische Ãbersetzung des Kurztextes ignoriert den zweiten deutschen Satz und schreibt nur was von âevery atom in the universeâ usw. Damit fehlt mir so ein bisschen die schÃķne Conclusio, aber das mag Texterinnengemecker sein.

Netterweise gibt es nicht nur Tafeln zum Lesen, sondern auch Dinge zum Anfassen. Mit sowas kriegt man mich ja immer, anfassen ist super. Ich kann jetzt behaupten, einen Meteoriten angefasst zu haben und zwei Kilo auf dem Jupiter angehoben zu haben. Letzteres ist vermutlich erklÃĪrungsbedÞrftig: Auf einer Reihe kleiner Tische standen blaue Gewichte, auf denen â2 kgâ stand. Aber: Sie waren nicht alle zwei Kilogramm schwer. Je nachdem, auf welchem Planeten unseres Sonnensystems man sich befindet, wiegen zwei Kilo eben nicht mehr zwei Kilo. Und so hob ich entspannt wenige hundert Gramm hoch, als ich auf dem Mond war, und ÃĪchzte, als ich auf dem Jupiter das blaue Ding hochheben sollte. Simpel gemacht, aber lustig. Auf jeden Fall lustiger als die vielen Touchscreens, die ich eher langweilig fand.
Hier steht noch mehr zur Ausstellung und ihren Themen.

Damit war ich auch schon durch, denn die Show im Planetarium begann. Die erste Schwierigkeit war, meinen Sitzplatz zu finden; wenn in der Abendschau eine Dame zu sehen ist, die ihre iPhone-Taschenlampe aktiviert und auf den Knien vor der ersten Reihe rumrutscht, um die Nummern auf den Sitzen zu entziffern â das wÃĪre dann ich, latent schlecht gelaunt wegen so einem KleinscheiÃ. Als ich den Sitz gefunden hatte, merkte ich mir fÞr den nÃĪchsten Besuch: ein Nackenkissen mitbringen und nicht ganz vorne sitzen. Ich sah im Laufe des Films immer nur gut ein Drittel der Leinwand Þber mir, und das Umdrehen war unbequem und brachte mir auch nicht irre viel mehr Erkenntnis.
Die ersten zehn Minuten waren ein Live-Vortrag, wo uns der Nachthimmel Þber Garching am Samstag vorgespielt wurde; wir sahen den GroÃen Wagen â das einzige Sternbild, das sogar ich Blindfisch finde â und in der VerlÃĪngerung den Polarstern sowie das Sternbild des LÃķwen (wÞrde ich nicht wiederfinden). Mit dem Kopf schrÃĪg im Nacken sah ich dann noch die Leier und den Schwan â wÞrde ich auch nicht wiederfinden, fand ich aber lustig, wirklich den Himmel zu sehen, der Þber mir wÃĪre, wÃĪre ich um 4 Uhr morgens nochmal nach Garching rausgefahren.
Dann begann ein ca. dreiÃigminÞtiger Film, der vom Soundtrack her von Pro7 produziert hÃĪtte sein kÃķnnen. Drama, baby! Wir hÃķrten etwas Þber Sternbeobachtung in der Antike (dabei wurde kurz eine von Raffaels Stanzen im Vatikan eingeblendet â die mit PtolemÃĪus â, was mich sehr freute, denn sie gehÃķren mit zum SchÃķnsten der Kunstgeschichte, das ich kenne), dann arbeiteten wir uns vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild vor, streiften kurz die bemannte Raumfahrt und erfuhren schlieÃlich noch lustige Dinge Þber die einzelnen Planeten in unserem Sonnensystem. Wobei weder Taikonauten noch Kosmonauten erwÃĪhnt wurden, so nebenbei. Bis hierhin fand ich den Film okay, wobei auch hier schnell klar wurde, dass man es irgendwie allen recht machen wollte. Ich weià nicht, ob die vielen Kinder im Raum alles verstanden haben, aber vielleicht freuen die sich einfach nur Þber lustige Bilder in der Halbkugel Þber ihnen. Nach dem Sonnensystem kam dann die MilchstraÃe dran und der Big Bang … und dann drifteten wir ab in spezifische ErklÃĪrungen Þber Spiralsysteme und Sternhaufen und ab da hatte mich der Film verloren. Ich wusste nicht mehr, wo wir eigentlich hinwollten und was ich mit diesen Infos machen sollte, die mir vorher noch recht logisch aufgebaut schienen. Ich kann mich auch an das Ende nicht wirklich erinnern, vermutlich, weil es kein richtiges Ende war. Nur so halb glÞcklich ging ich aus dem Saal und verabschiedete mich vom Mitbewohner, der nochmal durch die Ausstellung wollte. Wollte ich nicht, kann ich aber bis zum Jahresende noch fÞr lau nachholen, danach kostet der Spaà Geld.
—
Nach dem Ausflug in die MilchstraÃe ging ich schnÃķde einkaufen, ich wollte fÞr Sonntag Spargel haben. Wie schon vor einigen Tagen ging ich dazu in die Futterabteilung vom Karstadt am Nordbad, denn der Spargel hatte mir ausgezeichnet geschmeckt. Dieses Mal war nicht nur eine QualitÃĪt vorhanden, sondern es standen Kisten mit den Beschriftungen I bis III herum, und die Erzeugerin saà selbst dahinter und wog ab. Vor mir suchte eine Dame sich mehrere Stangen aus der IIIer-Kiste aus, lieà sie abwiegen und ging ein paar Schritte weg. WÃĪhrend ich mich an der Ier-Kiste bediente, zÃĪhlte sie ihr Portemonnaie durch und bat die Erzeugerin, ihr doch noch zwei Stangen in ihre TÞte dazuzulegen. Sie lieà es erneut abwiegen und bat um noch zwei Stangen. Mir fiel wieder einmal ein, dass andere Menschen mehr als ich auf Euro und Cent achten mÞssen, wenn es um NahrungsmitteleinkÃĪufe geht. Ich freute mich, dass die Dame sich augenscheinlich freute, sich vier Stangen Spargel mehr leisten zu kÃķnnen als vielleicht geplant, war aber gleichzeitig auf einmal sehr kleinlaut, als ich mein Kilo zur Kasse trug, das ich mir hatte einpacken lassen ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wieviel es wohl kosten wÞrde.
—
Den Rest des Tages verbrachte ich vor der Bundesliga oder mit Buch und Zeitung auf der Couch. Ich hatte in den vergangenen Tagen immer nur das Politik-Buch der FAZ geschafft, nun las ich eine Woche Feuilleton und Wirtschaft nach.
—
Sonntag wollte ich eigentlich am Vormittag in die zweite Ausstellung gehen, die wir fÞr Fehlfarben besprechen, hatte dann aber doch mehr Lust auf einfach zuhause bleiben. Das tat ich dann auch. Viel gelesen, abends in netter Gesellschaft Spargel, Bratkartoffeln, Schinken, Hollandaise und Riesling genossen, ich Sternenstaubkind, ich.
—
Tagebuch, Mittwoch, 25. April 2018 â MITTWOCH! Und Paletten
Mein Hamburg-Trip sollte eigentlich bereits am Montag mit der RÞckfahrt zuende gehen, aber durch die kleine Ãberraschungsparty am Montagabend hatte ich den Zug fÞr Dienstag umgegebucht. Mir war das auch durchaus klar, dass das Dienstag war, denn ich wimmerte innerlich ein bisschen rum, dass ich die schÃķne Fotografie-Vorlesung verpassen wÞrde. Gestern sah ich dann die zweite Sitzung der Vorlesung Þber die Materialien der modernen Malerei, wusste also offensichtlich, dass es Mittwoch war â aber anscheinend nur bis zum Ende der Vorlesung. Danach dachte ich, es sei Dienstag und verpeilte alle Termine, die ich fÞr Mittwoch gemacht hatte, was ein paar hektische Mails und ein zweimal begonnenes Telefonat zur Folge hatte. (âAch, das ist HEUTE?â â âSoll ich in zehn Minuten nochmal anrufen?â â âIn fÞnf reicht auch.â *wirbel, kurze Hektik*)
Ich kann die lustige WundertÞtenvorlesung gar nicht wÞrdig wiedergeben, weil es so viele interessante Einzelheiten waren; ich verweise einfach auf die lange Publikationsliste des Dozenten und werde mich im ZI wohl mal ein bisschen abseits meines Diss-Themas einlesen.
Ich fand aber schon den Anfang der Sitzung erhellend, in der es um Paletten ging. Der Dozent zitierte Frank Stella, der den Beginn der modernen Malerei â also die Befreiung der Farbe von der GegenstÃĪndlichkeit â damit verband, dass die Palette ihren Status als Werkzeug verlor und nicht die Leinwand, wie anderswo geschrieben wurde. Dann ging es um die manchmal fast intime Verbindung von Malern mit ihren Werkzeugen, die der von Musiker*innen ÃĪhnelte. Einen Buchtipp habe ich mir notiert: Karin Nohr â Der Musiker und sein Instrument, wobei der Dozent bemÃĪngelte, dass sich das Buch sehr mit zeitgenÃķssischen Musiker*innen befasste und wenig historisiere; der Topos dieser Beziehung sei schon ÃĪlter. In der Malerei gebe es dagegen kaum derartige Beschreibungen; meist werde die Malerei generell als Konkurrentin zu einer realen Frau gesehen, aber nicht die Werkzeuge. Wenn Þberhaupt, sei die Leinwand die Partnerin, mit der ein SchÃķpfungsakt vollzogen werde, wobei der Pinsel â auch aus dem Wortstamm heraus â gerne als Penis gedeutet wird. Dieses Exlibris fÞr Manet von FÃĐlix Braquemond zeigt das sehr eindrÞcklich. (Ich schwankte hier wie immer zwischen Augenrollen und fasziniertem ZuhÃķren.)
Dann ging es um die Palette an sich, die, wie mir neu war, nicht nur als Werkzeug zum Farbenmischen diente, sondern auch durchaus als Untergrund fÞr Malerei. Ich lernte den Sammler Georges Beugniet kennen, dessen Palettensammlung leider Anfang des 20. Jahrhunderts in Einzelteilen versteigert wurde; ein Auktionskatalog zeigt immerhin noch einige Exemplare. Der Link fÞhrt zu einem Aufsatz des Dozenten, den wir gestern in AuszÞgen vorgetragen bekamen, bitte einfach bei Google weiterlesen. Echt jetzt! Interessant! Mit Bildern! Zum Beispiel von Paletten, die als Malgrund dienten. Auch hier wurden gerne unbekleidete junge Damen aufs Holz gepinselt und ich rollte wieder mit den Augen. Jungs! Gibt’s echt nichts Spannenderes? Ich kann euch ja verstehen, wir sind super, aber meine GÞte! Das 19. Jahrhundert macht mich fertig mit seinen rÃĪkelnden, lasziv gestreckten Akten. Ich war irgendwann sehr dankbar fÞr die Wald- und Landschaftsbilder, die wir auch zu sehen bekamen.
Ich fand die GegenÞberstellung von zwei Paletten und ihren Nutzern dann bildlich sehr schÃķn. Wir sahen SelbstportrÃĪts von CÃĐzanne und Van Gogh mit ihren Paletten, und auf der Folie befanden sich auch zwei Abbildungen ihrer Paletten, deren Farbigkeit sich in den Werken wiederfindet. Ich lernte auÃerdem James McNeill Whistler kennen, dessen PortrÃĪt seiner Mutter ich kannte, dessen Namen ich mir aber nie gemerkt hatte.
AuÃerdem mochte ich die vielen Bilder der Paletten von Delacroix, der angeblich teilweise monatelang an der richtigen Farbmischung fÞr seine Werke tÞftelte, bevor er den ersten Pinselstrich ausfÞhrte. Ich musste an heutige PantonefÃĪcher denken und die Farbkarten, mit denen man sich im Baumarkt Wandfarben anmischen kann. Mir fielen auch auf einmal die vielen Paletten ein, die ich auf Bildern von Anselm Kiefer (zum Beispiel Palette, 1981) oder Markus LÞpertz (zum Beispiel Palette â dithyrambisch III, 1974) gesehen hatte. Bei Kiefer hatte ich die immer als vagen Hinweis auf Malerei verstanden, musste mich aber nie mit einem bestimmten Werk befassen. FÞr meine Masterarbeit schrieb ich immerhin Þber ein Bild von LÞpertz, in dem eine Palette zu sehen war, fÞhrte diese aber als Referenz an alte Stillleben an. Ãber die Palette als Werkzeug, als intimer Gegenstand, als Vorbereitung fÞr ein GemÃĪlde habe ich noch nie nachgedacht.
Auch so nebenbei gelernt: das franzÃķsische Wort fÞr Steckenpferd bzw. Hobby: violon d’Ingres. Ich weià nicht mehr, wie der Dozent darauf kam, vermutlich waren wir wieder bei Linie versus Farbe bzw. Ingres versus Delacroix (ich schrieb darÞber). Jedenfalls spielte Ingres gerne Violine und warum auch immer hat sich dieser Begriff im FranzÃķsischen fÞr Hobby durchgesetzt. FÞr mich hat das bekannte Bild von Man Ray mit diesem Titel jetzt noch mehr einen seltsamen Unterton. Hier konnte ich aber wieder eine schÃķne Querverbindung ziehen: Das Model, das im Text vom Getty Museum nur als âKikiâ bezeichnet wird, war Kiki de Montparnasse, Þber die ich gerade bei Philipp Blom in seinen Zerrissenen Jahren gelesen hatte.
—
Tagebuch, Samstag bis Montag, 21. bis 23. April 2018 â Ãberraschung!
Am Samstag morgen setzte ich mich in den Zug nach Hamburg, musste mir aber verkneifen, davon auf Twitter oder Instagram zu erzÃĪhlen. Denn am Montag hatte meine beste Freundin Geburtstag, und die sollte mit der Anwesenheit von ein paar Menschen, inklusive meiner Wenigkeit, Þberrascht werden. Ich war netterweise sowieso in der Stadt, weil am Sonntag mein Patenkind konfirmiert wurde und musste daher nur das Hotel um eine Nacht verlÃĪngern und einen anderen Zug fÞr die RÞckfahrt buchen.

Normalerweise fliege ich lieber als fÞnfeinhalb Stunden im Zug zu hocken, aber dieses Mal waren die Preise so dermaÃen unterschiedlich, dass ich mir dachte, pfft, ich habe eine Zeitung, ein Buch, einen Liter Kaffee und Noise-Cancelling-KopfhÃķrer, bring it on. Und wer hÃĪtte es gedacht: Die Fahrt verlief sehr entspannt. Beim Reservieren des Platzes in der ersten Klasse sah es so aus, als wÃĪre der ganze Waggon fast ausgebucht, aber bis WÞrzburg saÃen gefÞhlt nur 15 Leute um mich herum (und alle schÃķn verteilt), bis Kassel wurde es dann etwas voller, und ab GÃķttingen war es wieder leer. Ich hatte einen Zweiersitz, denn ich konnte keinen einzelnen mehr reservieren, aber neben mir blieb es die ganze Zeit frei. So konnte ich entspannt mal aufstehen, eine halbe Stunde zwischen den Waggons im Stehen lesen, musste niemanden stÃķren, wenn ich aufs Klo wollte und bekam im Laufe der Zeit vom freundlichen Service drei Mars mini angereicht. (Schokolade im Zug ist immer besser als GummibÃĪrchen im Zug.)
In Kassel dachte ich, hey, der Bahnhof kommt dir irgendwie bekannt vor, bis mir einfiel, dass ich ja im letzten Jahr auf der documenta war.
Irgendwo zwischen GÃķttingen und Hannover schickte ich F. ein Bild, das ich mit âNiedersachsen (Symbolbild) #flatearthâ und einem Herzaugenemoji taggte. So irre ich Berge immer noch finde, so beruhigend ist es, sie nicht mehr zu sehen.
Die FAZ war ausgelesen, auf mein Buch hatte ich auch keine Lust mehr, also setzte ich die KopfhÃķrer auf und hÃķrte fiesen alten DDR-Pop auf Spotify (WLAN funktionierte tadellos), was mich aber in eine seltsame Stimmung versetzte. Das ganz alte Leben irgendwie.
Es ist komisch, durch Hannover durchzufahren, wo ich dort jahrelang ein- oder ausgestiegen bin.
In Eschede blÞhen die KirschbÃĪume. Auch schon wieder 20 Jahre her.
Zum dritten Mal in diesem Jahr war ich im gleichen Hotel in BahnhofsnÃĪhe. Reicht dann jetzt auch. Es fÞhlte sich nicht wie Urlaub oder Arbeit an, sondern irgendwas mittendrin. Dass ich abends dann mit Kai im Trific saÃ, war im Nachhinein betrachtet, auch nicht ganz so clever. Die komische Stimmung hielt an, und als ich ihn zum Abschied umarmte, war ich endgÞltig durch. Beim letzten Mal hatten sich meine HÃĪnde noch an ihn erinnert, er fÞhlte sich an wie er sich immer angefÞhlt hatte, aber Samstag war es anders, da hatten meine HÃĪnde ihn vergessen. Und so gut es ist, dass wir Freunde sind, so traurig war ich sinnloserweise darÞber.
Obwohl die lange Nacht der Museen mir die MÃķglichkeit gegeben hÃĪtte, noch den Gainsborough in der Kunsthalle anzuschauen, fuhr ich ins Hotel und ging schon um zehn ins Bett.
Aber Þber das Essen im Trific habe ich mich gefreut.

MairÞben-Carpaccio mit Chicoree, Haselnuss, Friesisch bleu und Rauch-Paprika-Ãl

Kalbs-Tafelspitz mit BÃĪrlauch-KartoffelpÞree, Fenchel und Artischocke

Kokos-CrÃĻme-brÃŧlÃĐe mit Passionsfruchtsorbet und Schokonuss-Crunch
FÞr den Sonntagmorgen hatte mich die Hotelrezeption vorgewarnt: Eine grÃķÃere Gruppe hatte ihre Shuttlebusse fÞr 9.30 Uhr bestellt â vielleicht das eigene FrÞhstÞck so planen, dass man nicht gerade in die Masse gerate? Danke fÞr den Hinweis. Ich lieà den Wecker um 7 klingeln, obwohl ich erst gegen 10 beim Patenkind sein musste und konnte so entspannt MÞsli und Kaffee genieÃen und mich danach ebenso entspannt aufhÞbschen. Da ich wusste, dass wir zu Fuà zur Kirche gehen wÞrden, hatte ich mein Outfit auf das bequeme Schuhwerk abgestimmt und war dementsprechend in dunkelblauen Schuhen, schwarzer Bluse, schwarzer Hose und dunkelblauem Blazer gewandet. Und ohne dass wir uns abgesprochen hatten, war der Rest der kleinen Festgesellschaft auch mit irgendwas bekleidet, in dem Blau, Weià und Schwarz vorkamen. (KÃķnnte auch ein letzter Hoffnungsschrei in Richtung des HSV gewesen sein.)
An der Kirche angekommen, wollte ich mir wie immer an Kirchen den BaukÃķrper und das Bildprogramm im Inneren anschauen, hatte aber natÞrlich vergessen, dass da auf einmal Leute waren. Das kenne ich ja gar nicht mehr. Ich konnte immerhin das ÃuÃere bewundern, mich darÞber freuen, dass ich das Alter halbwegs richtig geschÃĪtzt hatte (mein Tipp war 1920, Þber dem Eingang stand das Baujahr 1912), und ich entdeckte beim Hinausgehen nach dem Gottesdienst noch zwei Glasfenster neben der EingangstÞr, die nach den vier Aposteln (1/2) von DÞrer gestaltet waren, die in MÞnchen in der Alten Pinakothek hÃĪngen. Ãber das Altarbild kann ich leider gar nicht sagen, dazu saà ich zu weit auÃen, aber das hÃĪtte ich mir gerne noch etwas lÃĪnger angeschaut.
Ich kann auÃerdem vermelden, dass ich nicht so oft geheult habe wie erwartet: Einmal als mein Patenkind vorne stand, ihr Konfirmationsspruch verlesen wurde (eindeutig der beste von allen, ist klar) und sie von der Pastorin gesegnet wurde, und ein zweites Mal beim letzten Lied. In jedem Gottesdienst gibt es ein verdammtes Lied, das mich zerreiÃt, und dieses Mal war es MÃķge die StraÃe. Kannte ich gar nicht. (OMG ich heule bei dem blÃķden YouTube-Video! Nehmt mir das Internet weg! Okay, das kÃķnnte auch daran liegen, dass es Sylt-Bilder enthÃĪlt. MISSING SYLT! Aber, hier, die Kirche im Video: nicht so vollgeballert wie die katholischen Dinger! Da braucht man keine fÞnf Stunden, um das Bildprogramm von den 40 AltÃĪren zu entziffern, nein, bei uns ist alles schÃķn aufgerÃĪumt!)
Dieser Spruch kam Þbrigens in einer Gruppe von 17 Konfirmand*innen viermal vor. Kinders! Da muss man sich doch absprechen. WÃĪhrend die ganzen SÃĪtze verlesen wurden, Þberlegte ich fieberhaft, wie eigentlich mein Konfirmationsspruch lautete. âEs sollen wohl Berge weichen und … ÃĪh … irgendwas irgendwas …. aber meine Gnade soll nicht von dir weichenâ war alles, was mir noch einfiel. Inzwischen habe ich gegoogelt und bin im Nachhinein entsetzt davon, dass ich ein Zitat mit Wortwiederholung hatte. Wenn das ein Werbetext wÃĪre, wÃĪre ich da nochmal beigegangen. Andererseits fand ich es spannend zu sehen, dass ich schon mit 14 irgendwie geborgen sein wollte. Als ich 20 Jahre spÃĪter in der Therapie saÃ, sollte ich mir aus vielen Karten eine wÃĪhlen, auf der ein Satz stand, der zu mir passt. Ich wÃĪhlte damals: âIch mÃķchte gehalten werden.â Ist mir noch nie aufgefallen, dieser kleine rote Faden in meinem watteweichen Kern.
Vor und nach der Kirche kamen die Þblichen Fotos, und ich fÞhlte mich in meiner Kleidung und in meiner Haut so wohl, dass ich nur darÞber gemeckert habe, dass wir in die Sonne gucken mussten. Das war schÃķn.
Nach dem Gottesdienst brachte uns das Catering gar wohlschmeckende Speisen, dann gab’s Geschenke, dann Kaffee und Kuchen. Der Patenonkel und ich kamen immer noch nicht darÞber weg, dass im Gottesdienst gesagt wurde, dass unsere Aufgabe nun erfÞllt sei; wir erwÃĪhnten das im Laufe des Nachmittags noch ungefÃĪhr 100 Mal, dass wir jetzt hier nur noch rumsitzen wÞrden, das Kind ist groÃ, a job well done. Onkel und ich verglichen nebenbei, was wir damals zur Konfirmation als Geschenk erhalten hÃĪtten. Er so: âIch habe eine uralte Eichendorff-Ausgabe bekommen, weil die meiner Patentante so viel bedeutete. Noch nie reingeguckt, aber ich staube sie bei jedem Umzug ab und stelle sie dann wieder ins Regal.â Ich weià nicht, ob ich mit meinen KunstbÞchern einen Eichendorff gepulled habe, aber wenn, hat das gute Kind es sich nicht anmerken lassen. Das Grafiktablett der Eltern plus gebrauchtem iMac erzeugte aber eindeutig mehr freudiges Quietschen. (Zu recht.)
Die Feier war so nett, dass ich vÃķllig vergaÃ, dass Augsburg zeitgleich spielte. F. schickte mir aber wie immer, wenn ich nicht im Stadion sein kann, ein Bild des winkenden Kids Clubs aufs Handy. Augsburg gewann gegen Mainz 2:0 und ist damit im achten Jahr erstklassig.
Gegen halb acht war ich wieder im Hotel und Þberlegte, was ich spontan noch so anfangen wollte. Wer hÃĪtte es gedacht: Ich wollte rumliegen und lesen.

Auch in der Nacht zu Montag schlief ich nicht durch, wie auch zuvor in der auf Sonntag schon nicht, keine Ahnung warum. Ich wachte in beiden NÃĪchten gegen drei Uhr auf und war dann hellwach. Anstatt mich eine Stunde sinnlos im Dunkeln rumzuwÃĪlzen, knipste ich das Licht an und las, bis ich eine Stunde spÃĪter wieder mÞde genug war, um bis zum Wecker tief und fest durchzuschlafen. Ich bin trotzdem froh, wenn ich wieder in meinem Bett liege.
Mit dem Montag konnte ich mich zunÃĪchst nicht so recht anfreunden. Die Museen, die mich interessierten, waren alle geschlossen, die geÃķffneten waren mir egal, weswegen ich den Vormittag gnadenlos mit der FAZ im Balzac an der Langen Reihe verbrachte, weil ich um die bequemen Sessel wusste und die Musik weniger nervig als beim Starbucks ist. Ich hatte zwar pflichtschuldig bei Tripadvisor nach KaffeehÃĪusern gesucht, aber auf eine altmodische Konditorei hatte ich keine Lust und auf was Hippes am Hafen auch nicht. Ich hÃĪtte gerne ein Kaffeehaus, in dem es so ruhig ist wie in einer Bibliothek, der Kaffee groÃartig und die Sitzgelegenheiten bequem, kuschelig und in groÃer Auswahl vorhanden sind. Aber ich ahne, dass mein Sofa zuhause diesem Ideal noch am nÃĪchsten kommt.
Nachmittags lungerte ich im Hotel rum, guckte Serien, tippte einen ewig langen Blogeintrag, packte meinen Koffer und freute mich so langsam dann doch auf den Abend. Auf die Menschen freute ich mich natÞrlich schon die ganze Zeit, aber ich wusste, dass wir in der Weinbar sitzen werden wÞrden, in der ich sehr oft versackt war, mit genau diesen Menschen. Eigentlich versuche ich in Hamburg immer genau in den Ecken nicht zu sein, in denen ich gelebt habe, weil ich sonst sinnloserweise wehmÞtig werde. Deswegen war das Trific auch doof, obwohl es nett war. (Ich weiÃ, ich ergebe gerade keinen Sinn.) Ich weià auch nicht, warum ich so damit hadere, wieder hier zu sein. Vielleicht weil die Stadt nicht so durchgespielt ist wie Hannover, da ist wirklich nichts mehr, was mich mit meinem frÞheren Ich verbindet. Aber hier zerrt gerade etwas an mir und ich weià nicht was. Vielleicht weil ich zwischendurch vergesse, dass ich nicht mehr hierher gehÃķre. Gestern abend nach dem dritten Glas Wein und dem Þblichen Flammkuchen und den gewohnt lustigen und schlauen GesprÃĪchen mit meinen Herzdamen dachte ich fÞr eine halbe Sekunde Þber den Heimweg nach â âdann nehm ich den 5er, der fÃĪhrt ja lÃĪnger und dann den 20er, und wenn der nicht mehr fÃĪhrt, gehe ich halt die kurze Strecke zu Fuà nach Hau… nee, Moment.â Das war der Weg in unsere ehemalige Wohnung, den mein Kopf mir vorschlug und daraufhin musste ich noch drei GlÃĪser Wein trinken. Die sich gerade rÃĪchen, wie ich beim Tippen merke. Gut, dass ich den Rest dieses Eintrags gestern schon geschrieben habe. Ãchz. Will nach Hause.

Mach’s gut, Hamburg. Reicht jetzt erstmal, auch wenn du wirklich hÞbsch bist. (Fast Þberall.)
—
Was schÃķn war, Mittwoch, 18. April 2018 â EichhÃķrnchenpinsel
Die dritte Vorlesung, die ich mir in diesem Semester gÃķnne, solange es die Arbeit fÞr Geld und die an der Diss zulassen, hat den verheiÃungsvollen Titel âTurners Lappen, Courbets Spachtel, Pollocks Eimer â die Utensilien der modernen Malereiâ, wobei der Dozent die Moderne nach der FranzÃķsischen Revolution anfangen lÃĪsst. Als Einstieg zeigte er eine Karikatur von Richard Doyle, der sich Þber die Werkzeuge von William Turner lustig macht und Þber die ich mich seit gestern freue. (Ich mag Turner, aber ich fand das Bild trotzdem sehr passend.)

Joseph Mallord William Turner by Richard Doyle, woodcut, 1846, NPG D6996
ÂĐ National Portrait Gallery, London
CC BY-NC-ND 3.0
Auch dieser Dozent hatte gleich nach wenigen SÃĪtzen gewonnen, so wie die Dame am Dienstag, als er meinte, dass er die Klausur am Ende der Vorlesungsreihe sehr dÃĪmlich fÃĪnde (BA- und MA-Quatsch halt, die Kritik hÃķrte ich zum wiederholten Male), aber nicht weil es mehr Arbeit fÞr ihn ist, sondern weil wir als Studis dann dauernd mitschreiben anstatt zuzuhÃķren. Da hat der Mann recht, das habe ich auch zehn Semester lang gemacht: bei jedem Satz Þberlegt, ob das jetzt klausurrelevant sein kÃķnnte. VÃķlliger BlÃķdsinn. Ich hatte eine Dozentin, die am Ende jeder Stunde in fÞnf Minuten zusammengefasst hat, was sie fÞr wichtig hÃĪlt; da konnte man hervorragend zuhÃķren, weil man wusste, dass man am Ende nochmal auf dem Silbertablett serviert bekam, was man auf die LernkÃĪrtchen schreiben musste. Allerdings ist es natÞrlich auch beknackt fÞr die Dozierenden, sich sowas ausdenken zu mÞssen.
Wie der Titel der Vorlesung schon sagt, geht es um das Instrumentarium, mit dem Kunst hergestellt wird. Klingt erstmal seltsam, aber ich weià inzwischen, dass solche WundertÞtenvorlesungen fÞr mich ideal sind. So schÃķn das war, sich zum Beispiel ein Semester lang exklusiv mit CÃĐzanne zu befassen oder mit romanischer Architektur in Nordfrankreich, so viel habe ich aus Vorlesungen mitgenommen, die erstmal gefÞhlt ein irre groÃes Fass aufmachen. Meine bis heute liebste und die, bei der mir dauernd irgendwas wieder ins Hirn fÃĪllt, wenn ich irgendwo was angucke, ging Þber wichtige Ausstellungen des 20. Jahrhunderts â und da war alles dabei: fotografische Ausstellungen, GemÃĪlde, koloniale Objekte und wie sich die Diskussionen darÞber verschoben haben, die erste documenta oder grundlegende Ausstellungen wie When Attitudes Become Form (1969), die neue PrÃĪsentationsformen fÞr Kunst erarbeitete. An jeder dieser Ausstellungen hing ein Rattenschwanz an KÞnstler*innen, Ideen, Denkweisen und Theorien, so dass ich viel mehr mitnahm als ich jemals erwartet hatte.
Ich ahne, dass diese Vorlesung eine ÃĪhnliche werden kÃķnnte, denn wenn man mit dem Werkzeug beginnt, kann man daran auch an vielem weiterdenken. Gestern sprachen wir ganz grundlegend Þber den Unterschied zwischen Werkzeugen und Instrumenten. Der Dozent begann mit Ernst Kapp, dessen Organprojektion davon ausging, dass die gesamte Welt um uns herum sich am menschlichen KÃķrper orientiert bzw. eine VerlÃĪngerung oder Analogie zu ihm sei (Hammer â Hand, Fernrohr â Auge etc.). Eine Lexikon-Definion beschrieb den Unterschied zwischen Werkzeug und Instrument: Ein Werkzeug hinterlÃĪsst Spuren (MeiÃel), ein Instrument nicht (Lupe), wobei der Dozent meinte, bei einem Skalpell stoÃe diese Definition vielleicht an ihre Grenzen.
Wir hangelten uns ein bisschen durch die Geschichte von Werkzeugen und hÃķrten, dass einige mittelalterliche ZÞnfte sich einmal beim Magistrat beschwert hÃĪtten, dass Maler ihre Werkzeuge, also die der KÞfer oder Wagner, benutzten; anscheinend definierten sich Handwerke auch Þber ihre mechanischen Hilfsmittel und nicht nur Þber ihre TÃĪtigkeit. Wir sprachen Þber den Konflikt der Renaissance zwischen disegno und colore, den ich schon im ersten Semester gelernt hatte, also dem Konflikt zwischen der Umrisszeichung, die dem Geist des KÞnstlers/der KÞnstlerin entspringt und damit einen hÃķheren Wert habe als die olle Farbe, die von Gehilfen eingepinselt werden kÃķnnte. (Wolfgang Kemp hat das ganze etwas ausfÞhrlicher aufgedrÃķselt. Herrn Kemp hatte ich euch gestern schon empfohlen, von dem Mann kann man halt auch alles lesen.) Dieser Konflikt zog sich bis in die Moderne; der Dozent zeigte uns eine weitere Karikatur, bei der sich Delacroix und Ingres duellieren, jeweils mit Pinsel oder Zeichenfeder bewaffnet.
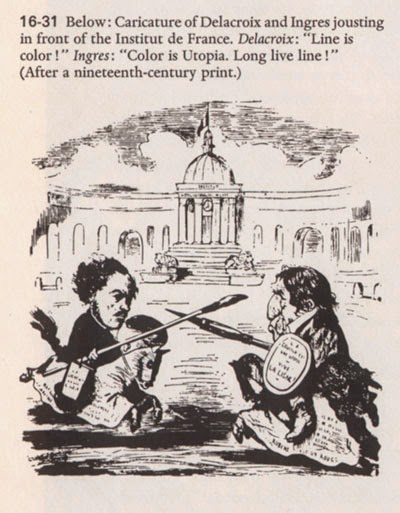
(Ich habe keine Quelle gefunden. BÃķses Internet.)
Dieser grundlegende Konflikt spiegelte sich auch in der Ausbildung von KÞnstler*innen wider: In Frankreich war man fÞr die theoretischen Grundlagen an der Akademie eingeschrieben und lernte das praktische Malen bei einem KÞnstler selbst im Atelier. Ingres war der Meinung, Malen lieÃe sich in wenigen Tagen lernen, das Wichtige sei die Zeichnung bzw. vor allem die Idee dahinter. (Ich verkÞrze hier alles strÃĪflich. Bitte gehen Sie in die nÃĪchstgelegene Bibliothek und vertiefen das selbstÃĪndig.)
Von der Ausbildung kamen wir auf die technischen Grundlagen der Werkzeuge. Hier verÃĪnderte die industrielle Revolution so einiges. Bei der Pinselherstellung merkte ich mir den vÃķllig sinnlosen Fakt, dass im Italien des 15. Jahrhundert acht EichhÃķrnchen ihre SchwÃĪnze fÞr einen Pinsel lassen mussten. Das war natÞrlich perfektes Twitter-Material, und ich glaube, das wird mein erfolgreichster Tweet in zehn Jahren, wenn man Likes und Retweets zugrunde legt. Social-Media-Managerinnen und lehrende Kunsthistorikerinnen aufgemerkt: Mit schrÃĪgem Quatsch kriegt man alle.
ZurÞck zur industriellen Fertigung: Nun konnten Borsten und Haare maschinell hergestellt werden. Die lustige Metallklammer, die man heute von Pinseln kennt, die die Haare festhÃĪlt, stammt auch aus dem 19. Jahrhundert. Und: Auch LeinwÃĪnde, FarbkÃĪsten und Paletten wurden nun Massenware, was auch dazu fÞhrte, dass viele Laien sich auf einmal in die Landschaft stellten und malten. Malen wurde bÞrgerliche Unterhaltung und Entspannung und verlor viel von ihrem Nimbus als geniale Meisterschaft. Wir sahen ein Bild eines englischen Herstellers, der zur Leinwand auf der Staffelei auch gleich den Sonnenschirm dazu anbot, der an der Staffelei befestigt werden konnte.
Auch Farben mussten nun nicht mehr mÞhselig angemischt werden. Farben, die chemische Elemente im Namen tragen, wie Chromgelb oder Kadmiumrot, sind Kinder des 19. Jahrhunderts. Marcel Duchamp, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts fÞr seine Readymades rechtfertigen sollte, meinte spÃķttisch, da Farben und Leinwand auch schon âready-madeâ seien, also vorgefertigt und nicht mehr handgemacht, sei Ãlmalerei eigentlich auch nur eine Assemblage von Readymades.
Ich saà zum Schluss mit glÞcklich-roten BÃĪckchen im HÃķrsaal, denn alle diese wunderbaren Geschichten waren genau das, was ich mir erhofft hatte: ein wilder Ritt durch verschiedene Themen, die mich alle zum Weiterdenken animieren. NÃĪchste Woche: Paletten! ÃbernÃĪchste Woche: Pinsel! Ich bin sehr gespannt und habe hoffentlich noch ein paar EichhÃķrnchenfakten parat.
—
Was schÃķn war, Freitag, 13. April 2018 â I want to thank the Academy
Auf den gestrigen Vormittag hatte ich mich schon lÃĪnger gefreut, denn die Dallmayr Academy hatte mich auf eine kurze Schulung eingeladen. Anders ausgedrÞckt: Ich habe zwei Stunden lang Espresso getrunken, weil’s so lecker war und ich werde nie wieder schlafen.

Wir tranken den Espresso Barista, der fieserweise nur fÞr die Gastronomie angeboten wird, wie der Schulungsleiter erzÃĪhlte. Der Mann kam ansonsten zunÃĪchst kaum zu Wort, weil ich dauernd total wichtige Fragen hatte, die sich mir stellten, seit ich selber wieder an einer SiebtrÃĪgermaschine stehe, wenn auch nur fÞr den Hausgebrauch: Warum ÃĪndert der Mahlgrad den Geschmack? Wie sieht die perfekte Crema aus? Wie hoch sollte der Druck beim Tampern sein? Und wie, verdammt, kriege ich diesen fiesen Milchschaum hin, um endlich ein Herz auf meinen Flat White zu malen? Wobei ich gestern auch lernte, dass ich die ganze Zeit Cappuccino mache und keinen Flat White. Ein Flat White besteht aus zwei Espressos, der Cappucchino nur aus einem. Plus Milch und Schaum und Zeug halt. Ich lernte auÃerdem, dass der Cappuccino, den ich vor 25 Jahre in der Gastro zubereitet habe, heute eher nicht mehr serviert wird â also mit der heiÃen Milch, dem riesigen fluffigen Schaumball oben drauf und womÃķglich noch mit Kakaopulver. Ein Cappuccino sieht fast so aus wie ein Flat White, hat aber nicht so viel Wums.

Aber erstmal wurde mir ein Espresso gereicht, der hervorragend schmeckte. Dann ÃĪnderte der Schulungsleiter den Mahlgrad und wir guckten, was passierte. ZunÃĪchst wurden die Kaffeebohnen grÃķber gemahlen, was zur Folge hatte, dass der Espresso viel schneller durchlief als vorher und wÃĪssrig nach kaffeeartigem Nichts schmeckte. Feiner gemahlen schien er total widerwillig und fast schwarz in der Tasse zu landen und war bitter und fies. Als Regel fÞr guten Espresso nahm ich mit: 8 Gramm Kaffeemehl fÞr einen Espresso, 16 bis 18 Gramm fÞr zwei, 90 bis 92 Grad heiÃes Wasser, das mit 9 bar Druck in 20 bis 25 Sekunden ein GetrÃĪnk zaubert. Druck und BrÞhzeit kann ich an meiner Maschine nicht einstellen, bei der Wassertemperatur bin ich mir nicht sicher, womit ich eigentlich schon verloren habe, aber ich werde mal die Stoppuhr mitlaufen lassen, wie lange mein Maschinchen eigentlich so arbeitet.
Ich lernte, wie eine gute Crema aussieht (geschlossen, haselnussbraun) und dass zu frischer Kaffee nicht schmeckt, denn direkt nach der RÃķstung enthalten die Bohnen noch zu viel Kohlendioxid, das erst entweichen muss. Ich lernte, was die Unterschiede zwischen Arabica (fruchtiger) und Robusta (erdiger) sind und dass Robusta gerne als WÞrze dazugegeben wird, weil diese Sorte dem Kaffee mehr KÃķrper verleiht. Ich lernte, was Kaffee-VarietÃĪten sind. Neben diesen ganzen Perlen der Weisheit wurden 20 TÃĪsschen Espresso und Cappuccino zubereitet und ich nippte und kostete und trank schlieÃlich ganze Tassen, denn wozu bin ich sonst hier. *hibbel*


Gerade beim MilchschÃĪumen schaute ich natÞrlich ganz genau hin und ahne jetzt, wo mein Problem liegt. Ich produziere seit 500 Espressos immer Milch mit Schaum obendrauf, aber ich brauche quasi dickflÞssige Milch. Also eine Konsistenz, nicht zwei. Vollmilch statt H-Milch ist klar; der Schulungsleiter meinte, H-Milch schmecke wie entzÞndeter Kuheuter, was ich nicht ganz so abnicken wÞrde, aber jetzt will ich nie wieder H-Milch trinken. Was ich in meinen letzten Probewochen schon festgestellt habe, meinte der Herr ebenfalls: Die MilchsÞÃe reicht vÃķllig aus, man braucht wirklich keinen Zucker mehr. FÞr diese SÞÃe darf die Milch aber nicht zu heià sein, was Þbrigens auch fÞr die Konsistenz wichtig ist. Da habe ich instinktiv (aka nach dem Anschauen von 50 YouTube-Videos) schon viel richtig gemacht: Beim AufschÃĪumen dauert die Ziehphase nur ganz kurz â also die Phase, wo man mit der Dampflanze im EdelstahlkÃĪnnchen lustige GerÃĪusche macht â, wÃĪhrend die Rollphase nur so lange dauern sollte, bis die Milch hÃķchstens 70 Grad heià wird; das KÃĪnnchen kann man noch so gerade mit der Hand anfassen, es ist aber schon spÞrbar heiÃ. All das kriege ich zuhause auch hin, aber trotzdem: Diese Fluffigkeit, die ich gestern anschauen und genieÃen durfte, scheint fÞr mich noch in weiter Ferne zu sein. Ich glaube, ich muss dringend die Barista-Schulung buchen. Oder ernsthaft in eine andere Maschine fÞr zuhause investieren, aber dagegen strÃĪube ich mich noch etwas. Die ist doch erst zwei Monate alt! Ich gebe mir noch weitere 500 Espressos und dann denke ich nochmal drÞber nach.

Ich hatte viel Spaà und habe viel gelernt, auch wenn mir das Herz dabei geblutet hat, wieviel Kaffee wir gemahlen und verwendet haben, der teilweise als schlechtes Beispiel dienen musste wie bei dem falschen Mahlgrad. AuÃerdem habe ich natÞrlich beim Latte-Art-Machen dem Schulungsleiter nie auf die Finger geguckt, sondern total fasziniert dem Bild auf der Crema, ich Hirn. So lerne ich das natÞrlich nicht. Das war fÞr gestern aber auch gar nicht der Plan, ich durfte einfach gucken und Fragen stellen. Hab ich gemacht. Ich habe seit den vielen guten Espressos vor Ort aber noch keinen weiteren zuhause angesetzt. Ich trau mich jetzt gerade nicht mehr. (Gebt mir noch einen Tag.)
Was mir auch viel bedeutet hat: dass wir Þber Nahrungsmittel als Genuss gesprochen haben. Klar ist eine SiebtrÃĪgermaschine aufwendig, aber man wird fÞr seine Arbeit, die ja eher ein Ritual ist, belohnt, man schmeckt, was man in der Tasse hat. Das ist ein anderer Schnack als das GebrÃĪu aus der 20-Euro-BÞro-Kaffeemaschine. Aber wenn einem das reicht, ist das vÃķllig in Ordnung. Wem das nicht reicht, der rÞstet halt ein bisschen auf. Selbst eine Billo-French-Press macht schon guten Kaffee, wenn man sich ein bisschen MÞhe bei der Zubereitung gibt. Es muss nicht die 10.000-Euro-Maschine sein, ein bisschen Sorgfalt und BeschÃĪftigung mit dem Produkt bringen einen schon sehr viel weiter. Das habe ich in den letzten Monaten selbst erfahren, aber ich fand es schÃķn, mit einem Kaffeeprofi darÞber zu sprechen, was fÞr ein Genuss es immer wieder ist, genau das zu tun: BeschÃĪftigung mit dem Produkt. Selbst mit so etwas AlltÃĪglichem wie dem Morgenkaffee. Es geht immer besser und es lohnt sich immer wieder.

Ich fÞge hier wie immer bei sentimentalen Futter-Blogposts meinen Hinweis auf das Foodcoaching von vor jetzt schon fast zehn Jahren ein, das mein Leben verÃĪndert hat und es immer noch weiter verÃĪndert. Ich habe noch so viel zu entdecken, und genau wie ich Donnerstag so begeistert davon war, dass mich jemand an seinen kunsthistorischen Erkenntnissen teilhaben lÃĪsst, so war ich es gestern, als es um den Mahlgrad von Kaffeebohnen ging. Es braucht echt nicht viel fÞr einen guten Tag, habe ich mal wieder gemerkt. Schlaue Menschen, gute Produkte. Und irgendwas, das nach Schokolade schmeckt, okay.
—
PS: @DonnerBella fragte neulich nach persÃķnlichen Macken und ich antwortete, dass ich damals in der Gastro gelernt hatte, dass das Etikett (auf Flaschen, GlÃĪsern, dings) immer zum Gast zeigen sollte, damit der sieht, dass er auch das richtige Bier vor sich stehen hat. Diese Art, BierglÃĪser oder Weinflaschen auf Tische zu stellen, habe ich mir auch im Privatleben angewÃķhnt; wenn ich ausgehe, drehe ich mein Glas immer so, dass ich aufs Label schaue. Gucken Sie beim letzten Foto mal, wo der Firmenname steht und von wo man das Bild auf der Crema am besten sieht. Spontane Zuneigung!
PPS: Am spÃĪten Nachmittag ein Nickerchen gemacht. Ten espressos got nothing on me.
PPPS: Diesen Blogeintrag schrieb ich bereits gestern nachmittag. Eben habe ich mir meinen Þblichen Morgenkaffee zubereitet. … Ich kaufe jetzt eine neue SiebtrÃĪgermaschine. Und eine elektrische KaffeemÞhle (sorry, Opa). Verdammt.
—
Was interessant war, 26. MÃĪrz 2018 â Tough Crowd
Am Sonntag sah ich beim FrÞhstÞck aus dem Hotelfenster drei Hasen Þber den Rasen hoppeln. Gestern rumpelte nur ein Bagger in der Gegend rum. Ich prangere das an.
—
Den Vormittag verbrachte ich im Betahaus. Ich hatte zwar die letzten Tage im Hotel gearbeitet, aber so nett (und gÞnstig) das Motel One auch ist â der lÃĪcherliche Hocker vor dem kleinen Beistelltischchen ist zum Arbeiten dann doch eher suboptimal. Also fragte ich auf Twitter, wo ich denn co-worken kÃķnne, denn alles, was ich beim Googeln fand, Þberzeugte mich nicht. Das Betahaus kannte ich sogar, aber als ich Samstag auf deren Website rumklickte, reagierte die Seite nicht, weswegen ich Þberlegte, ob es den Laden Þberhaupt noch gab. Gibt es. Er sitzt jetzt in der verranzten Schanze (missing tidy Munich!), im Erdgeschoss gibt’s Kaffee und LÃĪrm, aber im ersten Stock kann man Þberraschend ruhig arbeiten, surfen, drucken und meeten. Letzteres brauchte ich nicht, den Rest ja, und ich war um kurz vor 13 Uhr schon mit allem durch. FÞr den halben Tag zahlte ich lÃĪssige neun Euro, und alleine die gut gepflegten, blumig-duftigen Klos waren das wert.
—
Danach wollte ich mir die Schmidt-Rottluff-Ausstellung im Bucerius-Kunstforum anschauen, denn die meisten anderen Museen haben ja leider Montags zu. Den Gainsborough in der Kunsthalle hÃĪtte ich mir immerhin pflichtschuldig angucken wollen, aber irgendwie konnte ich mich an den letzten Tagen nicht zu ihm aufraffen. Google verriet mir, dass die historischen Museen Hamburgs neuerdings Montags offen haben, nur so als Tipp nebenbei. Aber ich wollte ins Kunstforum, denn da gehe ich immer gerne hin und vor allem komme ich als Kunstgeschichtsstudi umsonst rein.
Die HVV-App zeigte mir eine Verbindung mit dem 15er und dem 5er Bus zum Rathaus an. In einigen der vergangenen BlogeintrÃĪge der letzten Monate schrieb ich, dass ich Hamburg jetzt als Touristin wahrnehme. Das stimmt, wenn ich mich irgendwo rumtreibe, wo ich vorher selten oder nie war, aber gestern kam ich gefÃĪhrlich in die NÃĪhe von Orten, an denen ich tausendmal gewesen bin, als ich noch hier gewohnt habe. Da merkte ich doch einen winzigen Kloà im Hals. Ich fuhr mit dem Bus an der Galerie vorbei, in der ich Luise gekauft hatte, am Haus, in dem meine Gesangslehrerin wohnt (wohnte?), und benutzte eben den 5er, der mein Leib- und Magenbus war. Ich war froh, als ich aussteigen und wieder Touri sein konnte. Und ich weià jetzt auch wieder, dass die Ãberlegung, nicht mehr in âunsereâ alte Wohnung zu fahren, die richtige war.
Die Ausstellung durchschritt ich ziemlich zÞgig, aber interessiert. Sie haben anscheinend das halbe BrÞcke-Museum leergerÃĪumt und hier aufgehÃĪngt, was mir sehr recht war, denn so bekam ich einen schnellen Ãberblick Þber Schmidt-Rottluffs Schaffen von den Zehnerjahren bis in die spÃĪten Sechziger; auch fÞr mein Diss-Thema nicht uninteressant. Danach blÃĪtterte ich wie immer den Katalog durch und fand ein Bild, bei dem ich dachte, dass Mike Mignola es gemalt haben kÃķnnte. Toll.
—
Und abends fand dann endlich die Veranstaltung statt, fÞr die ich Þberhaupt eingeflogen war: mein Workshop bei der Texterschmiede zum Thema Weblogs. Ich bin im Nachhinein nicht ganz so glÞcklich mit meinem Auftritt, frage mich inzwischen aber auch, ob diese Unterrichtseinheit Þberhaupt was im Curriculum fÞr angehende Texter*innen zu suchen hat.
Als ich vor zwei Wochen launig twitterte âTitel steht [Weblogs. They’re awesome.], Rest schreibt sich von alleineâ, meinte ich das auch so. Aber: Im Hinterkopf hatte ich das Publikum der republica. Oder von mir aus die Studis in meinem Heimatseminar, die immerhin irgendwie interessiert waren, wenn sie auch nicht recht wussten, warum. Oder generell Leute, die sich selbstverstÃĪndlich online bewegen. Hier hatte ich 35 gestresste Textpraktis vor mir, von denen kaum welche Blogs lasen, die acht Stunden Agentur in den Knochen hatten und vermutlich einfach nur nach Hause wollten. Mit diesem Stresslevel mÞssen die anderen Dozent*innen natÞrlich auch klarkommen. Aber von denen lernen sie, wie man gute Headlines schreibt oder schÃķne Copys. Da wÞrde ich als zukÞnftiges Texterlein auch zuhÃķren, denn das ist elementar. Ob ich ein Weblog schreibe, ist im Vergleich dazu scheiÃegal. Und so kam mir die Stimmung im Raum leider auch vor.
Ich erspare euch meinen ganzen Vortrag, aber ein paar Punkte will ich doch notieren, notfalls fÞr mich, damit das beim nÃĪchsten Mal besser lÃĪuft. Ich begann bei Adam und Eva: Was sind Blogs, seit wann gibt’s die, Entwicklung von Techie- zu Tagebuchblogs â hier konnte ich mir natÞrlich nicht verkneifen, auf Jean-Remy von Matts âKlowÃĪnde des Internetsâ hinzuweisen, aber damit konnte niemand was anfangen â, sind Blogs der neue Journalismus, darf man mit Blogs Geld verdienen, der ganze alte Quatsch halt. Ich dachte, ich mÞsste erlÃĪutern, wo wir herkommen, um zu wÞrdigen, wo wir sind, aber ich glaube, das war eine ÞberflÞssige Idee. Ich muss ja auch nicht wissen, wie der Buchdruck funktioniert, um mich Þber meinen Amazon-Wunschzettel zu freuen.
Danach ballerte ich die Armen mit 40 Folien voll, auf denen ich Screenshots diverser Blogs abbildete, um die Vielfalt und Funktionen von Blogs klarzumachen: unterhalten, informieren, zu Diskussionen einladen, rummeinen, Einblicke in Leben geben, die man sonst nicht bekommt â was fÞr uns Werber*innen, die gerne ihre Zielgruppe kennt, nicht ganz unwichtig ist. Ich hoffe, ich konnte wenigstens meinen wichtigsten Punkt machen: Jeder hat eine Stimme, jede wird gelesen, Blogs geben Menschen Raum, den sie sich auÃerhalb des Netzes vielleicht nicht nehmen (z. B. dicke Frauen).
Dann gab’s Gruppenarbeit und ich wollte darÞber diskutieren lassen, warum man Kunden Blogs empfehlen sollte oder warum nicht und warum Texterinnen bloggen sollten oder etwa nicht. Ich hatte mir natÞrlich auch Antworten Þberlegt, die auch alle kamen und noch ein paar Gedanken darÞber hinaus; eine Diskussion wurde aber nicht daraus. Was mir zudem ernsthaft erst auf der Bahnfahrt zurÞck ins Hotel eingefallen ist, war das Kracher-Gegenargument fÞr Kundenblogs: Sie haben eben keine eigene Stimme. Eine Firma klingt immer wie eine Firma und nicht wie ein Mensch, Þber dessen Leben ich lesen will. Deswegen lese selbst ich keine Firmenblogs, auch keine von den Autoherstellern, fÞr die ich arbeite (oder gearbeitet habe).
Als Abschluss wurde ich etwas persÃķnlicher. Ich erklÃĪrte ein bisschen meine eigene Blog-Biografie und wie die Rubrik âWas schÃķn warâ entstanden ist. Dann bat ich die Rotte, selbst mal fÞnf Minuten zu Þberlegen und einen Blogeintrag vorzuformulieren: Was hat dich an deinem Tag inspiriert? Was hÃĪlst du fÞr mitteilenswert? Ãber was wÞrdest du gerne schreiben? Ganz simpel.
Bevor die Jungs und MÃĪdels die Stifte spitzten, kamen aber endlich mal Fragen. Unter anderem das Killerding, auf das ich Þberhaupt nicht vorbereitet war, weil ich darÞber seit zehn Jahren nicht mehr nachdenke: âWarum macht man das Ãķffentlich?â Mir fiel wieder auf, dass ich mein Bloggen schlicht nicht mehr hinterfrage, ich mache das einfach, das ist wie ZÃĪhneputzen. Aber genau das kann man natÞrlich niemandem erklÃĪren, der wissen will, warum er oder sie jetzt mit Bloggen anfangen sollte. Ich erwÃĪhnte im Vortrag natÞrlich die vielen tollen Vorteile, die Einblicke in fremde Leben, die vielen Dinge, die man lernen kann, die Reise zu sich selbst blablabla. Aber ich merkte bei jedem Satz, dass ungefÃĪhr 20 Leute innerlich mit den Augen rollten oder Þbers Abendessen nachdachten. Und ich ÃĪrgere mich, dass ich sie nicht gekriegt habe, dass ich die Faszination dieses Mediums nicht vermitteln konnte.
Immerhin ist aus der letzten Ãbung noch was Spannendes rausgekommen. Ich lieà nicht alle 35 erzÃĪhlen, worÞber sie schreiben wollten, das kam mir doch zu klippschulig vor, aber selbst die zehn, fÞnfzehn Leute, die was vortrugen, hatten alle tolle Ideen: ein Spieleblog war dabei, eins Þber Kollegen in der Agentur, die zu spÃĪt kommen, eins, das eventuell Probleme des Alltags lÃķsen wÞrde (oder sie zumindest mal erwÃĪhnt und auseinanderklamÞsert), ein bestimmtes Modeblog. AuÃerdem verstrickte ich mich noch in eine Diskussion mit jemandem aus der ersten Reihe, der partout meinte, er hÃĪtte der Welt nichts mitzuteilen. Ich: âDann schreib doch das langweiligste Blog der Welt. Ãbers Wetter oder so.â Er: âOder Rauhfasertapeten.â Seitdem denke ich Þber genau dieses Blog nach und verdammt nochmal, ich wÞrde es lesen wollen.
Ich hatte von Anfang an das GefÞhl, dass nur wenige mir wirklich gerne zuhÃķrten und deswegen beendete ich alles auch nach 90 Minuten, obwohl ich theoretisch die doppelte Zeitmenge zur VerfÞgung gehabt hÃĪtte. Das frÞhe Ende lag aber auch an mir; mein Probedurchgang mit den ganzen Blogfolien bis zur Diskussion dauerte 45 Minuten, und gestern vor Ort hetzte ich in 30 durch sie durch. Ich ahne, dass ich schwer verstÃĪndlich war â sorry, Kinnings! Das hab ich verkackt.
Aber da ich oft genug erwÃĪhnt habe, dass ich alle Links, die ich gestern vorgetanzt habe, ins Blog stellen werde, sind jetzt hoffentlich trotzdem alle da und klicken die folgende Liste durch. Und bloggen bitte. Nur mal so zum Ausprobieren. FÞr mich. Bussi!
https://wordpress.org/
https://www.blogger.com/blogger.g#welcome
https://antville.org/
https://www.twoday.net/
https://feedly.com/i/welcome
https://maedchenmannschaft.net/
http://www.dirkvongehlen.de/blog/
http://scripting.com/
http://fraunessy.vanessagiese.de/
https://vanessagiese.de/blog/
http://www.thesartorialist.com/
http://www.advanced.style/
http://www.leblogdebigbeauty.com/
https://danceswithfat.wordpress.com/blog/
http://deern.ankegroener.de/
raul.de/blog/
https://narkosearzt.wordpress.com/
https://vierpluseins.wtf/
dooce.com/
http://blog.beetlebum.de/
http://katiakelm.de/blog/
http://www.chestnutandsage.de/
http://www.zeit.de/campus/2017-12/reiseblog-verdienst-blogger-lifestyle
https://nevigeser.blogspot.de/
https://runfurther.de/
https://rhoenradblog.wordpress.com/blog/
https://wassergarten.wordpress.com/
http://apfel.kulturnation.de/
https://www.moritz-hoffmann.de/tag/blog/
https://de.hypotheses.org/
http://www.openedition.org/catalogue-notebooks?page=catalogue&pubtype=carnet&lang=en
http://www.lenbachhaus.de/blog/
https://www.pinakothek.de/blog
https://ideenfreiheit.wordpress.com/
https://blog.daimler.com/
https://blog.audi.de/
text-macht.de/
http://www.carolinegibson.co.uk/blog/
https://exportweltmeister.de/
vimeo.com/226777557
http://www.ineshaeufler.com/blog/
https://kottke.org/18/03/twenty
—
Was schÃķn war, Freitag/Samstag, 9./10. MÃĪrz 2018 â Doktorand*innen-Kolloquium
Die Betreuung von Doktorand*innen an der LMU oder sogar nur am kunsthistorischen Institut ist unterschiedlich, was schon bei der Form der Promotion beginnt: Wenn man sich fÞr eine Promotion am Institut entscheidet, ist man in den Lehrstuhl eingebunden, lehrt meist in geringem Umfang und ist halt wissenschaftliche Angestellte. Der andere Weg ist die klassische Individualpromotion, bei der man nicht an der Uni lehrt oder forscht, sondern irgendwo anders; die meisten meiner Mitstreiter*innen, die ich Freitag erstmals alle in einem Raum kennenlernen konnte, arbeiten bei Museen, Archiven oder kunsthistorischen Einrichtungen wie dem ZI. Einige wenige so wie ich machen etwas ganz anderes und promovieren gezwungenermaÃen nebenbei, was dazu fÞhrt, dass wir ziemlich raus sind, was fachliche Diskussionen angeht oder auch nur den Austausch mit anderen Menschen, die ein ÃĪhnliches Projekt betreuen. Damit auch wir eine Art Anlaufstelle haben, hat mein Doktorvater einfach mal ein Kolloquium ins Leben gerufen, in dem alle seine SchÞtzlinge ihr Thema kurz vortragen und wir dann darÞber diskutieren. Nicht jede*r musste vortragen â ich hÃĪtte auch noch gar nichts sagen kÃķnnen â, aber es war trotzdem spannend, den anderen zuzuhÃķren. Die Wahl des Doktorvaters bedingte auch eine gewisse thematische und/oder zeitliche Eingrenzung, denn der Mann hat natÞrlich seine Spezial- und Interessensgebiete, weswegen wir mit ihm arbeiten wollen. Daher hatte ich bei vielen VortrÃĪgen das GefÞhl, schon zu wissen, worum es ging, was ziemlich toll war.
Ich kann natÞrlich die meisten Themen jetzt nicht genauer ausplaudern, aber mir hat jeder Vortrag etwas gebracht. Ich muss gestehen, dass ich sowohl Freitag als auch Samstag den jeweils letzten Vortrag (oder sogar die zwei letzten) geschwÃĪnzt habe (Hunger, Arbeit), aber dafÞr ist man ja erwachsen. Hat das wenigstens einen Vorteil.
Was ich aus den diversen Themen und Methodikdiskussionen fÞr mich mitgenommen habe und hoffentlich nicht wieder vergessen werde: Ich muss keine EnzyklopÃĪdie schreiben. Das glaube ich natÞrlich bei jeder Hausarbeit und meine, versagt zu haben, wenn ich genau das eben nicht erledigt habe, und natÞrlich weià ich auch, dass das Quatsch ist, aber ich habe bei mir schon wieder die ungute Tendenz festgestellt, Themen gleich zu verwerfen, weil ich weiÃ, dass ich sie nicht komplett (was auch immer das heiÃt) behandeln werde kÃķnnen. Mir haben viele der VortrÃĪge mal wieder vor Augen gefÞhrt, dass das auch nicht mein Job ist. Ich muss ein Thema schlaglichtartig beleuchten, kann ein paar lustige Exkurse machen und einiges vertiefend abhandeln, aber ich muss nicht jeden Fetzen Papier oder Leinwand behandeln, der zu diesem Thema existiert. Das soll eine Diss werden und kein zwanzigbÃĪndiges Lexikon.
Ebenfalls spannend waren fÞr mich die Diskussionen zur Datenerhebung. Ich meine zwar, davor gefeit zu sein, stapelweise Archivgut digitalisieren oder sogar verschlagworten zu mÞssen, aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, welche MÃķglichkeiten es Þberhaupt gibt, Daten zu erheben und zu klassifizieren. Ich habe lustige Programme kennengelernt, die ich vermutlich nie brauche, aber ich weià jetzt, dass es sie gibt. Was vielleicht interessant fÞr mich wird, wenn ich vor meinem Datenberg sitze und mir selbst Þberlegen muss, nach was ich den Kram denn Þberhaupt ordnen will. Bisher hat das ernsthaft mit diversen Word-Dokumenten bei mir funktioniert, weil ich durch meine Arbeit als Katalogtexterin gewÃķhnt bin, den Ãberblick Þber lange Texte zu behalten. Ich ahne aber auch, dass eine Masterarbeit etwas anderes ist als eine Diss und daher sollte ich mir vielleicht jetzt schon Gedanken darÞber machen, ob es noch etwas Sinnvolleres gibt als meine Word-Sammlungen.
Ein kleiner Nebenaspekt wurde in diesem Zusammenhang auch angesprochen: die Ãķsseligen Lizenzierungsmodelle von Software. Wenn man GlÞck hat, Þbernimmt eine Institution wie Uni oder Forschungsstelle die GebÞhr fÞr ein Programm, mit dem man dann ewig arbeiten kann. Wenn man Pech hat, beginnt man mit einem Programm zu arbeiten, das mittendrin sein Lizensierungsmodell ÃĪndert und nur noch Lizenzen auf Zeit verkauft. Dann tippt man lustig zwei Jahre Daten ein â und kann sich danach eventuell das Programm nicht mehr leisten, weil es plÃķtzlich irre teuer geworden ist. Das ist netterweise niemandem von uns passiert, aber darÞber habe ich auch noch nie nachgedacht.
Ich fand es auch mal wieder gut fÞr mich und meine eigene wimmerige Konstitution zu hÃķren, dass eben noch nicht alles ausgeforscht ist. Ich glaube auch nach zehn Semestern, die mir das Gegenteil bewiesen haben, dass alle guten Themen schon weg sind und immer, wenn ich Þber eins nachdenke, haben schon tausend andere das auch gemacht. Ich weiÃ, dass das Quatsch ist, aber manchmal falle ich doch wieder in dieses Loch. Am Freitag wurden zwei Dissertationen vorgetragen zu Themen, bei denen ich mir sicher war, dass dazu schon alles gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass ich hier Geheimnisse verrate, daher: Sie gingen um Heinrich Hoffmann und den US-Kunstschutz wÃĪhrend des Zweiten Weltkriegs. Da hÃĪtte ich Wetten angenommen, dass da schon alle Archive leergelesen sind, aber die Wette hÃĪtte ich sehr deutlich verloren, wie ich jetzt weiÃ. Zu hÃķren, dass ein Doktorand im Kunstarchiv NÞrnberg noch Kisten Ãķffnen konnte, in die nie jemand reingeguckt hatte, nachdem der Nachlassverwalter den Deckel draufgemacht hatte, fand ich sehr spannend.
Auch wieder wichtig fÞr mich und meinen Hinterkopf: vielleicht mal nicht mit einer festen Frage in die Archive gehen, sondern die Quellen entscheiden lassen, wo es hingehen soll. Das habe ich ja eigentlich bei meiner Arbeit zu Leo von Welden schon gelernt, dass es sehr aufschlussreich sein kann, einfach mal alles durchzuwÞhlen, was einem freundliche Archiv-Mitarbeiterinnen oder Heimatmuseumsmenschen vor die Nase legen. und dann zu gucken, was man daraus machen kann. Im Kolloquium berichtete eine Doktorandin, dass es ihr bei ihrem Thema genauso ging: Eine Stadtarchiv-Mitarbeiterin aus (Stadt behalte ich mal fÞr mich) meinte so nebenbei zu ihr, dass da ein groÃes Aktenkonvolut wÃĪre, das sich vielleicht fÞr sie lohnen wÞrde. Und dann stellte die Dame fest, dass dieses Konvolut eine ziemliche RaritÃĪt war, was NS-Unterlagen angeht, denn genau diese Art von Akten hatte die betreffende NS-Organisation sehr groÃflÃĪchig vernichtet â bis auf diesen Berg und noch ein paar kleine weitere in sehr wenigen anderen StÃĪdten. Aber sowas erfÃĪhrt man natÞrlich nicht, wenn man mit einer festen Frage ins Archiv kommt.
Dann ging es auch um Begrifflichkeiten und Definitionen. Was mich an vielen Diskussionen, gerade online und auf Twitter, inzwischen wahnsinig macht, ist, dass kaum noch definiert wird, worÞber eigentlich gesprochen wird. Jeder hat einen schwammigen Begriff im Kopf, aber anstatt erstmal klar zu fassen, worum es geht, pÃķbeln alle auf unterschiedlichen Ebenen herum und kommen so natÞrlich nie auf einen Nenner. In unserem Fall ging es um eine Diss, die sich mit, auch das ist kein Geheimnis, die Diss kannte ich schon von der Herbsttagung des Arbeitskreises Provenienzforschung, sogenannten (hier werde ich schon vorsichtig) jÞdischen Kunsthandlungen in MÞnchen befasst, die zur NS-Zeit âarisiertâ wurden. Wir sprachen darÞber, dass schon diese Klassifizierung â jÞdische Kunsthandlung â ein Unding ist, denn damit machen wir uns die NS-Vorgabe zu eigen. Man kann davon ausgehen, dass viele oder sogar alle KunsthÃĪndler*innen jÞdischen Glaubens diese Tatsache â ihre ReligionszugehÃķrigkeit â nicht als ihren Hauptcharakterzug wahrgenommen haben, vor allem nicht in Bezug auf ihre berufliche TÃĪtigkeit (auÃer sie handelten exklusiv mit Judaica, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass es so ein GeschÃĪft nicht gab). Wir Þbernehmen hier also als Grundlage der Forschung eine Einteilung aus rassistischen GrÞnden. Das muss in der Arbeit natÞrlich dargelegt werden, warum man ausgerechnet eine derartige Abgrenzung nun weiterfÞhrt. Unser Doktorvater erinnerte an Ernst Gombrich, der 1996 auf einem Kongress genau zu diesem Thema streitbar sagte: â[]ch bin der Meinung, dass der Begriff der jÞdischen Kultur von Hitler und seinen Vor- und NachlÃĪufern erfunden wurde.â (Quelle)
Insgesamt mochte ich es sehr, mal wieder mit Menschen in einem Raum zu sitzen, die Þber ÃĪhnliche Dinge wie ich nachdenken, wenn auch nicht genau in der gleichen Ecke wie ich. Es war schÃķn, sich mal wieder mit Themen zu beschÃĪftigen, die an meines angrenzen, und es war sehr befriedigend zu merken, wieviel ich dann doch in den letzten Jahren gelernt und gelesen und erfahren habe, wenn es um das Betriebssystem Kunst im Nationalsozialismus geht. Es hat mich sehr motiviert, mich wieder in die Arbeit zu schmeiÃen, die in den letzten Monaten sehr kurz gekommen ist, weil ich schlicht mit Geldverdienen beschÃĪftigt war. Ich freue mich schon auf unseren nÃĪchsten Termin, der vermutlich im Herbst stattfinden wird. Vielleicht kann ich dann immerhin schon grob sagen, was ich eigentlich so mache.
—
Tagebuch, Montag, 5. MÃĪrz 2018 â Monday, monday, ba-daaa *singt*
Ich habe das GefÞhl, dass sich EintrÃĪge à la âGearbeitet, geschlafenâ wiederholen und sie langweilen mich selbst beim Aufschreiben. Was daran liegen kÃķnnte, dass meine geldwerte Arbeit leider weitaus weniger spannend ist als das, was ich die letzten fÞnf Jahre fÞr lau gemacht habe.
Das ist mir in den letzten Tagen verstÃĪrkt aufgefallen: wie wenig sich das Lesen und Schreiben in Bibliotheken nach Arbeit angefÞhlt hat, sondern stattdessen wie ein schlauer Urlaub. NatÞrlich war ich auch da nach sechs bis acht Stunden angemessen hirntot und brauchte Pausen und Kohlehydrate, aber ich war nie so gefÞhlt doof wie ich jetzt abends bin, wo ich mich kaum noch zu anstÃĪndigen BÞchern aufraffen kann.
Ich erwÃĪhnte bereits, dass sich das teilweise ziellose Rumlesen nie wie verschwendete Zeit angefÞhlt hat. Derzeit bin ich auf mehreren Kunden gebucht, die manchmal Texte oder Konzepte haben wollen, von denen man schon vorher weiÃ, dass sie Quatsch sind. Man macht sie aber trotzdem, damit der Kunde was vorgelegt bekommt, dass er dann als âQuatschâ abtun und sich was Neues wÞnschen kann. Manchmal muss man Dinge halt ausformuliert oder gestaltet vor sich sehen, um zu wissen, nee, das war eine blÃķde Idee. Ich bin davor auch nicht gefeit, wie ich weiÃ, seitdem ich meine Website habe umgestalten lassen. Aber wenn man auf der anderen Seite sitzt und weiÃ, dass man gerade fÞr den Papierkorb arbeitet, strengt es ungemein an. Deutlich mehr als wenn man in der Bibliothek sitzt und ziellos ein Buch nach dem anderen durchblÃĪttert, einfach weil es da ist und man Zeit hat.
Ich merke auch, dass mich meine Arbeit wieder kÃķrperlich anstrengt. Dass sie mich geistig anstrengt, ist normal und erwartbar. Auch wenn man gerne Þber die DÃķsbaddeligkeit von Werbetexten lÃĪstern kann â es kostet MÞhe, sie zu schreiben, vor allem, wenn man trotz ihrer inhÃĪrenten Sinnlosigkeit mÃķchte, dass sie gut lesbar sind, gut klingen und vielleicht doch ein winziges bisschen was zu sagen haben. Ich merke, dass ich abends wieder kÃķrperlich ausgelaugt bin, was ich nach acht Stunden Bibliothek weitaus weniger war. Ich muss mir leider eingestehen, dass ich keine 25 mehr bin und auch keine 35 mehr, wo ich das weitaus besser weggesteckt habe. Ich brauche mehr Zeit fÞr mich selbst, mehr Zeit, den Kopf wieder fÞr mich anzuknipsen, und das kam in letzter Zeit leider zu kurz. Wenn der Schreibtisch eh voll ist und man dann noch angekrÃĪnkelt an ihm sitzt, fÃĪllt alles doppelt schwer. Deswegen passierte im Blog auch in der letzten Woche so wenig; ich hatte nicht mehr die Kraft, Nullnummern wie oben beschrieben â âgearbeitet, geschlafenâ â aufzuschreiben.
Am Freitag und Samstag dieser Woche findet mein erstes Doktorandenkolloquium statt. Ich kann zwar leider selbst noch nicht Þber meine Arbeit Auskunft geben, weil ich schlicht noch nichts Sinnhaftes vortragen kann auÃer einem tollen Plan und viel zu wenig gelesenen Seiten, aber ich freue mich wie irre darauf, von den anderen zu hÃķren, was sie machen und worÞber sie nachdenken. Seit Tagen sitze ich hier, texte vor mich hin und denke: âNur noch drei Tage, dann siehst du endlich wieder normale Leute.â Den Satz habe ich auf der republica zum ersten Mal gehÃķrt und ihn als wahr abgenickt. Hier stimmt der Satz jetzt wieder.
Ich freue mich ebenfalls sehr auf den Semesterbeginn im April, wo ich versuchen werde, mich wenigstens in ein paar Vorlesungen zu setzen, um nicht zu verblÃķden. Ich merke erschrocken, wie sehr meine Unizeit gefÞhlt schon in der Vergangenheit liegt, obwohl ich erst im Oktober mein Masterzeugnis bekommen habe. Aber seitdem habe ich mich so brutal wieder in Richtung Werbung gepolt, dass sich das schon wie ein anderes Leben anfÞhlt. War es wohl auch. Merke ich auch erst jetzt so richtig.
Ich mÃķchte daher bewusster versuchen, mir wenigstens Reste dieses schlauen, schÃķnen, selbstbestimmten Lebens ins Werberleben zu retten. Deswegen ja auch die Diss, die ich nicht mehr als Karrierestufe sehe, sondern als roter Faden, an dem ich mich ein bisschen langhangeln kann an schlechten Tagen oder denen, die mich ÞbermÃĪÃig anstrengen, weil sie mit Quatsch gefÞllt sind. Ich mÃķchte versuchen, sie nicht als Pflicht anzusehen, als Ding, was auch noch erledigt werden muss neben dem ganzen Kram, der auf meinem Tisch liegt. Ich mÃķchte versuchen, sie als groÃartiges Ding wahrzunehmen, dass dafÞr sorgt, dass ich ein winziges bisschen weiter Kunsthistorikerin spielen darf, obwohl das auf meiner Visitenkarte erst nach der Werberin kommt. Ich mÃķchte auf meinen Alltag besser aufpassen, damit er nicht zu alltÃĪglich wird. Sonst bin ich in fÞnf Jahren wieder da, wo ich schon mal war. Andererseits kÃķnnte ich dann noch einen Politik-Bachelor hintendranhÃĪngen, wÃĪr auch spannend.
—
Was schÃķn war, Samstag, 17. Februar 2018 â Zwei Museen, drei Ausstellungen, eine Sammlung
F. und ich schoben einen Kurzurlaub in Frankfurt, ja, Frankfurt ein und setzten uns Freitag abend in MÞnchen in den Zug. Nachdem wir unsere Taschen im Hotel losgeworden waren, erkundeten wir drei Restaurants, die uns von einer freundlichen Frankfurterin empfohlen worden waren; eins davon bot leider nur Buffet, darauf hatte ich keine Lust, und die anderen beiden waren, fast logisch, an einem Freitagabend um 21 Uhr pickepackevoll. Google und Yelp schickten uns zum Mian-Nudelhaus, das aussieht wie eine bessere Imbissbude; wir wurden aber sehr freundlich und schnell bedient und verlieÃen es ÃĪuÃerst gut gesÃĪttigt und zufrieden.
Dann schliefen wir in unserem brummenden Hotel mehr schlecht als recht, weil es ohne OhrenstÃķpsel nur schwer zu ertragen war, aber es war billig, hatte ein gutes FrÞhstÞck und lag in BahnhofsnÃĪhe. Am nÃĪchsten Morgen checkten wir aus und marschierten mit GepÃĪck zum ersten Ziel, der Schirn. Was da schon auf dem Weg lag! Toll.
Das europÃĪische Patentamt in MÞnchen nimmt mich emotional nicht so mit wie die europÃĪische Zentralbank in Frankfurt. Wahrscheinlich weil nichts Blaugelbes mit Sternen davor steht.
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 17. Februar 2018
âDas ist also der RÃķmer.â âBekannt von FuÃballweltmeisterschaften.â
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 17. Februar 2018
An der Schirn kamen wir um wenige Minuten vor zehn Uhr (eigentliche Ãffnungszeit) an, aber die TÞren waren schon auf, also gingen wir rein und gleich zur noch leeren Garderobe durch, um unsere zwei RucksÃĪcke, eine kleine Sporttasche und zwei dicke Jacken loszuwerden. Die freundlichen Damen Þberreichten uns vier bunte Zettelchen zur spÃĪteren Abholung und wir gingen mit unseren im Interweb gekauften Tickets in den ersten Stock, wo die Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik auf uns wartete. Die lÃĪuft nur noch bis zum 25. Februar, also geht da doch bitte schnell noch rein, ich kann die sehr empfehlen.
Da ich mich in der Diss mit der ollen NS-Zeit beschÃĪftige, ist Weimar nicht ganz unwichtig. Ich fand die Ausstellung recht clever gehÃĪngt; sie beginnt gleich mit Politik. Normalerweise hat man ja gerne einen Rundgang, also einen klaren Anfang und ein ebensolches Ende, aber hier hat man einen langen GebÃĪudeflÞgel, den man in eine Richtung ablÃĪuft â und dann wieder zurÞckmuss. Das heiÃt, Politik steht nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende der Ausstellung und das fand ich sehr schlau.
Was mir auch gefallen hat: dass viele, ich nenne sie mal so, weibliche Themen angesprochen wurden und viele KÞnstlerinnen zu sehen waren. Die neue Frau mit Bubikopf, einem Job und Zigarette, ja, geschenkt. Aber dass auch die Themen Paragraf 218, Abtreibung und Prostitution explizit bildlich angesprochen bzw. per Wandtext deutlich gemacht wurden, fand ich sehr spannend. Hier mochte ich auch den Blick von Frauen auf Frauen. Meiner Meinung nach sah man Bildern, gerade von Prostituierten oder TÃĪnzerinnen, sehr deutlich an, ob sie von einem Mann oder von einer Frau gemalt wurden. (Zumindest habe ich meist richtig geraten, bevor ich auf das Schild mit dem KÞnstler*innennamen geguckt habe.) Auch auffÃĪllig war der neue Blick auf Frauen, der mit der Neuen Sachlichkeit zusammenhing. Frauen wurden zwar durchaus immer noch verklÃĪrt und aufgehÞbscht oder neusachlich-realistisch wiedergegeben, aber eben auch bildlich verzerrt. Die angebliche HÃĪsslichkeit, die der Moderne gerade vom NS-Regime vorgeworfen wurde, machte vor dem âschÃķnen Geschlechtâ netterweise nicht halt.
Neu entdeckt habe ich Kate Diehn-Bitt, Þber die wir im ZI gerade lausige vier Kataloge haben, die aber 400 verdient gehabt hÃĪtte. Hilde Rakebrand. Hanna Nagel. Jeanne Mammen. Dodo. Ãber Lotte Laserstein hatten wir in unserem Rosenheim-Seminar gesprochen und ich habe mich gefreut, ein Bild, das ich dort sah, nun im Original vor der Nase gehabt zu haben. (Sowas freut mich immer, keine Ahnung warum.) Und Elfriede Lohse-WÃĪchtler kannte ich natÞrlich aus der Hamburger Kunsthalle, aber hier hingen fast nur Werke von ihr, die ich ihr nie zugeschrieben hÃĪtte in ihrer bunten Wildheit. Toll.
Gleich im ersten Raum hing mein Lieblingsbild â Karl VÃķlkers Bahnhof (1924-26) â, aber im fÞr mich letzten Raum hatte der Bahnhof dann verloren, denn dort hingen gleich drei Werke von Carl Grossberg, auf den ich ja seit einigen Monaten besonders schaue. Das wusste ich vorher nicht, fiepste sofort fangirlmÃĪÃig auf Twitter rum und blieb sehr lange vor den starren, kÞhlen, bewegungslosen Industriedarstellungen Grossbergs stehen.
F. und ich unterhielten uns wÃĪhrend der Ausstellung schon Þber viele Bilder, aber auch danach, als wir uns fÞr die nÃĪchste Ausstellung im CafÃĐ stÃĪrkten.
Ich so: âImmer wenn ich Kram aus Weimar gucke, bin ich auf mich selbst pissig, dass ich wissenschaftlich in der NS-Zeit hÃĪngengeblieben bin.â F. so: *lÃĪchelt sibyllinisch*
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 17. Februar 2018
Im Vorfeld hatte ich Þber die Jil-Sander-Ausstellung nachgedacht und mir war Jean-Michel Basquiat eigentlich eher egal, aber die erste Ausstellung in der Schirn hatte mir gut gefallen, wir waren gerade da und hatten noch Þppig Zeit â also blieben wir erst einmal im gleichen Haus. Die Garderobe war ja auch schon abgegeben, wie praktisch, denn nun standen dort dreimal so viele Leute an wie vor der Kasse, wo wir zwei Karten fÞr die gerade erÃķffnete Basquiat-Ausstellung erwarben und wieder in den ersten Stock gingen.
Mit Basquiat habe ich mich noch nie wissenschaftlich beschÃĪftigt. Ich hatte ihn in den 80er-Jahren durchaus wahrgenommen, auch im Kontext mit Keith Haring, den ich sehr mag â ich verweise auf meinen weinerlichen Podcast-Einsatz ab Minute 54:20 â, aber eine echte Meinung hatte ich nicht zu ihm. Die habe ich jetzt aber nach dieser guten Ausstellung.
Sie begann mit einigen SchaukÃĪsten, die ich nur gestreift habe (âim Vorbeigehen lernenâ), und weil die Ausstellung so neu war, war sie dementsprechend voll, weswegen man dann nur noch im Schritttempo an einer Fotosammlung vorbeikam, in der SÃĪtze von Basquiat zu lesen waren, die er Ende der 1970er-Jahre in New York auf TÞren und WÃĪnden hinterlassen hatte. Das war schon das erste Aha-Erlebnis fÞr mich: was fÞr clevere, kleine Vignetten da zu finden waren. Alleine fÞr die hÃĪtte ich mir den Katalog kaufen mÞssen, wie ich inzwischen festgestellt habe, aber am Samstag dachte ich noch, och, das war nett, okay, weiter, aber diese Ausstellung rumort seitdem in mir und arbeitet und jetzt muss ich 15 Euro mehr fÞr den Katalog zahlen, weil ich ihn dringend von meiner BuchhÃĪndlerin ordern will.
Im nÃĪchsten Raum wurde dann Basquiats erste regulÃĪre Galerieausstellung nachgebaut, was mir sehr gut gefallen hat. Diesen ersten Eindruck von einem KÞnstler kriegt man ja nie wieder hin, erst recht nicht 30 Jahre spÃĪter, aber diese HÃĪngung versucht es wenigstens und das klappt meiner Meinung nach ganz gut. Ãberhaupt hat bei mir die Ausstellung ein neues VerstÃĪndnis fÞr Basquiat geschaffen, das ich vorher schlicht deswegen nicht hatte, weil ich nur mal hier und mal da ein Werk von ihm gesehen habe, aber nie so viel auf einmal. Alleine das war das Eintrittsgeld schon wert.
Ich will jetzt gar nicht die Ausstellung beschreiben, das kÃķnnen andere besser, aber fÞr mich war das ein groÃer Gewinn, sie gesehen zu haben. Und gleichzeitig ist mir der Verlust dieses KÞnstlers wieder klargeworden. Bei dieser Ausstellung dachte ich, wie bei Haring auch schon: Was hÃĪtte aus ihm werden kÃķnnen. Was verdammt nochmal hÃĪtte aus ihm werden kÃķnnen. Wer mit Anfang und Mitte 20 schon so schlau und reflektiert und wissenshungrig und neugierig auf alles war â was wÃĪre er mit 30, 40, 50 gewesen? Ãber was wÞrde er heute nachdenken? Ich hÃĪtte gerne gesehen, wie das Internet seine Arbeit verÃĪndert hÃĪtte, die immer sehr mediengeprÃĪgt war. Und ich hÃĪtte gerne noch viele SelbstportrÃĪts von ihm gesehen; der Raum hat mir am besten gefallen. Vielleicht hÃĪtte der Mann auch mit 35 eine Burgerbude aufgemacht, auch okay. Trotzdem. Verdammt.
Gleichzeitig beschenkt und bedrÞckt gingen wir wieder nach unten, holten unseren Berg GepÃĪck ab, erstanden zwei Kataloge zur Weimar-Ausstellung, die F. den Rest des Tages heldenhaft schleppte, und dann wussten wir erstmal nicht weiter. Auf Jil Sander hatte ich jetzt doch keine Lust mehr, auf den Brutalismus im Architekturmuseum auch nicht, auch die anderen Tipps, die uns auf Twitter gegeben wurden, wollten wir nicht sehen. Also spazierten wir erst einmal Þber den Main â und landeten dann fast zwangslÃĪufig im StÃĪdel. Dort hatte ich vor gefÞhlt ewigen Zeiten endlich die Flemaller Tafeln gesehen und schwÃĪrmte F. davon vor. Dass sie gerade ausgelagert wurden, sahen wir erst im Museum, woraufhin ich meine Laune bei niederlÃĪndischen Stillleben aufbesserte und dann mit F. im Stechschritt durch die Sammlung ging. Wir guckten uns auch brav die Rubens-Ausstellung an, die mir total egal war, aber F. so: âIscho bezahltâ, also gingen wir durch. War bestimmt toll, aber ich blieb wirklich nirgends stehen. Rubens halt. Der Barock und ich werden vermutlich keine Freunde mehr.
Stattdessen gingen wir ins Untergeschoss, wo zeitgenÃķssische Kunst hÃĪngt und liegt und steht und rumblinkt und sich bewegt. Den Bereich des StÃĪdel hatte ich beim letzten Besuch nicht angeschaut und so war das auch alles neu fÞr mich. Wir fanden alles toll, suchten nach den bekannten Namen, entdeckten unbekannte, und ich musste natÞrlich in einer Leuchtinstallation von James Turrell an den Reglern drehen und meinen Kopf in ein tiefes Rot stecken.
Irgendwann war mein Hirn dann aber wirklich voll und meine FÞÃe nÃķlten auch. Zur StÃĪrkung gab es am Bahnhof ein bisschen Fine Dining bei Burger King, dann suchten wir die guten Toiletten in der Bahn-Lounge auf und lieÃen uns noch ein HeiÃgetrÃĪnk servieren, bevor wir dreieinhalb Stunden lang nach MÞnchen zurÞckschaukelten. Viel gesehen, viel gelernt. Gerne wieder.
âUnd, was hat Ihnen an Frankfurt am besten gefallen?â âDass man nach 20 Uhr noch im Supermarkt einkaufen konnte WIE EIN NORMALER MENSCH.â
— Anke GrÃķner (@ankegroener) 17. Februar 2018
—
Was schÃķn war, Mittwoch, 17. Januar 2018 â 100 Metronome
Gestern abend saà ich im Herkulessaal und lauschte den MÞnchner Symphonikern sowie ihrem Gast Alexej Gerassimez, einem Percussionisten.
Ich war noch nie im Herkulessaal und freute mich erstmal Þber die Nachkriegsarchitektur, die meiner Meinung nach nur haarscharf an der NS-Architektur vorbeigeschrammt war. Dann freute ich mich Þber die bequemen StÞhle und die Beinfreiheit im Parkett, wo ich endlich mal wieder saÃ. Und dann freute ich mich Þber die Gelbe Couch, eine kleine viertelstÞndige GesprÃĪchsrunde, die bei einigen Konzerten der Symphoniker angeboten wird. Dabei erzÃĪhlt der Gast dann gerne was, jedenfalls war das gestern so. Gerassimez wurde gefragt, ob er ein bisschen was zeigen kÃķnnte, woraufhin der charmante und eloquente Herr sein Smartphone zÞckte und erzÃĪhlte, dass er gerne Rhythmen oder KlÃĪnge aufnehme. Das erste, was er uns vorspielte, waren die klackenden Schaltungen an FuÃgÃĪngerampeln. Dann kam ein GerÃĪusch, was ich nicht identifizieren konnte, aber ich glaube, das ging allen im Saal so. Ich habe es mir vermutlich nicht ganz korrekt gemerkt, aber es war etwas Ãhnliches wie eine klickernde Zeitschaltuhr im Bad eines Hotelzimmers. Das letzte hielt ich fÞr einen nicht anspringenden Trabant, aber es war der Drucker seines Freundes.
Gut gelaunt wartete ich dann auf den Beginn des Konzerts. Am BÞhnenrand standen bereits 100 Metronome fÞr das erste StÞck: PoÃĻme symphonique â Musikalisches Zeremoniell fÞr 100 Metronome von GyÃķrgy Ligeti. Auf YouTube gibt es mehrere Versionen, ich habe mal die hier genommen. Dort werden alle Metronome gleichzeitig in Gang gesetzt (oder halbwegs gleichzeitig), es gibt auch Versionen, in denen das nach und nach passiert. Die Dinger sind auf eine bestimmte Dauer eingestellt, irgendwann hÃķrt man 100, dann ganz allmÃĪhlich nur noch eins, bis auch das verstummt. Mir wurde gestern erzÃĪhlt, dass bei der UrauffÞhrung 1962 eine Panne passierte und das verdammte letzte Metronom partout nicht aufhÃķren wollte. You go, girl!
Bei uns traten gestern acht Menschen an den BÞhnenrand und setzten die Metronome halbwegs gleichzeitig in Gang. Das Publikum verstummte leider nicht so schnell wie ich es mir gewÞnscht hÃĪtte, obwohl das stille Orchester, das hinter den Metronomen schon Platz genommen hatte, doch deutlich machte, dass das Konzert jetzt losgeht. Ich fand es sehr spannend, welche Dynamik 100 klackernde KÃĪstchen entwickeln; ich musste an VogelschwÃĪrme denken (murmurations), die sich zusammenfinden, scheinbar eine Formation bilden und sie sofort wieder verlassen. So ging es mir auch, mein Gehirn wollte immer eine Struktur im Geklacker finden, ich bildete mir auch ein, fÞr einen winzigen Augenblick eine erfasst zu haben, aber da war sie schon wieder weg. Nach und nach klickten immer weniger Metronome, ich meinte, nur noch rechts etwas zu hÃķren, aber da war plÃķtzlich links wieder was, aber schlieÃlich war es wirklich nur noch eins.
In diesem Moment kamen der Dirigent und Gerassimez auf die BÞhne und letzterer schlug, wenn ich das aus der 23. Reihe richtig erkannt habe, mit einem Drumstick auf ein Klangholz ein, schÃķn im Takt vom Metronom, gefÞhlt minutenlang. Ich fragte mich irgendwann, wie man aus dieser Nummer jemals wieder rauskommen kÃķnnte, als er plÃķtzlich den Takt verÃĪnderte. Wo er eben noch synchron mit dem Metronom war, spiele er jetzt quasi dagegen an. Ein kleines Metronom und ein Klangholz und der ganze Saal war ruhig. Irre meditativ und gleichzeitig hochspannend.
Dann trug die Indendantin das arme kleine klackernde Metronom hinter die BÞhne, wÃĪhrend Gerassimez weiter den Takt hielt â und plÃķtzlich begann das zweite StÞck, Frozen in Time von Avner Dorman. Das war dann eine halbe Stunde, in der ich Þberhaupt nicht zum Denken kam, sondern nur staunte und zuhÃķrte. Ich war Þberrascht davon, wie sehr Percussion den gewohnten Klang eines klassischen Orchesters verÃĪndern kann. Mittendrin konnte ich Instrumente gar nicht mehr erkennen; irgendwann kam eine Stelle, die fÞr mich nach Morsezeichen klang, und ich hÃĪtte nicht sagen, wer diesen Klang gerade erzeugte.
In der Pause war mein Gehirn dann wieder da und ich dachte darÞber nach, was Gerassimez auf der Gelben Couch noch gesagt hatte: dass er seinen Arbeitsplatz quasi fÞr jedes StÞck neu aufbauen mÞsse, je nachdem, ob nun mehr Schlagzeug, mehr Vibraphon oder mehr Cowbells darin vorkÃĪmen. (Bei âCowbellsâ ging bei mir kurzfristig nichts mehr, ist klar.) Ich fand es sehr spannend, ihm beim Arbeiten zuzusehen, denn natÞrlich war sein Bewegungsradius grÃķÃer als der der anderen Musiker*innen hinter und neben ihm, konnte dem StÞck aber nicht so folgen wie ich gewohnter klassischer Musik folge. Aber genau das fand ich so toll; ich wusste nie, was in der nÃĪchsten Sekunde passierte und konnte es auch nicht vorausahnen â im Gegensatz zum Haydn, der nach der Pause kam und wo man, wenn man ein paar klassische StÞcke gehÃķrt hat, grundsÃĪtzlich ahnte, wie es weitergeht. Das hier war eine klingende WundertÞte und ich habe sie sehr genossen.
Auch die Zugabe, eine Eigenkomposition Gerassimezâ, war spannend; ich wusste nicht, wieviele unterschiedliche KlÃĪnge man aus einer Snare Drum herausbekommen kann.
In der Pause las ich mein neues Buch, das sich als sehr pausenkompatibel herausstellte: Es hat perfektes Handtaschenformat, und weil in ihm einzelne AufsÃĪtze sind, kann man es in HÃĪppchen lesen. So erfuhr ich schlaue Dinge Þber Ulysses, die sogar zum Konzert passten. Genau wie das Klangmeer, in das ich eben unvorbereitet geworfen wurde, lese ich Ulysses: ahnungslos, aber neugierig. Und so wie Ligeti und Dorman aus bekannten Noten etwas vÃķllig Neues bastelten, nutzte Joyce die Sprache. Das Buch ist âeine groÃe Chance, das Lesen wieder einzuÞben, schon weil darin die Sprache selber auch zum Gegenstand wird. Ulysses wandelt die MÃķglichkeiten der Sprache ab, die subjektiven Versuche, die Welt und sich selbst zu benennen und mitzuteilen.â (Fritz Senn: Nichts gegen Joyce. AufsÃĪtze 1959â1983, hrsg. von Franz Cavigelli, ZÞrich 1983, S. 33/34.)
Der zweite Teil des Konzerts war dann etwas blasser. Die Uhr von Haydn plÞschte so vor sich hin, und ich konnte im Kopf den Blogeintrag vorformulieren, aber die Rosenkavalier-Suite von Richard Strauss konnte mich dann wieder fesseln.
Auf dem Weg nach Hause stand ich an einer Bushaltestelle, wo das City Light Poster knarzend durchwechselte. Mein erster Gedanke war: Meine GÞte, machst du Krach. Mein zweiter war allerdings: Gerassimez wÞrde jetzt vermutlich sein Smartphone zÞcken. Und so lauschte ich grinsend diesem neuen Klang, bis mein Bus kam.
—
Tagebuch, Donnerstag, 11. Januar 2018 â Fragezeichen und Candy Crush
Wie nach dem doofen Schreibtag vorgestern zu erwarten war, folgte gestern auf ihn ein guter. Ich saà mit einer Kanne Earl Grey am Schreibtisch und tippte entspannt vor mich hin, immer mit der Nase in diversen Kundendokumenten oder der Website oder Google oder womit ich mir sonst Infos suche. Erstmals hatte ich auch in den Uni-Datenbanken nach Informationen gestÃķbert, was ich sehr lustig fand. Best of both worlds.
Abends eine Quiche gemacht, weil die grÞnen Bohnen wegmussten; die faule Variante mit fertigem BlÃĪtterteig allerdings, kein MÞrbeteig. Danach kein Ulysses, weil ich schon bei der abendlichen Runde Candy Crush fast eingeschlafen wÃĪre. Das schwere Buch wÃĪre mir vermutlich auf die Nase gefallen beim Lesen, also Licht aus.
—
Nachmittags bekam ich einen seltsamen Anruf. (Keine Ahnung, ob die Anruferin hier mitliest, aber da muss sie jetzt durch.)
Wir sind in einem sozialen Netzwerk miteinander verbunden, ich kenne die Dame aber Þberhaupt nicht persÃķnlich und sie mich vermutlich auch nicht. Sie arbeitet in der PR-Branche, was etwas anderes ist als Werbung. Ich selbst habe noch nie PR gemacht und will das auch nicht, daher weià ich nicht, ob ihr Anliegen dort vÃķllig normal ist â ich als Werbetante war ein bisschen verwirrt und irritiert.
Die Kurzfassung: Die Anruferin erkundigte sich, ob sie mich ihren Kontakten als Texterin weiterempfehlen sollte â gegen eine kleine GebÞhr. Das hÃĪtte sich in ihrem Kolleg*innenkreis so eingebÞrgert, dass man sich gegenseitig weiterempfiehlt, aber eben gegen Geld. Wahrscheinlich habe ich im Telefonat sehr viele GerÃĪusche à la âHm? Was? Grmpf. HÃĪ?â von mir gegeben, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, Geld dafÞr zu verlangen, dass ich jemanden weiterempfehle.
Vor dem Studium hatte ich immer wieder Anfragen, die ich ablehnen musste, weil ich ausgebucht war (ah, those were the days). Dann kam unweigerlich die Frage, ob ich jemanden empfehlen kÃķnnte, und ich hatte damals eine E-Mail als Vorlage griffbereit, die ich lustig copypastete. Darauf standen immer die selben fÞnf Namen von Texter*innen, die ich persÃķnlich kannte und schÃĪtzte und mit denen ich vor allem schon mal zusammengearbeitet hatte. Ich empfahl nur Leute weiter, von denen ich wusste, dass sie a) nette Menschen sind und b) einen guten Job machen. Manchmal kam eine Mail zurÞck von den Leuten, die ich empfohlen hatte, in der sie sich fÞr die Empfehlung bedankten, was mich immer freute. Und manchmal kamen Anfragen an mich, wo mich jemand empfohlen hatte, wofÞr ich mich dann bedankte. FÞr einen richtig groÃen Job bei einer Agentur, die mich noch nie gebucht hatte, orderte ich auch schon mal eine Flasche Schampus bei Amazon und schickte die an den Empfehlenden. Aber das war’s. Ich wollte nie Geld fÞr eine Empfehlung und ich habe auch nie welches gegeben.
Daher war ich ehrlich verwirrt Þber diese seltsame Anfrage von einer Frau, die nicht viel von meiner Arbeit wusste und mich eben auch nicht persÃķnlich kannte. Warum sollte die mich weiterempfehlen? AuÃer fÞr Geld natÞrlich, aber das ist doch kompletter Quatsch. Das ist doch so, als ob ich Leuten Produkte empfehle, die ich selber nicht ausprobiert habe, nur weil ich Geld … oh wait.
Ich habe in meinem Werberleben bisher nur fÞr Produkte Verkoofe gemacht, hinter denen ich moralisch stehen kann (mindestens halbwegs). Mit Alkohol habe ich kein Problem (dafÞr habe ich Werbung gemacht), mit Zigaretten schon eher (musste ich noch nie bewerben), mit Werbung, die sich speziell an Kinder richtet, hÃĪtte ich ein Problem (musste ich noch nicht), so langsam habe ich ein Problem mit Finanzdienstleistungen und auch der Automobilindustrie (zwei Dinge, die ich lang und breit beworben habe). Ich habe noch nie irgendein Springer-Produkt beworben, noch nie eine politische Partei und noch nie ein Frauenmagazin (oder wie ich die Dinger nenne: Anleitung zum Selbsthass). Ich habe schon vieles beworben, bei dem ich dachte, was soll der ScheiÃ, aber auch schon vieles, bei dem ich dachte, hÃĪtte ich gerne.
Das SchÃķne an der Arbeit in Agenturen ist, dass man sich hinter deren Namen verstecken kann. Mein Name steht unter keiner Kampagne, in keiner BroschÞre, auf keinem Plakat. Aber wenn ich persÃķnlich jemanden empfehle, also fÞr ihn Werbung mache, dann ist das etwas ganz anderes. Dann bÞrge ich gefÞhlt persÃķnlich fÞr diesen Kollegen oder diese Kollegin. Und wenn dieser Kollege dann Mist baut, bleibt eventuell hÃĪngen, dass ich ihn empfohlen habe, was im Endeffekt heiÃt, dass ich Mist gebaut habe. Auch deswegen ist es mir schleierhaft, warum mich Menschen empfehlen wollen, die keine Ahnung davon haben, wie ich arbeite oder ob man es mit mir in einem BÞro aushÃĪlt. Geld, schon klar. Aber wegen einer luschigen Provision setze ich doch nicht meinen Namen aufs Spiel, der im Prinzip die einzige Visitenkarte ist, die in dieser Branche was taugt. Jeder von uns hat eine tolle Mappe, weil jeder von uns mit tollen Leuten zusammenarbeitet, das zeichnet mich nicht aus. Ich werde gebucht, weil andere mich als fÃĪhigen Menschen kennen und den Personaler*innen davon erzÃĪhlen.
Jedenfalls glaube ich das. Oder mÃķchte es weiterhin glauben. Ich werde weiterhin nur Schampus oder Mails verschicken und verdiene mein Geld lieber mit Texten als mit Empfehlen. Oder mit Bloggen: Ich habe meinen ersten Patreon-FÃķrderer, yay! DankeschÃķn! (EichhÃķrnchen und so.)
—
Tagebuch, Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. Januar 2018 â Im TexterflÃķz
Ich bin fÞr vier Tage in Hamburg gebucht, danach noch fÞr eine Zeit vom Home Office aus (oder âremoteâ, wie wir Werbeschnacker neuerdings sagen). Eigentlich sollte ich nur fÞr das Briefing hochkommen, aber ich finde es ganz nett, in einer neuen Agentur auf einem neuen Kunden und auf einem Produkt, von dem ich noch keine Ahnung habe, erstmal in Rufweite von Kreativdirektorin und Arterin zu sitzen, um dumme Fragen stellen zu kÃķnnen. Also packte ich am Montag mein kleines KÃķfferchen, stand Dienstag sehr nÃķlig um 4 Uhr morgens auf, um den 7-Uhr-10-Flieger zu kriegen, denn wir wissen ja alle, DASS DER BEKNACKTE MÃNCHNER FLUGHAFEN RANT ENTFERNUNG EINE STUNDE S-BAHN ARSCH DER HEIDE WATZEFACK.
In Hamburg angekommen, gÃķnnte ich mir als allererstes ein FranzbrÃķtchen, das aber zu matschig aussah, um es zu instagrammen. Die Stadt hat mich auch schon mal enthusiastischer empfangen. Der Taxifahrer sprintete mich nach Winterhude, wo ich sogar noch zu frÞh ankam, was aber okay war. Ich wurde kurz rumgefÞhrt, gab vielen Leuten die Hand (wie in der Zone, sÞÃ), mir wurden die wichtigen Stationen KÞche, Klo und Drucker gezeigt und dann durfte ich in meinem EinzelbÞro Platz nehmen, in dem sonst ein anderer Texter sitzt, der aber die ganze Woche frei hat. Ich hatte nicht mal als Festangestellte ein EinzelbÞro und fÞhlte mich daher sofort wie eine kleine Prinzessin. Eine Prinzessin mit einem 21-Zoll-Mac vor der Nase, neben dem mein geliebtes MacBook auf einmal wie ein Puppenstubencomputer aussah und sich auch so anfÞhlte. Ich will jetzt auch einen 21-Zoll-Mac fÞr zuhause. Man kriegt Þberraschend wenig Kopfschmerzen, wenn man den ganzen Tag geradeaus guckt anstatt komisch nach unten. (Ob ich den ins ZI tragen kann?)
Ich habe in den Jahren des Studiums nicht mehr viel auf der Langstrecke gearbeitet, musste also keine BroschÞre mehr konzipieren oder Inhalte auf 24 bis 96 Seiten verteilen. Stattdessen bekam ich meist schon viele Vorgaben, die ânur nochâ ausgetextet werden mussten. Hier darf ich wieder konzipieren und verteilen, und ich habe es sehr genossen, dass die alten FÃĪhigkeiten sofort wieder da waren. Ich hatte ein winziges bisschen Sorge, dass ich das verlernt haben kÃķnnte, aber anscheinend ist Verkaufsliteratur wie Fahrradfahren. So tippte ich gut gelaunt Headlines, Sublines und Copyinhalte vor mich hin, bastelte mit CDeuse und Arterin einen Seitenplan, stimmte Lines ab, korrigierte, holte mir zwischendurch einen Salat zum Mittag und einen Schokoriegel fÞr den langen Nachmittag, verkniff mir ein âMahlzeitâ in der KÞche, versuchte mir viele Namen zu merken und musste wieder Stundenzettel ausfÞllen. Deren Existenz hatte ich gnÃĪdig verdrÃĪngt.
—
Es ist seltsam, wieder in dieser Stadt zu sein. Ich mache hier Dinge, fÞr die ich mal nach Hamburg gezogen bin und die ich danach fast ausschlieÃlich in Hamburg gemacht habe. Es fÞhlt sich ein bisschen an, als wÃĪren die letzten fÞnf Jahre gar nicht passiert, ich stapfe wieder durch den Regen zu einem Bus, der mich in eine Agentur bringt. Die blÃķde Busansagestimme hat sich leider in den zwei Jahren meines Wegzugs nicht verÃĪndert, die ist immer noch grauenhaft. Aber gleichzeitig hat sie eben die vergangenen Jahre kurz vÃķllig weggewischt. Ich hÃķre sie und bin wieder die Werberin. Ich werde mich erst wieder wie eine Kunsthistorikerin fÞhlen, wenn ich die vÃķllig vernuschelten Ansagen in der MÞnchner U-Bahn hÃķre.
—
Was mich auch sofort wieder zurÞckholte: der Hamburger Regen. In MÞnchen ist Regen so ein bisschen Wasser von oben, bei dem man theoretisch im T-Shirt rausgehen kann, auch wenn die MÞnchner*innen stets so tun, als ob die Welt untergeht. In Hamburg bringt Regen gerne noch seinen Kumpel Wind mit, der dafÞr sorgt, dass keine Kapuze hÃĪlt und kein Schirm und man grundsÃĪtzlich immer nass wird, ganz egal, wie clever man sich anzieht. Das fand ich einerseits total nervig â aber seltsamerweise auch total schÃķn.
—
Ich habe ohne nachzudenken eins der Motel Ones in der Stadt gebucht, weil ich weiÃ, dass die Betten da bequem sind, das Bad hÞbsch ist und das W-LAN funktioniert. Als ich am Mittwoch das erste Mal vom Motel aus in Richtung Bus ging, fiel mir auf, dass ich von der Bushaltestelle aus die Alster sehen kann. Auch die hatte ich vÃķllig vergessen. Ich bin in MÞnchen immer total verzÞckt, wenn ich die Isar sehe, das kleine BÃĪchlein, mehr haben wir ja nicht. Das war schÃķn, mal wieder auf eine richtige WasserflÃĪche zu gucken, souverÃĪn, prÃĪsent, groà und breit, da halt, Fresse, FlÞsschen.
—
Und dann habe ich Kai getroffen, was mich einerseits glÞcklich und andererseits traurig gemacht hat, aber das war wohl zu erwarten und passt gerade ganz gut in die Gesamtstimmung, in der ich hier durch den Tag treibe. Heute wird noch gearbeitet, und morgen mache ich dann die Touristin, die sich endlich die renovierte Kunsthalle mit meinem geliebten Leibl und die Elphi anguckt (wenigstens von auÃen). Allerdings mÞssen die beiden sich schon sehr lang machen, denn gestern abend habe ich in charmanter Begleitung im ÃĪltesten Block House Deutschlands gegessen. Damit ist Hamburg quasi durchgespielt.